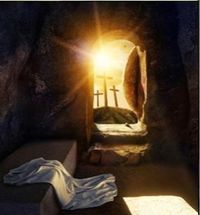Geistliche Impulse:
Christus allein - der leise Sieger über den Tod
Maestro della Misericordia, Der auferstandene Christus 1370-1375,
Vatikanische Pinakothek
Gedanken zu einem Osterbild von Kurt Josef Wecker
“Der Auferstandene” Florentinische Schule, Vatikanische Pinakothek, Vatikanstadt.
Wenn ich in Rom die Kirche „Santa Maria sopra Minerva“ nahe des
Pantheons besuche, dann gerate ich vor die Skulptur des völlig nackten
auferstandenen Christus, wie ihn Michelangelo (1519-1520) aus Marmor
gemeißelt hat. Als Zeichen seines Triumphs über den Tod scheint Christus
mit dem Kreuz als Siegeszeichen im Arm mühelos und entfesselt dem
Grab erstanden zu sein und alle irdischen Textilien und Leichentücher
hinter sich gelassen zu haben. In der Antike wurde die Nacktheit mit
Göttlichkeit verbunden. Und der jugendliche Auferstandene wirkt wie
Herkules oder Apollo. An Michelangelos Figur wurde einige Jahre später
aus Prüderie die Scham Jesu mittels eines nachträglich hinzugefügten
vergoldeten Lendenschurzes bedeckt. Bis heute ist es ein Wagnis, Christus
völlig unverhüllt und entblößt ins Szene zu setzen. Eine Schwäche dieses
grandiosen Kunstwerks ist, dass Michelangelo auf die Wundmale am
Auferstehungsleib verzichtet hat. Dieser völlig makellose Christusleib
steht darin im Widerspruch zum Evangelium, das immer hervorhebt: Der
auferweckte Herr ist nach Ostern gerade an seinen Wundmalen als der
gekreuzigte Jesus zu identifizieren. Auf ewig ist Jesus der mit fünf
Wundmalen Versehrte.
Ganz anders stellt uns der anonyme Maestro della Madonna della
Misericordia, vielleicht der Sohn Taddeo Gaddis (1290 bis 1366),
Giovanni Gaddi (1333-1383), den Auferstandenen vor Augen. Gaddis
berühmterer Vater war ein Schüler Giottos aus Florenz. Das Bild – die
Seitentafel eines Triptychons - befindet sich heute in der Pinakothek der
Vatikanischen Museen in Rom.
Christus tritt in Erscheinung, er tritt uns in den Weg. Wir sehen den
Geheimnisvollen stehend, barfüßig auf der flach auf dem Boden liegenden
Grabsteinplatte. Das Gemälde fällt auf, wegen seiner starken
Vordergründigkeit. Christus allein wird uns als Ganzfigur im
Bildvordergrund zentral präsentiert: Der Auferstandene als Sieger über
den Tod. Er steht vor einem Felsvorsprung, dem offenen Eingang in die
dunkle Grabhöhle. Er befindet sich in einem ansonsten menschenleeren
Ostergarten, üppig - mediterran mit Blumen, Früchten und einer Palme
bewachsen. Doch das Bild will keine Frühlingsgefühle wecken, denn
3
Ostern ist keine Frühlingsbagatelle. Hier geschah eine unfassbare und
unausdenkbare Zeitenwende. Das signalisiert dieses Bild: Der Himmel ist
golden. Ostern ist ein wie von Himmelslicht umflossenes Ereignis: es
blitzt auf der „Morgenglanz der Ewigkeit“.
Christus auf Augenhöhe. „Ich bin da!“ Unübersehbar. Wir nehmen
Christus in Augenschein, betrachten staunend das Unausdenkbare, „die
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2 Kor 4,6). In der Gestalt
dieses Einen ist Gottes Liebe unter uns anwesend. Ausschließlich die
Begegnung mit dem Auferstanden zählt! Er zeigt sich, er, der sagt: Ich
lebe! Ein leiser Sieg über den Tod, dieser Augenblick nach der
Auferstehung. Das etwas statische, unspektakuläre Bild erzählt nicht das
Osterereignis. Christus, der „neue Adam“ und „Erstling der
Entschlafenen“ (1 Kor 15,20-22), offenbart sich seltsam reglos und wirkt
überzeitlich angesichts des alles erschütternden, dramatischen
Ostergeheimnisses, das alles auf den Kopf stellt. Denn am Ostermorgen
ist dem Tod etwas passiert, endgültig. Leise setzt sich der österliche Sieger
in Szene und will uns nicht mit Macht überwältigen. Eigentlich sind die
Ostererzählungen des Evangeliums temporeich, ein Hin und Her, ein
Laufen und Weglaufen, ein Drehen und Wenden. Doch dieses Bild ist
langsam und macht uns langsam. Ein lautloser Triumph, keine
mitreißende Siegesmeldung, keine auftrumpfende Siegergeschichte nach
einem umwerfenden Siegeszug, kein Verklärungslicht, keine
lichtumflossene Gestalt, keine Auffahrt, kein Schweben, keine
Osterpredigt, kein dramatisches Duell mit dem Tod und seinen Wächtern,
keine segnende Geste des Auferstandenen. Der Salvator und Christus-
Victor – unbeweglich vor uns, in voller Lebensgröße, sehr kontrolliert,
von feierlicher Monumentalität, Strenge, Unberührbarkeit, Würde. Pure
Anwesenheit! Aber auch Fremdheit. Bist du es, Herr? Die Wahrheit tritt
mir gegenüber als Person! Der Auferstandene allein lässt sich sehen, er,
der zu guter Letzt auf uns zukommen wird. Das Bild lädt ein zur
Annäherung mit den Augen, nicht zur Berührung, nicht zu
überschwänglichem Osterjubel, sondern zu schweigendem Innehalten.
Dieser Auferstandene trägt mit der Rechten die weiße Siegesfahne, die
himmelwärts gerichtete Fahnenstange mit dem kleinen goldenen Kreuz
vor dem Goldhintergrund des Himmels. Dieses Kreuz ist nicht das
Marterinstrument vom Golgothafelsen, sondern die „crux invicta“, ein
Siegeszeichen., ein Prozessionskreuz. Solche Triumphzeichen kennt man
4
auch von anderen Osterbildern. Die Osterfahne, die wegen des roten
Kreuzes an eine Kreuzfahrerfahne erinnert, weht im Wind.
Auffallend: Christus erscheint in voller Stofflichkeit. Eine naheliegende
und doch ‚kinderschwere‘ Frage: Was trug der Auferstandene nach der
Auferweckung? Ich verbinde die Zeitenwende des Ostermorgens eher mit
einem Kleiderwechsel. Christus, der das Grabtuch zurücklässt und in die
weißen Gewänder der Verklärung wie in überirdisches Licht gehüllt ist.
Ungewöhnlich auf dem Gemälde ist das Gewand des österlichen Herrn.
Wer hat Christus, der nur in ein Leichentuch gehüllt war, so eingekleidet?
Michelangelo entscheidet sich für den nackten Jesus. Auf dem Gemälde
des anonymen Maestro della Misericordia ist er bekleidet, wenn auch
nicht gerade überirdisch; mit einem weißen Untergewand und einer mit
Goldsaum verzierten weißen Tunika mit ebenfalls golden umrandetem
blauen Umhang, vor dem Bauch gerafft. Ungewöhnlich, dass uns Christus
nach seiner Auferweckung nicht wie eine weiß-golden umhüllte
Lichtgestalt in Verklärungsglanz begegnet. Hier sehen wir ihn gehüllt in
Stoffe und Farben dieser Welt, die an einen vornehmen Herren oder
Hohepriester erinnern.
Dieser Auferweckte ist nicht im Aufstieg begriffen, er schwebt nicht, von
ihm geht keine Dynamik, kein strahlendes Leuchten aus. Er steht fest auf
dem Boden, mittig, zentral, und tritt barfüßig auf den Grabstein als
Symbol seiner Überlegenheit über den Tod. Dieser leise Ostersieger hat
zwar den Ausstieg aus dem Loch des Grabes hinter sich, zeigt sich als
Sieger über die Mächte des Todes; doch an seinem Körper finden sich
keine Spuren dieses Kampfessieges.
Wo sind die, denen er sich am Ostertag zeigte? Keine Engelsgestalt, keine
Osterzeuginnen und -zeugen begegnen ihm; keine Gegenspieler und
überwältigte Grabwächter sind zu sehen. Frontal steht er mir gegenüber.
Er geht uns alle an. Nur er allein, unübersehbar, das Bild beherrschend,
das Haupt von einem goldenen Scheibennimbus umgeben: Solus Christus.
Er steht in der vorderen Bildebene. Wir vor ihm. Niemand steht uns im
Weg. Wir können ihm nicht ausweichen. Uns wird der Auferstandene zum
Gegenüber. Wir bilden ihn uns nicht ein nach Art einer mystischen
Erfahrung. Uns kommt kein lächelnder oder triumphierender Christus
nahe. Seltsam nachdenklich ist sein Blick. Er schaut uns Betrachter nicht
an; beinahe demütig blickt er seitlich nach unten. Dieser Christus ist kein
Schmerzensmann mehr, auch wenn wir die nie heilenden Narben der
5
Wundmale an seinen Händen sehen; auch der blutige Ort der Seitenwunde
(rechts!) auf dem weißen Gewand ist, mit einer goldenen Raute
hervorgehoben, erkennbar - ein deutlicher Hinweis auf das durchbohrte
heiligste Herz Jesu. Vor uns steht der, der den Tod hinter sich ließ, der als
Lebendiger aus der Welt Gottes zu uns tritt.
Eine atemlose Kirche, die in ihren Reformversuchen angestrengt an ihrer
Zukunftsgestalt arbeitet, darf zu Ostern vor dem zur Ruhe kommen, dem
sie sich verdankt. Er schenkt einer vergesslichen Kirche ein „unverhofftes
Wiedersehen“. Suchen wir sein Angesicht! Schauen wir nicht weg von
dem, dem wir Leben, Gegenwart und Zukunft verdanken. Niemand sonst
kommt näher an uns heran als Er. Seit Ostern ist er uns der Allernächste.
Halten wir seine unentrinnbare Nähe, dieses Bleiben vor ihm aus! Ihn
können wir nicht vereinnahmen. Ostern feiern wir ein unausdenkbares
Geheimnis. Ahnen wir, dass unsere Existenz und Zukunft am seidenen
Faden der Wahrheit dieses Festes hängt? Ist Christus für mich der
Unverhoffte, Unvorhersehbare, Ehrfurcht Gebietende, Staunenswerte?
„Unwahrscheinlicher als Jesus Christus ist nichts“, sagte der Schriftsteller
Botho Strauß. Er, der Unwahrscheinlichste von der Welt, verspricht seine
Anwesenheit: „Ich bin mit euch durch das All der Tage bis zum Voll-Ende
der Weltzeit“ (Mt 28,20, übersetzt von Fridolin Stier). Eine Kirche, die
Zukunft hat, muss Christi Gegenüber bleiben und Ihn, den Erstaunlichsten
von allem, aushalten. Er bleibt mein leiser Zeitgenosse und bittet um
unsere Aufmerksamkeit. Und wenn ich vor ihm stehe, dann bleibt mir nur:
Erschütterung pur! Und die Hoffnung, dass er deinen und meinen Namen
nennt und uns zu sich bittet. Was für eine dichte Präsenz! Welche
beeindruckende Gestaltgröße dieser „Hauptperson“ des Glaubens. In
solcher Nahsicht erfüllt er unser Anschauungsbedürfnis. Ostern heißt
Pascha, Pasqua, Vorübergang. Seit Ostern läuft Christus frei herum durch
Raum und Zeit. Er ist nicht zu halten und sprengt den Rahmen jedes Bildes.
Halten wir inne vor diesem Bild: Es ist, als bliebe der Vorübergehende
einen Augenblick stehen – und wir setzen uns seiner Anziehungskraft aus.
Der österliche Herr macht die Kirche zu dem, was sie ist: zur Gemeinde
des Auferstandenen. Eine Kirche, die sich an Christus vorbei neu gestalten
will, wäre eine fromme Nichtregierungsorganisation, ein trauriger Jesus-
Gedächtnisverein. Die Christusvergessenheit in der Kirche wäre eine
tödliche Krankheit des Glaubens. Ostern bilden wir uns nicht ein. Ostern
können wir nicht irgendwie symbolisch verstehen, als lebe er in uns weiter,
6
wenn wir nur brav und fromm an ihn glauben und in seinem Geiste
handeln. Ohne Ihn wäre alles nichts. Er selbst bringt sich zur Erscheinung.
Uns wird ein „unverhofftes Wiedersehen“ mit dem geschenkt, der auf dem
Weg zum Vater ist.
„Viel mehr als Ziele braucht man vor sich, um leben zu können, ein
Gesicht“, sagte der jüdische Schriftsteller Elias Canetti. Diesem
lebenspendenden Antlitz Christi wollen wir begegnen.
Ihnen und Euch ein frohes Osterfest!
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Gottesdienstordnun
Gottes Wahlkampf um meine Stimme geht weiter
Gedanken zur Fastenzeit
und zum Fest der „Verkündigung des Herrn“ am 25. März.
Liebe Mitchristen!
Die Bundestagswahl ist gelaufen. Eine Entscheidung stand an, auch eine
Unter-Scheidung. Es ging um die Macht, um zeitlich verliehene Macht.
Und jetzt müssen die Gewählten schauen, was sie aus diesem
Vertrauensvotum des Volkes machen.
Vieles im Leben steht nicht zur Wahl: Wo und wann und in welcher
Familie ich geboren werde, was ich an Eigenschaften mitbringe, ob ich
groß oder kleinwüchsig bin. So vieles in unserem Leben ist vorgegeben,
steht nicht zur freien Wahl.
Anderes steht zur Wahl. Die Fasten- und Passionszeit ist Gottes
alljährlicher Wahlkampf um meine Stimme. Es ist eine Lebenswahl, ob
wir Christen sind und bleiben wollen. Wir glauben, dass Gott Dich und
mich wählt. Uns traf Gottes Gnadenwahl, seine Vorentscheidung.
An jedem Sonntag ist Wahlsonntag. Sehr entschieden treffen die, die sich
auf den Weg machen in unsere Kirchen – eine Wahlentscheidung, wie in
einem Wahllokal. Wir treffen eine sehr intime, geheime Wahl, denn wie
es in uns aussieht, geht niemanden etwas an. Gott allein weiß um mein
Persongeheimnis, er respektiert mein Wahlgeheimnis. Die Freiheit der
Christenmenschen, von der Luther spricht, zeigt sich hier: Wir haben die
freie Wahl, in das Wahllokal eines Gotteshauses zu treten und Gott
unsere Stimme zu schenken. Man kann sich anders entscheiden. Wir
hätten auch andere Möglichkeiten in dieser Freizeitgesellschaft. Indem
wir uns Gott stellen, stellen wir uns buchstäblich demonstrativ zur Wahl.
Sie geben Ihr unüberhörbares Votum ab: Hier bin ich. Ich wähle dich -
und zugleich: Ich nehme, Gott, Deine Wahl an.
Wir feiern, dass zwei wählen, der erwählende Gott und jeder Einzelne
von uns. Ich gebe ihm mein Stimme, mein Vertrauen. Es ist das 'aktive
Wahlrecht' Gottes, dass er sich für uns entscheidet, dass er nicht ohne
uns wirken will. Nicht ohne uns! Es gibt uns als Kirche nur, weil der Herr
es nicht allein machen will, weil er auf Stimmensuche ist. Er betreibt
keinen Stimmenfang und befürwortet Gewaltenteilung. Es ist das
'passive Wahlrecht' jedes Getauften, dass wir einstimmen, uns diese
Wahl gefallen lassen. Ein solches Votum ist mehr als eine sogenannte
Jahrhundertwahl oder eine Richtungswahl. Wir fällen eine Lebenswahl.
3
Wähler und Wählerinnen sind, hochgerechnet, am Wahltag kaum drei
Minuten im Wahllokal. Das Schöne an jedem Sonntag ist, dass wir spüren:
hier trifft Gemeinde nicht kurzzeitig eine Wahl; sie tut es nicht unüberlegt,
aus einer Laune heraus oder im Vorbeigehen. Wir schenken Gott eine
Stunde Lebenszeit. Wir wollen als Christenmenschen mit einer
getroffenen Wahl leben und treue Stammwähler bleiben, also ein Leben
lang unser Kreuz beim Kreuz machen.
Christus führt unser ganzes Leben lang Wahlkampf um meine und Deine
Stimme. Wir sehen den Sohn des allmächtigen Gottes auf
Kandidatensuche auf den Straßen und Plätzen Galiläas; er war auf
Kandidatensuche. Und er wählte Menschen zu Menschenfischern, die
gar nicht gewählt werden wollten, die vielleicht gar nicht das mitbrachten,
was er von ihnen erwartete, denen er doch Großes zutraute. Was für ein
Satz, dieses: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt!“ (Joh. 15.16). Er trat an den Arbeitsplatz des Fischers am See
von Tiberias, in die zwielichtige Wechselstube des Zöllners Matthäus, er
stellte sich dem Saulus in den Weg - und erwählte vor allem die Frau, die
uns als „schmerzhafte Mutter von Heimbach“ besonders naherückt. Er
‚braucht‘ Maria. Man stelle sich also vor: Der allmächtige Gott ist ein
ewiger Wahlkämpfer. Alle sollen Stimmrecht haben im Reich Gottes,
auch die, denen man hier die Stimme nimmt, das Gesicht raubt, die sonst
nicht zu Wort kommen; auch die, die in der allmählich zerbröselnden
Volkskirche keinen Ort mehr finden. Was für ein mühsames göttliches
Klinkenputzen an der Tür meines Herzens! Geduldig wartet er – vierzig
Tage und mehr - auf den Ausgang meiner freien und geheimen Wahl.
Verkündigung des Herrn: Am 25. März feiern wir das Fest der
Menschwerdung Gottes. Dieses Wunder ereignet sich im Wahllokal von
Nazareth. Es gehört zur selbstgewählten Schwäche Gottes, dass er nur
bittend und darin wunderbar unaufdringlich und schonend auf Maria
zukommt. Der Engel klopft bei ihr an: Der Himmel bittet um Deine Stimme!
Gott bittet um Dein Ja-Wort! „Die Erde und der Himmel erwarten Dein Ja,
o allerseligste Jungfrau Maria“, so predigte der hl. Bernhard von
Clairvaux. Alle Welt, Maria, wartet auf Dein Votum! Die Welt wartet, dass
dieses Mädchen beim Richtigen ankreuzt. Gott ist in Erwartung eines
Wahlausgangs, eines ungezwungenen Ja-Wortes. Maria, lass Dich
wählen, wage den Sprung und wähle den Dich auswählenden Gott.
In der Fastenzeit wird Gottes Klopfen bei mir laut: Er wirbt: Kreuzt an
beim Gekreuzigten! Und damit wählen wir als Getaufte auch einen ganz
bestimmten Lebensstil. In den kleinen Wahlentscheidungen des Alltags
zeigt sich die große Lebenswahl: Wofür setze ich mich ein, meine ganze
Leidenschaft, meine Zeit und Energie? Was ist mir wirklich wichtig und
woran hängt mein Herz? Wie lebe ich, und kann man ablesen, wen ich
gewählt habe? Welche Freunde wähle ich? Was suche ich in all meinem
haupt- und ehrenamtlichen Tun? Such ich IHN? Und – man kann es nicht
verschweigen: Wenn wir wählen, wählen wir auch eine ganz bestimmte
Kirche, mit ihrer auch zweideutigen Geschichte, mit ihren Runzeln und
Rissen, ihrer Schuld und Unansehnlichkeit.
„Ich wähle alles!“, sagte die hl. Therese von Lisieux und ging aufs Ganze.
Das ist keine religiöse Unersättlichkeit und Überspanntheit. Die junge
Frau sagte wie Maria im ‚Wahllokal‘ von Nazareth: Ich wähle den, der
mich wählt. Ich setze alles auf Seine Karte. Gott braucht meine und Deine
Stimme. Gott bittet! Wir haben die Wahl! Nehmen wir seine Wahl an!
Diesen Mut zur Wahl nach dem Wahlmonat wünsche ich mir, Ihnen und
Euch.
Ihr Kurt Josef Wecker, Pfr
Fest der Darstellung des Herrn (Meister der Pollinger Tafeln 1444)
Der „Simeon-Moment“ für einen jungen Alten -
Du da! Nimm ihn! Halte Jesu für einen Augenblick fest!
Bildbetrachtung zu Lichtmess von Kurt Josef Wecker
Du da – halt mal! Ereilt uns auch irgendwann einmal dieser „Simeon“-Moment? Ein spätes Weihnachten?
Anfang Februar feiern wir ein Fest in spätweihnachtlichem Kerzenschein, an dem ein zunächst fremder Mensch unerwartet Jesus in die Hand nehmen darf. Maria übergibt ihr Ein und Alles für einen gewissen seligen Augenblick einem Fremden. Diese Geste Marias im Tempel vierzig Tage nach dem Geburtstag Jesu geschah nicht hastig und aus der Not geboren, sondern bewusst. Sie tat dies, nachdem sie ihr Reinigungsopfer am Tempel dargebracht hatte, den erstgeborenen Jesus zunächst einem namenlosen Priester 'dargereicht‘ hatte und darin ihr Kind Gott 'dargestellt' hatte. Danach zeigte sie das Kind einem alten Mann und einer alten Frau. Sie übergab dem Simeon den 40 Tage jungen Jesus wie eine Weihnachtsleihgabe. Die junge Familie kam unauffällig, ohne Engelschöre und Heiligenschein - vielleicht schon aus dem fernen Nazareth und nicht mehr dem nahen Bethlehem - nach Jerusalem. Wie auf Zehenspitzen betritt das Geheimnis des Glaubens den Tempel. Niemand ahnte etwas von dieser verborgenen Fronleichnamsprozession der Heiligen Familie nach Jerusalem. Auf einen solchen Tempelgang begaben sich viele junge Familien und Pilger und erfüllten das Gesetz des Mose (vgl. Gal 4,4). Maria und Josef reihen sich ein in das Übliche, sie wollen keine Ausnahme sein, diese beiden Juden unterstellen sich und Jesus der Thora. Die Tafeln des Gesetzes bilden das Zentrum dieser Darstellung des „Meisters der Pollinger Tafeln“ (1444), einem spätgotischen Marienaltar, der heute in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt ist. Die Begegnung der jungen Eltern mit dem alten Mann (leider fehlt auf dem Gemälde die alte Frau Hanna) geschieht wie in einer gotischen Kirche des Spätmittelalters. Nur eine kleine Episode, von dem sonst niemand (außer Lukas, der Evangelist) Kenntnis nimmt. Noch einmal Epiphanie, Lichterfest, Lichtmess. Auffallend jedoch ist: Christus - er ist ein vierzig Tage junges Baby - steht unsicher, von der Mutter gestützt und ängstlich auf Maria blickend auf dem Opferaltar. Das Kind ist unbekleidet, die ‚nackte Wahrheit‘, während die anderen Gestalten in prächtigen Gewändern mit imposantem Faltenwurf dargestellt werden. Jesus, nackt und bloß wie in der Krippe, bei der Taufe im Jordan, am Kreuz! Josef, die Randfigur, trägt das ‚Arme-Leute-Opfer‘, zwei Tauben in das Heiligtum.
Maria, die „Monstranz Gottes“, lässt Jesus los, reicht ihn, schiebt ihn sanft Simeon hinüber; das in vielen Liedern besungene und in der Heimbacher Pietà uns vor Augen gestellte, bis in den Tod durchgehaltene untrennbare Miteinander von 'Jesus und Maria' wird für einige Augenblicke gelöst. Schwer fällt es Eltern, ihr Kind irgendwann einmal loszulassen. Im Binnenraum der Familie soll es trotz aller beruflichen Flexibilität so lange wie möglich geborgen sein. Oft bleibt eine verborgene Nabelschnur, die Heranwachsende bindet und hindert, ihr eigenes Leben zu führen. Gerade auf den Erstgeborenen, den 'Thronfolger', sind große Hoffnungen gerichtet. „Helikoptereltern“ lassen ihr Kind nur schweren Herzens ausziehen, in die weite Welt, hinein in den Ernst des Lebens.
Freilich: junge Eltern legen gerne das Neugeborene in die Arme der Großeltern oder Paten, bei der Taufe auch zum Foto in die Arme des Priesters oder Diakons. Sie erleben bewegt, wie sich der Gesichtsausdruck der Älteren ändert, wie ein beinahe verlegenes Lächeln über manchmal verkniffene Mienen geht, wie alte Augen jung werden und zu leuchten beginnen. Sie leuchten, weil sie im Kind der Zukunft ins Auge sehen. Sie ahnen, dieses Kind wird etwas erleben, gestalten und erdulden, auch wenn wir Älteren nicht mehr auf Erden sind.
Heute also wird Jesus der Welt präsentiert. Es ist, als würde Marias Gebärdensprache sagen: Er, den ich zur Welt brachte, ist für alle Welt da, besonders für sein eigenes Volk Israel, mit dem er heute Begegnung feiert. Simeon ist zwar ein völlig fremder, aber eben doch wesensverwandter Mensch mit adventlichem Durchhaltevermögen. Einer, der sein alterndes Leben diesem ‚neuen Adam‘ entgegenhält und dabei ein „junger Alter“ bleibt. Einer, der es noch nicht satt ist, sondern erwartungsvoll leere Hände dem Christuskind entgegenhält. „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr!“ Einer, der die Nerven und den Glauben hat, auf – Gott zu warten! Einer, der mich 40 Tage nach Weihnachten fragt, ob ich vor Gott noch ein Wartender bin oder ob mir das alle Jahre wieder gefeierte Weihnachtsgeheimnis längst schon überdrüssig geworden ist … Maria ist 'nur' Kommunionhelferin. Nimm ihn! Gott für dich! Maria überreicht Ihn den Repräsentanten des Volkes, in dem noch heute viele messianisch Geprägte auf diesen Messias warten.
Der Jude Franz Kafka sagt es so: „Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch jeden Augenblick ihrer würdig sein.“ Simeon wartet auf Erlösung, auf die Begegnung mit dem Heißersehnten. Er steht für eine Kirche, die nicht in Selbstdarstellung aufgeht und der es nicht um ihren Selbsterhalt und ihre erfolgversprechenden Strukturen geht. Simeon hat es nicht nötig, sich selbst eitel zu präsentieren. Selbstvergessen ist er rechtzeitig zur Stelle. Er ist „voll präsent“.
Und Marias Geste verdeutlicht: Jesus Christus ist nicht mein Privatgott, mein Familien- und Stammesgott, mein Gemeinde- und Kirchengott, er ist eine ‚öffentliche Person‘ und gehört aller Welt, ist unübersehbares Licht zur Erleuchtung aller Welt, Licht für uns Heidenchristen. Er ist „der Heiden Heiland“. Niemals geht Jesus in den Besitz frommer Familien und geistlicher Bewegungen, nie in den Besitz der Kirche und ihrer Dogmen über. Kirche ist dazu da, ihn nicht eifersüchtig für sich zu behalten, sondern wie Maria loszulassen, ihn anderen zu gönnen. Maria versteht das und gibt ihn frei und gönnt dem alten Mann einen ‚glückseligen‘ Moment.
Ich vergleiche Simeon und Hanna mit zwei sympathischen Wochentags-Kirchengängern. Sie haben die Ruhe weg. Sie gehören nicht zu denen, die meinen: wir haben irgendetwas verpasst, wenn wir nicht überall dabei sind. Ich weiß, wie viele ältere Menschen irritiert sind vom gegenwärtigen Zustand der Kirche. Sie haben ihr Leben lang ihr Vertrauen in diese Institution gesetzt, die viele Menschen enttäuscht und verletzt hat. Auch viele ältere Christen sagen heute: Es geht auch ohne Kirche und Kirchgang. Wie viel stumpfe Hoffnungslosigkeit in manchen Altenheimen, wie viel zynische Resignation auch bei jungen Menschen, die nichts mehr von Gott erwarten und früh mit ihrem Leben abschließen!
Anfang Februar feiern wir zwei Menschen, deren Advent erst spät in Erfüllung, in die schöne Bescherung eines „Simeon-Moments“, einer „Hannah-Stunde“ übergeht. Ich wünsche Ihnen und Euch 2025 diese Augenblicke der Gewissheit, des Entgegenkommens, des späten Glücks. Augenblicke, in denen wir vielleicht ganz unerwartet zu Christus-Trägern, zu Christophoroi, zu Monstranzen werden. Christinnen und Christen sind keine 'Macher' und Selbstdarsteller, sondern geduldig Wartende und glückliche Empfänger. Da kann es geschehen, dass wir mitten im Alltag Lichtmess feiern.
Darstellung des Herrn - das ist nicht der große Auftritt eines Stars, sondern die Entdeckung der ungewöhnlichen Gottesnähe und der nackten Wahrheit der Gottesliebe im Gewöhnlichen und Normalen. Auch uns, unseren Händen, wird Er anvertraut. Dieser Moment ist für Erstkommunionkinder etwas Aufregendes. Zu Recht. Ein leises Geschenk, zeitlich betrachtet nur ein flüchtiger Augenblick und keine laute Aktion. Gott überlässt sich uns und will nicht von uns lassen. Meine Hände dürfen ihn anfassen (1 Joh 1,1). Lassen wir den Weihnachtsglanz nicht zu schnell verglimmen, lassen wir diese Begegnung nicht einfach hinter uns.
Ich wünsche Ihnen und Euch, Jungen und Alten, solche Lichtsekunden in 2025.
Kurt Josef Wecker
Die Geburt des Lichtes
Bildbetrachtung zur Weihnacht 2024 von Kurt Josef Wecker.
Peter Paul Rubens, Weihnachtsbild
So viele Finsternisse in der Welt! Wir sehnen uns nach Lichtblicken. Zur Weihnacht möchten wir umleuchtet sein, und wir wollen glauben, dass das wahr ist, was wir feiern: dass dieser Welt ein unauslöschliches Licht aufgegangen ist, ein Hoffnungslicht gegen die Irrlichter und grellen Spots, gegen die selbsternannten Lichtfiguren und schnell vergessenen ‚Stars‘, die tödlichen Lichtblitze der Raketen und Bomben. Weihnachten 2024 feiern wir in einer bedrohten Gegenwart, im Osten Europas, im Nahen Osten. So viel Dunkelheit, erloschene und zerstörte Welt! Zappenduster ist es - oder viel schöner Schein. Wir werden, 80 Jahre nach der Zerstörung so vieler Städte im Bombenkrieg an das Dunkel des 2. Weltkriegs erinnert; an die Markierungspunkte über unseren Städten in den Kriegsnächten bei den Bombenangriffen, die man schauerlicher weise „Christbäume“ nannte. Wir brauchen mehr Licht, ein Licht, das der ewigen Nacht seinen Schrecken nimmt und uns erleuchtet und zu Erleuchteten verwandelt: „Licht war. Rettung“ , so Paul Celan im Gedicht „Einmal“.
„Und es ward Licht!“ Wir feiern Weihnachten den Advent des Lichtes. Ein Licht wird uns geschenkt, das Wunder eines wie von selbst leuchtenden Kindes in der Nacht. Der katholische Barockmaler Peter Paul Rubens (1577-1640) bringt uns in die Nähe dieser menschgewordenen Lichtquelle Gottes: Gottes Krippenspiel mit Licht und Dunkel. Setzen wir uns diesem stillen Bild aus!
„Es gibt nur eine Methode, um Bilder zu verstehen – nicht versuchen, sie zu interpretieren, sondern sie so lange anschauen, bis das Licht hervorbricht“, sagte die französische Philosophin Simone Weil. Wagen wir trotzdem behutsam den Weg der Bildinterpretation und warten wir, bis das Licht hervorbricht.
Vermutlich am Ende seines römischen Aufenthaltes (1602,1606-1608), kurz vor seiner Rückkehr nach Antwerpen zu seiner kranken Mutter im Oktober 1608, vollendete Rubens dieses Gemälde im Juni 1608. Rubens‘ Nachtstück war als Altarbild für die Cappella Constantini in der Oratorianerkirche des hl. Filippo Neri in Fermo in der italienischen Region Marken bestimmt und hängt heute noch in dieser Stadt in der Pinakothek. Rubens war nie in Fermo gewesen. Doch dieses in Rom geschaffene Christnachtbild gefiel dem Maler so gut, dass es eine eigenhändige Replik gibt, die man heute in der Sint-Paulskerk in Antwerpen findet, außerdem eine Modellskizze in der Eremitage in St. Petersburg und eine Pinselstudie in Amsterdam. Man nennt diese Hirtenanbetung „Die Nacht“, „La Notte“. Wir sehen nur einen Bildausschnitt aus diesem Altarbild, das erst später ein Galeriebild wurde; die gleichzeitig über der Personengruppe schwebenden Putti in ihrer virtuosen Bewegung fehlen leider.
Ein leises Bild. Wir bleiben ‚unten‘ in der irdischen Sphäre und nehmen teil am nächtlichen Besuch der Hirten am Geburtsort Jesu, der seltsam unbestimmt bleibt. Sind wir zur mitternächtlichen Stunde draußen im Freien oder in einer lichterfüllten Erdhöhle? Rubens verzichtet auf jegliches Dekor: Ein Kunstwerk ohne pompöse „barocke Leidenschaft“. Mein Blick wird auf die Bildmitte fokussiert, dorthin, wo das Licht der Welt (Joh 8,12; Joh 9,5) das Licht dieser Welt erblickt. So viel liegt im Dunkel der Nacht. Im Dunkeln geschieht das Neue. Die Bühne des Geheimnisses bleibt undefiniert. Der Bildraum ist eng. Sechs Menschen rücken dicht zueinander, bilden einen Halbkreis um das Gotteskind. Allein aufgrund der lukanischen Notiz, dass die Hirten Nachwache hielten bei ihren Herden (Lk 2,8), wissen wir, dass die Geburt Jesu nachts stattfand. Sein Kommen schafft die „Heilige Nacht“, die wahre „Zeitenwende“. Die Weih-Nacht ist nicht allein zum Schlafen da!
Rubens versteht es, den Stimmungswert der Nacht und das Spiel mit den expressiven Lichteffekten voll auszuschöpfen. Ohne das überirdische Licht wäre die Szenerie in absolutes Dunkel getaucht. Wer die sinnenfreudige Wucht sonstiger Gemälde des Barockkünstlers kennt, ist von der gefühlsbetonten Innigkeit dieses lichtmystischen ‚Nachtstücks‘ und der lautlosen Welt, die Rubens schafft, beeindruckt. Liebevolle Andacht. Auch ein Genie wie Rubens hatte Vorbilder und brauchte Anstöße von außen. Vor allem Correggio (Antonio Allegri) und seine damals in der Stadt Reggio Emilia von Rubens studierte und heute in Dresden hängende „Heilige Nacht“. Correggio inspirierte den Flamen. Vielleicht ist diese Bildschöpfung auch eine Reverenz Rubens‘ vor dem großen italienischen Kollegen Caravaggio und vor dessen Kunst des „Chiaroscuro“-Effekts, des magischen Helldunkels. Das deutsche Wort „Stimmung“ fällt mir ein, diese einzigartige Stimmung, in die uns die Nacht des Heiles hineinversetzt. Diese Nacht hat nichts Finsteres.
Ja, Gott lässt in dieser Nacht die Dunkelheit und das Licht Regie führen. Es gibt nur eine einzige Beleuchtungsquelle. Kunstwissenschaftler sprechen vom „sakralen Leuchtlicht“ (Wolfgang Schöne). Es gibt keine sekundäre, natürliche Lichtquelle (Mond oder Stern, Abend- oder Morgenrot), kein „künstliches“ Licht (wie z.B. eine brennende Kerze, Laterne oder ein Feuer). „Ein unvergleichliches Licht ging von ihm aus, ein solcher Glanz, dass man ihn nicht einmal mit der Sonne vergleichen konnte“, so bezeugt die heilige Mystikerin Birgitta von Schweden (1303-1373) in ihren „Revelationes“ (Kap 7,21; 1372) diesen Augenblick. Ihren Visionen verdankt die Kunstgeschichte wohl die Darstellung der nächtlichen Geburt Jesu und der Nacktheit des Kindes. Im Jahre 1606 erschien in Rom eine lateinische Übersetzung der ‚Offenbarungen‘ der hl. Birgitta, und Rubens ließ sich vermutlich von diesen inspirieren. Christus ist wie eine mystische zweite Sonne, „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ (Lk 1,78f) die „Sonne der Gerechtigkeit“ (Mal 3,20), die wahre „unbesiegbare Sonne“. „Er leuchtet wie die das Licht der Sonne, ein Kranz von Strahlen umgibt ihn.“ (Hab 3,4). „Ich bin das Licht der Welt“, wird der erwachsene Jesus später sagen (Joh 8,12). Wie anders als mit der Darstellung des „lumen divinum“, des übernatürlichen Lichtglanzes (Lk 1,78f) kann man dem Einbruch des Überirdischen und dem heiligen Augenblick der Geburtsoffenbarung Ausdruck verleihen? Keine Zugluft bedroht dieses intensive sakrale Licht. Keine Person leuchtet aus sich selbst. Die Gestalten sind unterschiedlich stark beleuchtet und blieben (wie der hl. Josef) im Schatten, würden sie nicht vom Kind angestrahlt. Wir leben im Widerschein dieses Einen. Die Menschwerdung Gottes ist das „Unwahrscheinlichste von der Welt“, so unwahrscheinlich, dass von einem ‚gewöhnlichen‘ Kind übernatürlicher Glanz ausgeht und die Welt verwandelt.
Rubens konzentriert sich in seiner Altarmalerei auf das Wesentliche dieser Nachtszene; kein Landschaftsausblick; selbst Ochs und Esel fehlen. Wir sind auf Nahsicht, eingeladen zur sanften Annäherung. Maria steht am rechten Bildrand, dahinter – kaum im Dunkeln sichtbar – Josef, der mit vor der Brust devot gekreuzten Armen nach oben zu den Engeln blickt. Niemand steht dem Kind im Weg und niemand berührt es; es ist uns Betrachtern zugewandt; wir sind ‚auf Augenhöhe‘ mit ihm. Das von einem weißen Tuch hinterfangene Kind – wer denkt angesichts dieser ‚Hirtenmesse‘ nicht an die Hostie, die Eucharistie auf dem weißen Altartuch in der Messfeier - wird von Maria präsentiert, so als zeige sie das Kind, als zöge ihre linke Hand mit dem Schleier den Zipfel des Vorhangs vor dem (schlafenden) Geheimnis fort und packte sie sanft Gottes Weihnachtsgeschenk aus. Nichts Eigenmächtiges geht von ihr aus. Sie öffnet uns den Zugang zum Mysterium dieser Nacht; sie ist, wie ein Kirchenvater sagte, „die Mutter der herrlichen Sonne“.
Auch die Kirche findet sich wieder in dieser Mariengeste; sie kann nie mehr sein als Einweiserin in das Geheimnis der Selbstverkleinerung Gottes, als Zeugin der nackten Wahrheit Gottes in diesem Kind. IHM schenkt sie ihre Aufmerksamkeit. Sie lässt das Wunder geschehen, feiert SEINE Gegenwart. Scheu und überwältigt umgibt sie IHN, sie bezieht ihr Licht von anderswoher, vom LUMEN Christi.
Die Mutter Gottes trägt ein rotes Kleid und einen blauen Umhang. Aus dem Gemälde spricht die tiefe Marienfrömmigkeit Rubens‘. Maria steht, sie kniet nicht; von der Lichtquelle ist sie am stärksten getroffen und bedarf keines Heiligenscheines. Ihr Inkarnat ist strahlend weiß. So wie Gott sein dem Menschen zugewandtes Antlitz in der Heiligen Nacht offenbart, so vermittelt Maria uns den Corpus Christi, eröffnet sie uns mit der zarten Geste der Entschleierung Jesu das Kraftfeld des Heiligen, den glühenden Kern des Glaubens: „Seht!“ (1 Joh 3,1) Seht das Geheimnis des Glaubens! Dieser unbewegliche Neugeborene ist – wahrer Mensch und wahrer Gott, wie wir im Dogma von Nizäa (325) und von Chalzedon (451) bekennen. 2025 erinnern wir Christen uns daran, dass das Bekenntnis zum Paradox des Gottmenschen „Sohn Gottes, wesensgleich dem Vater“ vor 1700 Jahren im kleinasiatischen Nizäa formuliert wurde. Die Nacktheit des Kindes zeigt: Es ist der „neue Adam“ (1 Kor 15,20-22). Jesus ist trotz seines Selbstleuchtens kein Sonnen- oder Lichtgott.
Eigentlich braucht das Intime keine Zuschauer. Aber Christi Geburt ist ein ‚öffentliches Ereignis‘. Erste Zeuginnen und Zeugen, Christusverehrer und Anbeterinnen sind Hirten und Hirtinnen. Rubens malt sie als rustikale, lebensechte Figuren. Dieses Licht-Kind zieht sie an. Ihre Resonanz beim Krippenbesuch wird im Evangelium gar nicht beschrieben (vgl. Lk 2,16f), doch Rubens fühlt sich in diese späten Gäste beim Kind ein, zeigt die verschiedenen Reaktionen des Glaubens und die seelischen Affekte der Beteiligten. Er malt, wie sie den Anblick dieser göttlichen Klarheit, verborgen im Kind, nicht fassen können und demütig und liebevoll, andächtig und auch ein wenig scheu „das Bündel Gottes“ (Paul Konrad Kurz) umgeben. Eben noch haben die Hirten plötzlich den von himmlischem Licht umstrahlten Botenengel gesehen: „Herrlichkeit des Herrn strahlte rings um sie auf“ (Lk 2,9; vgl. Jes 60,1). Gerade noch „eilten“ die neugierigen Hirten und Hirtinnen; und nun sind sie angekommen, staunend, fassungslos, betroffen und geblendet vor dem Geheimnis, dem Ruhepol des Bildes. Eng geschart finden sich diese nächtlichen Besucher ein im Kegel eines Lichtes, das sich auf sie in abgestufter und abgeschwächter Weise mitteilt (Joh 1,9) und Licht-Schatten-Kontraste bewirkt. „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht“ (Jes 9,1). Schützend und voller Ergriffenheit umgeben diese ‚Alltagsmenschen‘ das Gotteswunder. Hochaufgerichtet und ausdrucksstark steht ein Hirte, gestützt auf einen Stab, gegenüber der Heiligen Familie, geblendet vom „selbstleuchtenden Christuskind“ (Wolfgang Schöne). Ein Moment der Bewegung, beinahe des sanften Erschreckens: Mit seinem Handrücken schirmt er seine Augen schützend ab angesichts der Blendung durch diese ‚nackte Wahrheit‘, den ‚Splendor divinus‘, den göttlichen Glanz auf dem lichtspendenden Corpus Christi; ein Glanz, der die Verklärung Christi vorwegnimmt (Lk 9,32). Blendung und Erleuchtung zugleich! Der jüngere Hirt blickt erstaunt zum Älteren empor. Mit ihren nackten Beinen und Füßen erinnern diese nächtlichen unerwarteten Gäste an Moses vor dem brennenden Dornbusch (Ex 3,5). Sie geraten vor das Gottgeheimnis, betreten heiligen Boden. ER ist da - für uns! „Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm.“ (1 Joh 1,5). Eine ältere Hirtin kniet oder sitzt nahe beim Kind, eine weitere Hirtin tritt aus dem Hintergrund und lächelt das Kind an.
Bei aller Vermenschlichung auf diesem Altarbild – hier offenbart sich der Sohn Gottes, hier geschieht Epiphanie des Fleischgewordenen, hier liegt der Dreh- und Angelpunkt der Welt in unserem Augen-Blick. Gott lichtet sich und „gibt der Welt ein‘ neuen Schein“ (Martin Luther in GL 252,4). Die Hirten erkennen die Göttlichkeit des Neugeborenen und wir folgen ihrem anbetenden Blick, ihrer großen Freude. „Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen.“ (Paul Gerhardt in GL 256,4).
Ich wünsche uns, dass Weihnachten mehr ist als ein vorübergehender Lichtblick. Werden wir „Pilger der Hoffnung“ (so das Motto des am Weihnachtsabend eröffneten Heiligen Jahres), treten wir mit Hirtenaugen in dieses Bild hinein. Lassen wir uns erfassen von der Stille des Heiligen. Jesus, wir begreifen dich nicht! Doch auf unseren Gesichtern liegt Sein Glanz (vgl. 2 Kor 3,18). Hoffentlich geht uns das Staunen nicht verloren. Hoffentlich bleiben wir bei Troste, dass dieses göttliche Licht nie aufgehört hat, in die Finsternis dieser Welt hineinzuleuchten.
Eine von diesem Hoffnungslicht erleuchtete Weihnacht und ein friedliches 2025!
Kurt Josef Wecker
Das Heilige Jahr – Zur Geschichte der „Jubeljahre“
(Kurt Josef Wecker)
Nicht „alle Jahre wieder“, sondern nur „alle Jubeljahre“ gibt es ein vom Papst ausgerufenes
„Heiliges Jahr“. Ja, ein heiliges Jahr „kommt nur alle Jubeljahre vor“; ein seltenes Ereignis, das
wir in unserem Leben zwei-, höchstens dreimal erleben können und welches der
Kirchengeschichte einen eigentümlichen Rhythmus und eine verlässliche Periodizität gibt.
Angesichts eines solchen besonderen Jahres spüren wir, dass die Zeit etwas kostbares, ja etwas
Heiliges ist, dass sie Höhepunkte und Wendepunkte und Übergänge kennt. Die Juden haben
den Sabbat, wir Christen den Sonntag, die Kirchenfest und eben - das Heilige Jahr. Mit seiner
- durch die Verkündigungsbulle „Spes non confundit“ (vgl. Röm 5,5) am Fest Christi
Himmelfahrt 2024 ergangenen - Einladung machte Papst Franziskus eine Zeitansage: „Die
Hoffnung enttäuscht nicht!“. Damit ruft er erneut ein ‚Gnadenjahr’ (Lk 4,18) aus: ‚Jetzt sind
Tage des Heils‘ (2 Kor 6,2). ‚Jetzt ist die Zeit und die Stunde‘ zur Umkehr.
Jedes Heilige Jahr hat ein bestimmtes Motto und konzentriert uns auf ein bestimmtes Thema,
diesmal die göttliche Tugend der Hoffnung. Das kommende Jahr steht unter dem schönen
Leitwort „Pilger der Hoffnung“ (Peregrinantes in spem).
Der Papst lädt uns nach Rom ein, damit wir tastend und bittend durch offene Pforten treten, im
kurzen Verharren auf der Schwelle innehalten und im Durchschreiten dieser Öffnungen
symbolisch einen neuen Anfang vor Gott wagen. Das Durchqueren der Heiligen Türen ist
Ausdruck eines Glaubensbekenntnisses. Ein solches Jahr ist wie ein Kairos, um den eigenen
Glaube zu vertiefen und eine ‚vorbereitete Umgebung‘ zur Gewissenserforschung zu nutzen.
„Lasst euch mit Gott versöhnen!“ Gott bittet in Christus um meine Umkehr, meine Erneuerung,
mein geistliches Wachstum. Eine so geprägte Zeit motiviert zur Solidarität mit den
Notleidenden und verwandelt uns im Gehen und Ankommen vielleicht zu „Pilgern der
Hoffnung“. Denn wer zu einer Pilgerfahrt aufbricht, will, dass nicht alles beim Alten bleibt.
Die Begegnung mit dieser Stadt und ihren qualifizierten Stätten will mich ‚transformieren‘, will
‚etwas mit mir machen‘, will uns zu Stellvertretern und Fürbittern derer machen, denen das
Pilgern nichts mehr sagt und die ihre Glaubenshoffnung verloren haben. „Nur um der
Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.“ (Walter Benjamin)
Wie alles anfing
Am Abend des 24.12. 2024 wird Papst Franziskus mit der symbolischen Geste der Öffnung der
ersten Heiligen Pforte das Heilige Jahr eröffnen.
2025 ist das 27. ‚ordentliche‘ Heilige Jahr der Kirchengeschichte, seit vor 725 Jahren im Jahre
1300 Papst Bonifaz VIII. (1294-1303) Gespür für ‚Glaubens-Marketing‘ und ‚religiöse
Performance‘ bewies. Diese Jahrhundertwende, das Centenarjahr 1300, wurde als markante
Zeitmarke wahrgenommen. Die Bulle Bonifaz‘ (Antiquorum habet fidem“) datiert auf den
17.2.1300, erlassen beim Lateran, dem damaligen Wohnpalast der Päpste. Zwar gab es bereits
zuvor lokale Heilige Jahre (in Santiago de Compostela 1126, Bamberg 1189, Canterbury
anlässlich der Translatio von Thomas Becket 1220), doch ein solches Jubeljahr in Rom trug
von vornherein einen petrinischen Akzent und sollte zeugen vom wachsenden Ansehen des
Papstes als des Nachfolgers Petri und dem damals bereits anachronistischen Versuch einer nicht
unproblematischen, herrschlustigen Papst-Persönlichkeit, die geistig-politische
Vorrangstellung des Papsttums zur Geltung zu bringen. Der ‚Konkurrenzdruck‘ der drei
Hauptpilgerorte Jerusalem, Santiago de Compostela und Rom, zu denen die „peregrinationesmaiores“, die Hauptwallfahrten gingen, ist bei der Ausrufung der Heiligen Jahre
mitzuberücksichtigen. Im Umfeld der Jahrhundertwende verdichteten sich endzeitliche
Heilserwartungen. Ein ungeheures Bedürfnis nach Sühne, Buße und Umkehr lag in der Luft -
und eine große Hoffnung der Pilger auf Verzeihung, den „gran perdono“. Bonifaz setzte sich
zeitlich verzögert als Promotor an die Spitze der Massenbewegung und steigerte sein Ansehen
als Papst und verhalf Rom und v.a. den beiden Apostelbasiliken zu beträchtlichen Einkünften.
Um den Anspruch des Nachfolgers Petri auf die ganze Machtfülle hervorzuheben, wurde diese
Bulle „Antiquorum habet fida relatio“ von Bonifaz VIII. erneut am Fest der Cathedra Petri, dem
22.2.1300, promulgiert und das besondere Jubiläumsjahr ausgerufen. Das fromme Volk Gottes
drängte Bonifaz VIII. quasi zu diesem Aufruf und einer nachträglichen apostolischen
Bestätigung, denn viele Pilger strömten zur Jahrhundertwende in die Ewige Stadt und suchten
das „Jubiläum“, das religiöse Erlebnis; sie wollten das ‚wahre Abbild‘ Christi, also die ‚vera
icon‘, das Veronika-Schweißtuch sehen. Das anonyme Gerücht vom in Rom in diesem Jahr
gewährten Sündenablass lag in der Luft. Der Papst lenkte diese Erwartung in Bahnen und
gewährte unter bestimmten Bedingungen (reumütige Beichte, mehrfacher Besuch der beiden
Apostelgräber in ihren Basiliken: Römer dreißigmaliger Besuch; Auswertige aufgrund der
langen Anreise nur fünfzehnmaliges Aufsuchen der Apostelgräber) einen ‚vollkommenen
Ablass‘, einen Plenarablass ihrer (zeitlichen) Sündenstrafen. Bußerleichterungen,
Bußermäßigungen und Bußerlasse wurden zugesichert. Der Ausbau des Ablasswesens schritt
im 12. Jahrhundert voran; Kreuzzugsablässe wurden gewährt. Das Gerücht von einer solchen
in Rom 1300 zu gewinnenden Amnestie, der vermeintlich ‚billigen Gnade‘, der im Vorbeigehen
zu gewinnenden Vergebung der Sünden und dem Erlass der Sündenstrafen, quasi also von einer
Selbstabsolution, machte die Runde. Prominenter Pilger im Jahre 1300 war Italiens größter
Dichter Dante, damals 35 Jahre al, also in der ‚Mitte‘ seines Lebens stehend; er spielte in der
‚Vita nuovo‘ (Kap 41) und in der ‘Göttlichen Komödie‘ (Inferno 18,29) auf den „Anno del
Giubbileo“ an und ließ seinen fiktiven Gang durch die Unterwelt und das Fegefeuer zum
Paradies in der Osterwoche des Jubiläumsjahres 1300 beginnen. Sein Gegner war Papst Bonifaz
VIII, über dessen Geldgier und weltlichen Herrschaftsanspruch Dante das Verdammungsurteil
sprach (vgl. Paradiso 17,51 und 27,22ff). Dante machte keinen Hehl aus seiner Distanz zu den
fragwürdigen Begleiterscheinungen des Pilgerwesens und setzte einem ‚vulgären‘,
veräußerlichten Pilgergedanken sein Ideal gegenüber: Wahre Pilgerschaft ist der geistliche Weg
des Erdenbürgers zum himmlischen Jerusalem. Das mittelalterliche Sprichwort lautet: „Wer
viel pilgert, wird selten heilig.“ Der gewaltige ‚Concursus‘ der ‚Romei‘, der Rompilger,
forderte die Organisationskraft des Papstes heraus. Solche tiefe religiöse Erregung des nach
Rom strömenden Volkes musste in gewisse Bahnen gelenkt werden. Bonifaz VIII., der sich
damals auf dem Höhepunkt seiner Macht befand und kurz darauf im Konflikt mit der französischen Krone gedemütigt wurde, und seine Kurie waren also nicht die alleinigen
‚Erfinder‘ des Heiligen Jahres; eher geriet der Papst unter Zugzwang, reagierte und gab der
Massenbewegung nachträglich und rückwirkend seinen Segen. Es gelang ihm, die
Pilgermassen gezielt und etwas geordneter nach Rom zu lenken. Bei der Einführung dieses
besonderen ‚Jahres des Herrn‘ im Jahre 1300 verband sich die Tradition eines besonderen
gottgeweihten Jahres (Lev 25,10) mit dem Gedanken eines spirituellen ‚Erlassjahres‘, der
Streichung der Sündenschuld statt der Geldschuld; es ging um die Sündenvergebung, den
Ablass (indulgentia), den ‚Perdono‘. Das erste Jubeljahr war also quasi ein ‚Selbstläufer‘; auch
ohne offizielle Einladung kamen mehr oder weniger bußwillige Pilger zur Jahrhundertwende
in die Stadt, die damals vielerorts in Ruinen lag und zugleich vielen immer noch als der Nabel
der Welt galt. Die ‚Rom-Idee‘ war stark, jedoch der Weg nach Rom war für viele Pilger
lebensgefährlich, für manche eine Reise ohne Wiederkehr. Kein Weg war den Wallfahrern zu beschwerlich, um einen Jubiläumsablass zu ‚gewinnen‘, die in Rom in Aussicht gestellten
Benefizien zu empfangen und große geistliche Gnaden zu erlangen. Damals gab es noch keine
Heilige Pforte, noch nicht das ausdrucksstarke Ritual der Öffnung und der symbolischen
Durchschreitung eines „Tores der Gerechtigkeit“ (Ps.118,19).
Im rechten Seitenschiff der fünfschiffigen Lateranbasilika findet man das Fragment eines wohl
von Giotto gemalten Freskos; wir sehen eine Momentaufnahme, die Bonifaz VIII. zwischen
zwei Klerikern zeigt, von denen einer die Ausrufungsbulle des ersten Jubeljahres 1300 hält. Der
an seiner Mitra als Papst Identifizierbare spendet den Segen von der Loggia des Laterans aus.
Dieses Jahr der Jahrhundertwende war für den Papst nur ein „Augenblickserfolg“ (Arnold
Angenendt), für die Aufbesserung der päpstlichen Kassen hingegen erfolgreich und zur
Linderung der kirchlichen Finanznot hilfreich und ‚ertragreich‘; solch eine Innovation rief nach
Wiederholungen.
Ein Jubelfest ruft nach (bislang 27-maliger) Wiederholung
Geplant war zunächst, dieses Jubeljahr nur alle 100 Jahre stattfinden zu lassen. Eine römische
Gesandtschaft verlangte 1342 vom Papst, der damals in Avignon residierte, ein Heiliges Jahr
im Jahre 1350. Denn die Kurie als Auftraggeber fehlte 1350 in Rom. Clemens V. erlaubte dies
im Jahre 1343 mit der Bulle „Unigenitus“. Dieser in Südfrankreich residierende Papst kam also
den Römern entgegen und verkürzte den Zentenar-Rhythmus von 100 Jahren auf 50 Jahre
„wegen der Kürze des menschlichen Lebens“, passte sich also an das Zeitmaß des jüdischen
Jobeljahres an, auch unter Bezugnahme auf die Zahlenanalogie der 50 Tage der Erscheinungen
Jesu zwischen Ostern und Pfingsten. 1350 fand ein solches Jahr - bereits im Schatten einer
Pestepidemie - statt; damals war neben der hl. Birgitta von Schweden der Dichter Petrarca ein
prominenter Pilger. Verlangt wurde nun auch von den Pilgern, neben den Apostelbasiliken die
Laterankirche zu besuchen. In der Zeit des großen abendländischen Schismas entschied man
sich für 33 Jahre Abstand zwischen den Jubeljahren. Papst Urban VI. orientierte sich in seiner
Bulle „Salvator noster“ 1389 - auch wegen der Kürze des Menschenlebens - am Lebensalter
Jesu und fügte nun Santa Maria Maggiore als von den Pilgern zu besuchende Kirche hinzu.
1470/71 legten Papst Paul II und Papst Sixtus IV endgültig den 25 Jahre-Rhythmus fest. Nun
wurde die das Privilegium einer Gewinnung des Jubiläumsablasses im „annus remissionis“
auch den ablasssuchenden Christen gewährt, die nicht nach Rom kommen können. Diese
Ausdehnung und Übertragbarkeit des Jubelablasses geschahen wohl 1350 zunächst für die Bewohner von Mallorca. Ihnen wurde ein ‚Ersatz‘ für die ‚Romfahrt‘ ermöglicht, um den
Jubliläumsablass in ihren Heimatdiözesen zu erlangen. Ihnen wurde auferlegt, bestimmte, von
den Bischöfen dazu gewählte Kirchen in ihrer Heimat zu besuchen, zu fasten und eine
Geldspende zu entrichten, die sich an den Romreisekosten zu orientieren hatte und die teilweise
nach Rom für Bau- und Restaurierungsmaßnahmen an den Hauptkirchen abgeführt werden
musste. Sogenannte „ad-instar-jubilaei“-Ablässe wurden anlässlich vieler Heiliger Jahre
gewährt für die, die also quasi zu Hause eine „Pilgerfahrt im Geiste“ machen wollten. Stets galt
also beides: Der Papst teilt die Ablässe aus dem „thesaurus ecclesiae“, den Gnadenschatz, aus
und zugleich vermehrte er den pekuniären „Kirchenschatz“.
Heilige Jahre waren Ausdruck wachsender Petrusverehrung. Die Päpste luden ein und
appellierten alle Stände des „populus christianus“ zum Besuch „ad limina apostolorum“, zur
Bußwallfahrt, zum Pilgerweg an die Schwellen und Gräber der Apostel Petrus und Paulus, zur
andächtigen Betrachtung des ‚Schweißtuchs der Veronika‘ (vera icon, Volto Santo), der
Kreuzfragmente in Santa Croce und anderer nicht immer zugänglicher Reliquien, in späteren
Jahrhunderten zum betenden Besteigen der Heiligen Stiege, zum Besuch der Katakomben und
anderer wichtiger Kirchen Roms. Die Ewige Stadt wucherte mit ihren wie auf einer
Theaterbühne präsentierten Schönheiten und reizte mit dem ihr eigenen Genius loci. Da nur
Päpste Heilige Jahre ausrufen und Heilige Pforten eröffnen können, wurden diese Jubeljahre in
Zeiten einer Sedisvakanz erst nach einer erneuten Papstwahl im Februar eröffnet, so 1550 und
1775. Wegen der Tiber-Überschwemmung an St. Paul vor den Mauern wurde deshalb 1624 in
S. Maria in Trastevere eine Heilige Pforte geöffnet, ähnlich im Jahre 1700 und auch 1825 nach
der Zerstörung von St. Paul vor den Mauern durch einen verheerenden Brand im Jahre 1823.
Nur selten fielen Heilige Jahre aus. Dies geschah im Jahre 1800 in der napoleonischen Zeit
wegen des Todes des Papstes Pius VI. und der Verschleppung seines Nachfolgers nach
Frankreich, 1850 wegen der Errichtung der römischen Republik und der Flucht von Papst Pius
IX. aus Rom nach Gaeta im Königreich Neapel - und 1875, wegen der Annexion des
Kirchenstaates und dem angespannten Verhältnis des Vatikans zum jungen italienischen Staat.
Das alttestamentliche Jobeljahr als Modell
Das ‚fromme Begehren‘ des Volkes Gottes verlangte also nach einem solchen ‚gnadenreichen
Jahr‘ und hatte die alttestamentliche Tradition auf seiner Seite. Das Jobeljahr (die Vulgata
übersetzt annus iubilaeus) soll ein Jubeljahr sein. Mit einem „Jobel“, also dem Hall eines
Widderhorns, eines ‚Schofar‘ genannten Blasinstrumentes (Jos 6,5; Ex 19,13, eröffneten die
Juden nach 7 x 7 Jahren das 50. Jahr (Leviticus 25,8-55, v.a. V.10; 27,16-25). Das 50. Jahr, das
Erlassjahr (schenat ha-jobel) sollte für das Volk Israel das ‚Freijahr‘ eines neuen Anfangs, der
Wiederherstellung gerechter Besitzverhältnisse, der Rückerstattung von veräußertem Besitzes,
der Freilassung der jüdischen Sklaven, der Erholung des bewirtschafteten Erdbodens sein. Es
ging um die die erneute Schaffung gottgewollter gerechter Verhältnisse, um Schuldentilgung
und vor allem um das Bekenntnis, dass Gott der Herr der Welt und der Eigentümer des Landes
ist. Dieses Jahr trug nach jüdischem Verständnis einen sozialen und theozentrischen Akzent:
Nach 50 Jahren soll alles wieder in die Ursprungssituation zurückkehren. Papst Franziskus
greift diesen Gedanken auf, wenn er am 26.12.2024 eine fünfte Heilige Pforte im römischen
Gefängnis Rebibbia eröffnen wird: „Ich bin gekommen, den Gefangenen die Entlassung zu
verkünden und den Gefesselten die Befreiung“ “ (Jes 61,1). Wir wissen nicht, ob und welche
realen Folgen dieser Appell der Streichung von Geldschulden im jüdischen Alltagsleben hatte.
Unser Wort ‚Jubiläum“ leitet sich ab von diesem Wort ‚Jobel‘, dem Schall des Widderhorns
der Juden zur Ankündigung dieser Freudenzeit; jubilus und jubilare flossen zusammen es
verbindet sich mit dem Freudenjubel, dem „Jauchzen“ (Luther), dem „Juhu“ (iubilium) des
freudig erregten Volkes.
Heilige Jahre -Antwort auf die Sehnsucht nach „Perdono“, nach Vergebung
Nicht erst seit 1300 wurde die Romfahrt für Pilger attraktiv. Der Dreiklang Wallfahrt-Buße-
Ablass, die Sorge um das persönliche Seelenheil und das Streben, das Heilige zu sehen und zu
ertasten, machte dem Glauben des mittelalterlichen Menschen Beine. Da nicht jeder Christ
Kreuzritter werden konnte und die Heilige Stadt Jerusalem durch den Sarazenen-Einfall für
Wallfahrer fast unerreichbar wurde, rückte die Stadt der Apostel als ‚heilige Stadt‘ auf. Das
‚Ersatzziel‘ wurde zum Sehnsuchtsziel der Pilger. Der durchaus sozialkritische Hintergrund des
jüdischen Jobeljahres wurde in der Gestalt des Heiligen Jahres eher vergeistigt. Ein Magnet für
Wallfahrer war der bei Heiligen Jahren in Aussicht gestellte Sündenablass, der damals die ‚Hauptattraktion‘ war und viele um ihr Seelenheil besorgte Pilger und Büßer anlockte. Die
Erwartungshaltung vieler weitgereister Wallfahrer war hoch, die Kunde von der in Rom
lockenden fassbaren „nahen Gnade“ (Berndt Hamm) machte Menschen mobil. Die Fernpilger
eilten mit sog. Indulgenzlisten durch die Stadt und bemühten sich, an den heiligen Stätten ihr
Tagespensum zu schaffen und Ablässe zu erwerben. Bereits Bonifaz VII. machte differenzierte
Vorgaben: Den Römern verlangten die Päpste einen dreißigmaligen Besuch der Apostelgräber
ab. Auswärtige Pilger diesseits der Alpen blieben etwa 15 Tage in Rom und pendelten zwischen
dem Petrus- und Paulusgrab hin und her. In manchen Heiligen Jahren wurde von Pilgern von
jenseits der Alpen ‚nur‘ ein achtmaliger Besuch der Gräber Petri und Pauli erwartet. Für viele
Fernpilger war diese Romfahrt ein riskantes und oft lebensgefährliches Abenteuer. Diebe und
Verbrecher trieben sich auf den Straßen Roms herum; die Versorgungslage in der überfüllten
Stadt war oft prekär. Auch Prominente statteten der Stadt in Jubeljahren Besuche ab und
verrichteten ihre Andachtsübungen. Die Stadt waren überfüllt, Krankheiten breiteten sich aus.
Oft waren es Bruderschaften (v.a. die Erzbruderschaft der Hl. Dreifaltigkeit), die sich um die
Lebensmittelversorgung, Unterbringung und die Krankenpflege der Pilger in den Hospizen
kümmerten. Das Gedränge im Gassengewirr von Rom, das um 1300 kaum 30 000 Einwohner
zählte, muss gewaltig und an Verkehrsengpässen wie der Aeliusbrücke (Hadriansbrücke), also
der späteren Engelsbrücke, oder bei den Massenaufläufen vor den Heiligtümern
lebensgefährlich gewesen sein. Dante war wohl Augenzeuge dieses ersten Heiligen Jahres und
erzählte vom lebensgefährlichen Gedränge auf dieser Tiberbrücke (Inferno 18,25. 28ff); im
Jahre 1450 kam es auf dieser engen Tiberbrücke im Menschengedränge zu einer Katastrophe;
über 130 Pilger wurden dabei getötet.
Rom versetzte Menschen in geistliche Unruhe und lockte in Heiligen Jahren mit einer
außergewöhnlichen ‚spirituellen Vergünstigung‘, dem „Perdono“, mit Indulgenzen. Immer
ging es jedoch auch um Handfestes. Ein Heiliges Jahr hatte stets auch (besonders 1450) eine
ökonomische Auswirkung auf die Stadt, war ein gewaltiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung,
kurbelte die dortige Konjunktur an und wurde im späten Mittelalter zum Anlass genommen,
die teilweise unwürdigen ruinösen Zustände in dieser Stadt zu beseitigen. Heilige Jahre gaben
den Päpsten immer Gelegenheit, ihren eigenen Machtanspruch und das Bild einer
‚triumphierenden Kirche‘ in Architektur und Zeremonien und unter dem Einsatz suggestiver
und affektiver Zeichen zu repräsentieren. Unter Sixtus V. wurde 1475 die Ponte Sisto gebaut,
es wurden schnurgerade Straßen durch die Altstadt nach St. Peter hin geschlagen und ein
ausgeklügeltes Straßennetz geschaffen zur Bewältigung der Pilgerströme. Alexander VI. ließ
die ‚Via Alessandrina‘ zwischen Engelsburg und dem Vatikan bauen, den heutigen „Borgo
nuovo“. Unter Papst Gregor XIII wurde 1573 für das Heilige Jahr 1575 die Via Merulana
zwischen Santa Maria Maggiore und dem Lateran gebaut. Baufällige Basiliken wurden
restauriert. Anlässlich des Heiligen Jahres 1750 wurde die ‚Spanische Treppe‘ gebaut. Im Blick
auf das Heilige Jahr 2025 gab es ein spektakuläres Tunnelprojekt am Ende der Via della
Conciliazione (die wiederum erst zum Heiligen Jahr 1950 vollendet war) an der Piazza Pia, um
den Autoverkehr durch diesen Tunnel zu leiten und den Pilgern eine verkehrsberuhigte Zone
auf ihrem Weg von der Engelsburg zum Petersplatz zu bieten.
Außerordentliche Heilige Jahre
Papst Pius IX. 1933 und Papst Johannes Paul II. 1983 haben bereits „außerordentliche“ Heilige
Jahre ausgerufen, die an die 1900. und 1950. Wiederkehr des ‚Jahres der Erlösung‘ erinnerten.
Zugleich geriet das Heilige Jahr (vom 2. April 1933 bis zum 1. April 1934) nach den ‚Lateranverträgen‘ von 1929 zu einer Art Versöhnungsfeier zwischen dem Vatikan und der
faschistischen Regierung Italiens. Papst Franziskus hatte 2016 ein „außerordentliches Heiliges
Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen. Anders als 2025 erlaubte er 2016 den Bischöfen der
Weltkirche, in ihren Diözesen eigene Heilige Pforten in überregional bedeutsamen Kirchen zu
bestimmen.
Die Öffnung Heiliger Pforten als eine suggestive Geste
Die erste heilige Pforte (Porta santa) wird Papst Franziskus zur Zeit der Vesper am Heiligen
Abend, dem 24.12.2024, im Petersdom in Rom öffnen. Nach römischem Denken begann das
neue Jahr am Weihnachtsfest. Ausgerechnet der berüchtigte Borgiapapst Alexander VI. hat
diesen Ritus der ‚Apertura della Porta‘ vor der Feier der ersten Vesper zur Weihnacht 1499 an
St. Peter zur Eröffnung des 8. Heiligen Jahres eingeführt. Er wählte diese Zeremonie auch als
sinnenträchtiges Zeichen für die päpstliche Schlüsselgewalt (vgl. Jes 22,22). Er öffnete die
‚goldene Pforte‘ (Porta aurea), die durch eine Mauer verschlossen war. Man berief sich auf eine
mündliche Überlieferung, die von der Tradition einer alle hundert Jahre vorgenommenen
Zeremonie der Pfortenöffnung sprach. Der fromme Einsatz dieses Borgiapapstes für das von
ihm städtebaulich durchdachte und zugleich ‚erlebnisorientierte‘ Heilige Jahr und die darin
angebotenen Reliquienschauen ist bemerkenswert, zumal sein skandalträchtiges Pontifikat von
Mythen umgeben ist. Bei der Schließung der Heiligen Pforte (Epiphanie 1501) fehlte der Papst
allerdings. Bis heute wird die Liturgie der Eröffnung eines Hl. Jahres von den im Jahre 1500
allererst gewählten Ritualen und den drei zeremoniellen Hammerschlägen geprägt. Inspiriert
wurde die päpstliche Innovation der rituellen Öffnung vierer Heiliger Pforten durch seinen
Kämmerer und Zeremonienmeister Johann Burckardus (1450-1506) aus Straßburg (italienisch
Argentinen), dessen tagebuchartigen Aufzeichnungen wir viele Details verdanken und der
vielleicht dem Papst auch die Anregung gab, die ‚Goldene Pforte‘ - umrahmt von
Antiphonenversen, Psalmengesang (Ps 118,19f; Ps 51) und einem päpstlichen Gebet - zu
öffnen. Bis heute erhalten ist das Wohnhaus des Zeremonienmeisters, der „Palazzetto del
Burcardo“ mit der „Torre Argentina“ nahe des nach diesem elsässischen Liturgen benannten
‚Largo Argentina‘ in Roms Innenstadt in der Via del Sudario 44. Papst Alexander VI. schlug
noch mit einem einfachen Maurerhammer die Türvermauerung ein. Seit 1524 ist dieser
Hammer golden, später silbern. Wie Mose in der Wüste mit seinem Stab auf den Felsen schlägt
und ihm Wasser für das durstige Volk Israel entlockt (Ex 17,6, Num 20.11), so ermöglicht der
Papst durch die Öffnung der Heiligen Pforte mit der Hammerpicke dem neuen Volk Gottes
einen „außerordentlichen“ Weg der Erlösung (vgl. Ps 78,15f). Der Borgiapapst zog mit dieser
Zeichenhandlung die Grabeskirche des hl. Petrus der ‚Porta aurea‘ am Lateran vor. 2024 wurde
am 9. November das Fest der Weihe der von Kaiser Konstantin dem Papst geschenkten
Salvatorbasilika vor 1700 Jahren gefeiert. In der Lateranbasilika muss es wohl bereits beim
nächsten Mal 1350 (oder 1390?) eine Heilige Pforte, eine ‚Goldene Pforte‘ gegeben haben, da
in einem Dokument aus dem Jahre 1400 von der Öffnung der Pforte der Lateranbasilika die
Rede ist. Nach der Beschreibung eines gewissen Giovanni Ruccellai aus Viterbo aus dem Jahre
1450 habe Papst Martin V. 1423 zum ersten Mal in der Geschichte des Jubeljahres die Heilige
Pforte geöffnet. Die auch S. Giovanni in Laterano genannte „Haupt- und Mutterkirche“ aller
Kirchen Roms und der Welt konnte nach dem Aufenthalt der Päpste in Avignon und dem
Wohnortwechsel der Päpste hin zum Vatikanhügel ihre frühere Stellung nicht mehr
wiedergewinnen. Im Jahre 1500 stand an der Hl. Pforte an St. Peter eine berüchtigte
Spendentruhe aus Eichenholz, in die hinein die Pilger ihre Ablassspende, ihren ‚obolus‘ vor
allem für den Neubau von St. Peter und auch zur Finanzierung des ‚Türkenkreuzzuges‘
einwerfen konnten; der Eindruck konnte entstehen, der Pilger könne sich mit diesem sehr
‚gegenständlichen‘ Opfer den Jubiläumsablass kaufen und ‚Eintritt zahlen‘ in das Heiligtum.
In Erinnerung kommt der Spottvers: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem
Fegfeuer springt.“ 17 Jahre nach diesem Hl. Jahr kam es zum Thesenanschlag Luthers in
Wittenberg. Er kämpfte in seinen Tischreden gegen die Gewinnsucht der Päpste. Im folgenden
Hl. Jahr 1525, das aufgrund der durch die beginnende Reformation ein Krisenjahr war und nur
wenige Pilger anzog, war diese fragwürdige ‚Spendenbox‘, auch angesichts der vom
‚Ablassskandal‘ losgelösten Reformationsereignisse im fernen Deutschland, verschwunden.
1557 kam es zu tumultartigen Situationen beim Öffnen der Hl. Pforte an St. Peter durch Papst
Gregor XIII.; der Hammer zerbrach beim Schlagen auf die Ziegel-Blendwand; jeder ‚fromme‘
Schaulustige wollte nicht nur Trümmerreste der Mauer, sondern auch Geldmünzen und
Medaillen ergattern, die bei den Schlussfeierlichkeiten des Hl. Jahres 25 Jahre zuvor in die
Mauer verbaut worden waren. Die Herausgabe von Gedenkmünzen und Medaillen gehörte bald
zur Tradition Heiliger Jahre.
Seit 1500 also gibt es dieses Türritual, ohne dass wir uns das Hl. Jahr nicht mehr vorstellen
können. Der Papst vollzieht einen dreifachen Hammerschlag und spricht: „Aperite mihi portas
iustitiae“. „Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Eintreten will ich in Dein Haus, o Herr.
Öffnet die Tore, denn Gott ist mit mir.“ Dann öffnet sich die linke Seiteneingangstür von St.
Peter (also nahe der 1499 noch in der alten Basilika aufgestellten Pietà des Michelangelo) bzw.
wird zurückgerollt. Die jetzige hl. Pforte im Petersdom hat vom Bistum Basel 1950 gestiftete Bronzeflügel – eine Reverenz an Papst Pius XII. und ein Dank dafür, dass die Schweiz im Krieg
verschont wurde. Am linken, offenstehenden Türflügel ist dem Pilger in Augenhöhe die
Berührung des Kreuzes möglich. Am Stephanustag, dem 26.12.2024, wird der Papst ‚außer der
Reihe‘ eine weitere Heilige Pforte im römischen Gefängnis Rebibbia öffnen. Die Öffnung
dreier weiterer heiliger Pforten durch den Papst (in manchen Jahren auch durch
Kardinallegaten) in den Patriarchalbasiliken werden folgen, am 29.12.2024 in der
Lateranbasilika, am 1.1.2025, dem Oktavtag von Weihnachten, in der römischen
‚Weihnachtskirche‘ Santa Maria Maggiore und am 5.1.2025 in Sankt Paul vor den Mauern. Der
Januar trägt den Namen des römischen Gottes Ianus, des Gottes der Ein- und Ausgänge (lat.
ianua = die Tür). Im Lateran ist die Hl. Pforte eine unter Papst Johannes Paul II. im Jahre 2000
vom Bildhauer Floriano Bodini geschaffene Tür. Auch die Tradition mit der Öffnung von vier
Heiligen Pforten hat der Borgiapapst im Jahre 1500 begründet. Bemerkenswert ist, dass die
„heiligen Pforten“ nie die Hauptportale der Basilika sind, sondern jeweils eine Nebenpforte. So
prächtig diese Pforten auch sind, sie erinnern an den Ernst, bestimmte Schwellen zu
überschreiten und Türen zu passieren. Das Durchschreiten der Heiligen Pforte ist ein sichtbares
Zeichen für den kühnen Entschluss eines Menschen, neue Wege zu beschreiten und neue
Anfänge zu wagen. Es gab im Mittelalter das Verbot für ‚öffentliche‘ Sünder, ohne öffentliche
Buße durch Kirchentüren hindurch in das Kircheninnere zu gehen. Wer also diesen Schritt wagt
und eintritt, setzt ein äußeres Zeichen für eine innere Wandlungsbereitschaft. Ich möchte ein
neues Leben beginnen und bekräftige diese Bereitschaft zur inneren Reinigung durch eine
expressive Geste, durch den Eintritt in das Heiligtum durch dieses symbolträchtige „Tor zur
Erlösung“.
Macht hoch die Tür! Machet die Türen weit! Auch außerhalb der Heiligen Jahre werden die
Heiligen Pforten von den Gläubigen wie Berührungsreliquien verehrt; manche Teile der Türen
sind blank abgegriffen. Die Hl. Pforte erinnert an die „enge Tür“ (Lk 13,24f; Mt 7,13f), an die
Möglichkeit, endgültig vor eine verschlossene Tür zu geraten (Mt 25,10). Die Heilige Pforte ist
ein Gleichnis für die geöffnete Himmelstür (Offb 3,8 und 4,1, vgl. Ez 43,1-4). Diese einladende
Öffnung ist ein Hoffnungszeichen in dieser krisenhaften Welt; sie erinnert an die
„Himmelspforte“, die Jakob am Ende der Himmelsleiter gesehen hat (Gen 28,17). Das Hl. Jahr
2025 ist auch ein Bekenntnis zum Sohn Gottes, „wesensgleich dem Vater“. Jesus Christus ist
die Tür (Joh 10,7.9). „Wenn er öffnet, wird niemand schließen, wenn er schließt, wird niemand
öffnen“ (Jes 22,22, vgl. Offb 3,7). Die Heiligen Pforten stehen ein Jahr lang offen, bis der Papst
am 6. Januar 2026 die letzte Heilige Pforte an St. Paul vor den Mauern wieder verschließen
wird. Er wird die Türen verschließen, nicht vermauern (lassen); das Vermauern geschah zum
letzten Mal 1950; seit 1975 (Papst Paul VI.) wird sie nur verschlossen werden.
Das Heilige Jahr in Rom wird ein Großereignis praktizierter Frömmigkeit, aber auch eine
logistische Herausforderung werden. Ähnlich wie vor Olympischen Spielen, löst ein Heiliges
Jahr einen Bauboom und eine Welle von Restaurierungen aus. Es geht nicht nur um die
Reinigung des Innenlebens der Pilger, sondern auch um die Reinigung und Verschönerung der
Ewigen Stadt. Zahlreiche Baustellen seit dem Herbst 2023 in Rom zeigen, wie sehr sich dieses
Pilgerziel für 2025 herausputzt. Heilige Jahre sind religiöse und kulturelle Erlebnisse.
Geschätzte 33-45 Millionen Pilger werden in dieser faszinierenden Stadt erwartet.
Das Jahresfest ist ein „Jahr des Verzeihens“ und will unsere Freude über die Vergebung, die
Freude der Umkehr und die Sensibilität für unsere eigene Gefährdung wecken. Pilgernd werden
wir bereit, Schuld zuzugeben, die auch im Namen der Kirche geschah, und den neuen Anfang
zu wagen. Innerhalb des Heiligen Jahres wird der Papst es sich nicht nehmen lassen, durch
gezielte Heiligsprechungen Zeichen zu setzen. Oft waren Heilige Jahre vergangener
Jahrhunderte von Heiligen oder von Heiligsprechungen geprägt. Die hl. Birgitta von Schweden
und ihre heilige Tochter Katharina waren beim Heiligen Jahr 1350 dabei. Der hl. Karl
Borromäus und der hl. Philipp Neri prägten das Heilige Jahr 1575 mit. Damals gingen große,
von Laienbruderschaften geleitete Pilgerzüge durch Rom. Die Pilgerprozessionen wurden
inspiriert vom hl. Philipp Neri, der die Trinitatisbruderschaft ins Leben rief und auch die
‚Sieben-Kirchen-Wallfahrt‘ anregte, wodurch S. Lorenzo furi le mura, Santa Croce in
Gerusalemme und S. Sebastiano fuori le mura als Hauptpilgerziele zu den vier
Patriarchalbasiliken hinzukamen. 1675 wurden Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz
heiliggesprochen, 1925 Thèrese von Lisieux und der hl. Pfarrer von Ars, 1933 Don Bosco und
1950 Vinzenz Pallotti. Im April 2025 wird u.a. der junge, in Italien hochverehrte und in Assisi
beigesetzte Carlo Acutis (1991-2006) als „Patron der digitalen Welt“ und „Influencer Gottes“
heiliggesprochen werden.
Heilige Jahre wurden immer auch zum Anlass für Neuerungen genommen: 1750 die
Kreuzwegandacht und die Aufrichtung von Kreuzwegstationen im Kolosseum (1870 entfernt),
1925 die Einführung des Christkönigsfestes, 1950 die Verkündigung des Dogmas von der
Leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel.
Geistliche Aspekte des Heiligen Jahres und der Durchschreitung Heiliger Pforten
Eine Pilgerfahrt nach Rom in diesem Heiligen Jahr, das bewusste Durchschreiten der
besonderen Pforten, das Gehen auf uralten Pilgerwegen und das „Wallen“ hin zu den Gräbern
der Heiligen in dieser wunderbaren Erinnerungslandschaft des Glaubens ist Glaube zum
Anfassen, ist ein schönes ‚rituelles Spiel‘, eine geistliche Erneuerungsbewegung, kein
triumphalistisches Event, keine bloße Massenkundgebung, keine veräußerlichte
Leistungsfrömmigkeit. Angesichts der vielen Pilger wird die Frömmigkeit auch eine
Geduldsübung in Warteschlangen vor den Heiligen Pforten werden. Als „Pilger der Hoffnung“ werden die Wallfahrer „die Schwelle der Hoffnung überschreiten“ (so der Titel eines Buches
von Papst Johannes Paul II, 1994).
Die „Heilige Pforte“ zu überschreiten, ist als Teil der Abenteuerreise einer Pilgerfahrt eine
Mutprobe. Franz Kafka, der mit seiner Gleichnis „Vor dem Gesetz“ die vielleicht wichtigste
Tür-Parabel des 20. Jahrhunderts verfasst hat, hat diesen Moment des Zögerns und der
Mutprobe der Überschreitung einer Türschwelle in seiner Kurzgeschichte „Heimkehr“ auf
einzigartige Weise formuliert. für einen ‚‘verlorenen Sohn‘, der nach vielen Jahren
zurückkehren will in sein Elternhaus: „Ich wage nicht, an der Küchentür zu klopfen. Nur von
der Ferne horche ich, nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als Horcher
überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen
leichten Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht zu hören, herüber aus den Kindertagen.
Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren
… Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jemand die
Tür öffnete und mich fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren
will.“ (Franz Kafka, Sämtliche Erzählungen, Frankfurt 1970, S.321). Die Türschwelle
symbolisiert „Schwellensituationen“, auf der wir abwartend verharren und über die wir nach
einer wichtigen Entscheidung oder an einem dichten Drehpunkt unseres Lebens in neue und
unbekannte Welten eintreten. Es gehört Mut und Entschlusskraft, den Willen zum Neubeginn
und Sehnsucht dazu, aus sich herauszugehen, diesen Übergang zu wagen und in das Innere des
Heiligtums einzutreten.
Im Heiligen Jahr wird ein Zeitraum eingeräumt, um vielleicht geistliches Neuland zu betreten.
In der römischen Sakraltopographie wird eine eher gewöhnliche Pforte zum
außergewöhnlichen und herausfordernden Ort, der uns Pilger vor Gott verortet. Die Pforten
sind insofern heilig, als sie den Zugang eröffnen zu dem, der allein heilig ist, zum ‚winzigen
Jesus‘, der in seinem Leib die ‚enge Tür‘ ins Gottesgeheimnis ist.
Zudem begeht die Kirche 2025 das 1700-Jahre-Jubiläum des Konzils von Nizäa (heute das
türkische Iznik) im Jahre 325. Hier wird im Dogma bekräftigt, was in Rom gefeiert wird:
Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch ist „die Tür“ zum Heil. In ihm erfüllt sich die Zusage
Gottes: „Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann.“ (Offb 3,7).
Voraussichtlich 2033 wird es erneut ein „außerordentliches“ Heiliges Jahr geben, 2000 Jahre
nach dem Erlösungsereignis von Tod und Auferweckung des Herrn.
In unserer kalten und kriegerischen Welt voller diffuser Zukunftsängste und Hoffnungsarmut
wollen wir „Pilger der Hoffnung“ sein Hoffnungswege gehen und an Hoffnungstüren klopfen.
Hoffnung ist fragil, sie bedarf des Schutzes, der Stütze durch andere Hoffende, auch Hoffnung
auf Verzeihung. Wir werden Boten geteilter und weitergegebener Hoffnung sein und uns den
Frieden und die Vergebung Gottes schenken lassen. Jedes Jahr, das der Herr uns schenkt, kann
ein Jahr der Gnade sein. Dieses Zeitfenster kann zu einem ‚Jahr der Versöhnung‘ und der
geistlichen Vertiefung werden. Für viele Zeitgenossen ist die uns von Christus in der Taufe
geöffnete Tür zur Kirche zugefallen, der Zugang zur Gemeinde zugeschlossen. Auch das bis
heute mit der Tradition des Heiligen Jahres eng zusammenhängende Ablasswesen ist schwer
zu vermitteln. Manche verharren unentschlossen auf der Schwelle. Der weihnachtliche Glaube („Heut‘ schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis“ (GL 247,4)), dieses vom
Evangelisten Lukas besonders hervorgehobene „Heute“ des Heils, soll ein ganzes Jahr
zeichenhaft in den suggestiven Zeichen der geöffneten Türen spürbar bleiben.
Viele Wege führen nach Rom und von Rom weg, doch es stimmt auch, was Papst Benedikt
XVI. sagte: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“.
Kurt Josef Wecker
Viele Wege führen nach Rom und von Rom weg, doch es stimmt auch, was Papst Benedikt
XVI. sagte: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“.
Kurt Josef Wecker
Literatur:
Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997.
Ders. / Thomas Lentes, Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 29(1995), S.
1-71.
Clemens Bombeck, Auch sie haben Rom geprägt, An den Gräbern der Heiligen und Seligen in
der Ewigen Stadt, Regensburg 2004
Enno Bünz, Das Jahr 1300. Papst Bonifaz VIII, die Christenheit und das erste Jubeljahr, in:
Ders., (Hg.), Der Tag X in der Geschichte, Stuttgart 1997, S. 50-77.
Arnold Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969, v.a. S. 336ff.
Ders. Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe nach Rom um 1475, in: Helmrath, Johannes
u.a. (Hg.), Studien zum 15. Jahrhundert, FS Erich Meuthen II, München 1994, S. 869-902.
Gloria Fossi, La Storia dei giubilei, 4 Bände, Roma 1997-2000.
Francesco Gioia, Pilger in Rom. Ein spiritueller Kunstführer, Regensburg 2. Aufl. 2002.
Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Darmstadt 1978
Michael Hesemann, Rom im Heiligen Jahr, Illertissen 2024.
Josef Imbach, Rom ohne Heiligenschein. Geschichten der Ewigen Stadt, Mannheim 2010,
S.206-218.
Paul Imhof, Das Heilige Jahr. Aus dem Kirchenschatz einen Ablass gewinnen, in Geist und
Leben 56 (1983) S.401-405.
Eva-Maria Jung-Inglessis, Romfahrt durch zwei Jahrtausende in Wort und Bild, Bozen 4. Aufl.
1985.
Dies., Das Heilige Jahr in der Geschichte, Bozen 1974.
Franz Xaver Kraus, Das Anno Santo 1900, Essays, II, Berlin 1901, 219-336.
Herbert Krüger, Das Heilige Jahr 1500 und Erhard Etzlaubs Romweg-Karte, in: Erdkunde
Viele Wege führen nach Rom und von Rom weg, doch es stimmt auch, was Papst Benedikt
XVI. sagte: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“.
Kurt Josef Wecker
Literatur:
Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997.
Ders. / Thomas Lentes, Gezählte Frömmigkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 29(1995), S.
1-71.
Clemens Bombeck, Auch sie haben Rom geprägt, An den Gräbern der Heiligen und Seligen in
der Ewigen Stadt, Regensburg 2004
Enno Bünz, Das Jahr 1300. Papst Bonifaz VIII, die Christenheit und das erste Jubeljahr, in:
Ders., (Hg.), Der Tag X in der Geschichte, Stuttgart 1997, S. 50-77.
Arnold Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969, v.a. S. 336ff.
Ders. Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe nach Rom um 1475, in: Helmrath, Johannes
u.a. (Hg.), Studien zum 15. Jahrhundert, FS Erich Meuthen II, München 1994, S. 869-902.
Gloria Fossi, La Storia dei giubilei, 4 Bände, Roma 1997-2000.
Francesco Gioia, Pilger in Rom. Ein spiritueller Kunstführer, Regensburg 2. Aufl. 2002.
Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Darmstadt 1978
Michael Hesemann, Rom im Heiligen Jahr, Illertissen 2024.
Josef Imbach, Rom ohne Heiligenschein. Geschichten der Ewigen Stadt, Mannheim 2010,
S.206-218.
Paul Imhof, Das Heilige Jahr. Aus dem Kirchenschatz einen Ablass gewinnen, in Geist und
Leben 56 (1983) S.401-405.
Eva-Maria Jung-Inglessis, Romfahrt durch zwei Jahrtausende in Wort und Bild, Bozen 4. Aufl.
1985.
Dies., Das Heilige Jahr in der Geschichte, Bozen 1974.
Franz Xaver Kraus, Das Anno Santo 1900, Essays, II, Berlin 1901, 219-336.
Herbert Krüger, Das Heilige Jahr 1500 und Erhard Etzlaubs Romweg-Karte, in: Erdkunde
4(1950), S, 137-140.
Jügren Miethke, Das ‚Jubeljahr‘ Bonifaz VIII.: päpstlicher Anspruch auf Weltgeltung in:
Lothar Gall (Hg.), Das Jahrtausend im Spiegel der Jahrtausendwenden, Berlin 1999, S. 137-
175.
Ulrich Nersinger, „Das ist das Tor zum Herrn“. Heilige Pforten – Zugänge zu Gott, in:
Vatikanmagazin Dezember 2024, S. 22-28.
Desmond O’Grady, Alle Jubeljahre. Die ‚Heiligen Jahre‘ in Rom von 1300 bis 2000, Freiburg
1999.
Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittealters (1417-1799) 16
Bände in 22 Teilbänden, Freiburg 1886-1933 (Neuauflage Freiburg 1955-1961).
Nikolaus Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter. 3 Bände. Mit einer Einleitung und
einer Bibliographie von Thomas Lentes, (nach der ersten 1922 erschienenen Ausgabe)
Darmstadt 2000.
Ders., Zur Geschichte der Jubiläums vom Jahre 1500, in: Zeitschrift für katholische Theologie
24 (1900), S. 173-180.
Jürgen Petersohn, Jubiläumsfrömmigkeit vor dem Jubelablaß. Reliquientranslation und
‚remissio‘ in Bamberg (1189) und Canterbury (1220) in: Deutsches Archiv zur Erforschung des
Mittelalters 45(1989) S. 32-53.
Paul Gerhard Schmidt, Das römische Jubeljahr 1300 (=Sitzungsberichte der
Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Gothe-Universität Frankfurt 38,4)
Stuttgart 2000.
Ludwig Schmugge, 1413 – Das vergessene Heilige Jahr, in: Hagen Keller (Hg.), Italia et
Germania, Festschrift für Arnold Esch, Tübingen 2001, S. 191-198.
Antonio Serrano, Die Heiligen Jahre, Dachau 1999.
Heribert Smolinsky, Jubeljahr II in TRE Bd 17, Berlin 1988, S. 282-285.
Carl Stange, Der Jubelablaß Bonifaz‘ VIII. in Dantes Commedia, in: Zeitschrift für
Kirchengeschichte 63 (1950/51), S. 145-165.
Nikolaus Staubach, Romfahrt oder Selbsterfahrung? Der Jubiläumsablass im Licht
konkurrierender Kirchen- und Frömmigkeitskonzepte, in Ders., Rom und das Reich vor der
Reformation, Frankfurt 2005, S. 251-270.
Johann Vincke, Der Jubiläumsablass von 1350 auf Mallorca, in: Römische Quartalschrift
41(1933), S. 301-306.
Ders., Zur Frühgeschichte der Jubiläumswallfahrt, in: Georg Schreiber (Hg.), Wallfahrt und
Volkstum in Geschichte und Leben, Düsseldorf 1934, S. 243-257.
Ders., Zum Jubiläumsablass des Jahres 1350, in: Römische Quartalschrift 49 (1954), S. 251-
255.
Anton de Waal, Das heilige Jahr in Rom, Münster 1900.
Andrea Weinmann, Sola fides salvat rusticum – Das Heilige Jahr 1500 aus der Sicht des
päpstlichen Zeremonienmeisters Johannes Burckardus, in: Nikolaus Staubach (Hg.), Rom und
das Reich vor der Reformation, Frankfurt 2004, S.237-249.
Josef Wicki, Das Heilige Jahr 1575 in den zeitgenössischen Berichten der Jesuiten: Archivum
historiae pontificiae 13(1975) S. 283-310.
Kurt Josef Wecker
Ihr seid das Licht der Welt –
Martin von Tours – eine Lichtgestalt des Glaubens
Betrachtung von Kurt Josef Wecker, Pfr.
Martin hatte vor 1708 Jahren Geburtstag, er starb vor 1627 Jahren. 81 Jahre wurde er alt, sehr alt für seine Zeit. So lange ist das her! So fern ist er und doch so nahe! Damals brachte Martinus Licht in diese Welt.
Hergarten und Abenden haben ihn als Pfarrpatron, in unseren Gemeinden wird er in Martinszügen geehrt (seltsamerweise nicht in Frankreich, wo er doch beheimatet ist). Im Mai bin ich mit einigen Gemeindegliedern nach Tours an der Loire gepilgert; wir haben das Grab dieses Bischofs in der Krypta seiner Kirche besucht, dort die Messe gefeiert und „Sankt Martin, Sankt Martin …“ gesungen.
Zu den Patrozinien in Abenden am Vorabend (10.11. um 18.00 Uhr) und am Montag 11.11., also dem eigentlichen Martinstag, um 18.00 Uhr in Hergarten, lade ich herzlich ein.
In Nideggen ist am 10.11. um 9.30h ein Kinder- und Familiengottesdienst zum Martinstag.
Vor den Martinszügen in Vlatten (7.11. 17.30h), auch in Berg (8.11. 18:00h) oder Schmidt (11.11. 17:45h) sind zuvor kleine Wortgottesdienste zur Einstimmung geplant.
Das Motto der nächstjährigen Erstkommunion „Ihr seid das Licht der Welt!“ erinnert an die leuchtenden Laternen am Martinstag, die unsere Kinder als „Kinder des Lichtes“ basteln und damit dem hl. Martin hinterherlaufen. Alles für einen fernnahen Heiligen! Manchmal stocke ich: Ist das, was wir über ihn erzählen, nur ein schönes Wintermärchen, bloß eine schöne heilige Szene, von Kindern aufgeführt, nur das Sinnbild für ein gutes Werk, die Illustration des Jesusgebotes, Nackte zu bekleiden? Ist Martinus nur eine schöne Lichtgestalt im sinkenden Jahr, ein liebenswürdiger Vorbote des Advents, der folgenlos durch das Kirchenjahr wandert und abwandert...?
So ein Getöse, so viel „Jedöns“ um ein geteiltes Textil? Die folgenreiche Kleiderspende für einen Bettler im nordfranzösischen AEine Mantelhälfte, die keinem so richtig hilft! Die keinem von beiden steht?
Jedöns um einen Mantelfetzen, der nur noch für die Altkleidersammlung taugt, bestenfalls! Und doch kommt uns ein Heiliger nahe, der nicht nur in diesem einen Augenblick – der das Gewicht der Ewigkeit hatte – seine Körperwärme, sein Herzblut mit einem Fremden teilte.
In dieser unscheinbaren und doch faszinierenden Szene vor dem Stadttor im winterlichen Amiens leuchtet die Wahrheit eines ganzen Lebens auf. Da gab es einen, der sich selbst ein Leben lang 'gab' und verteilte: seine Wärme, seinen Glauben, sein Zeugnis, seine Wunder, sein Ansehen. Genau das ist ein Heiliger, der zugleich auch ein beinharter Asket war, ein „Gefäß Gottes“: einer, der den heiligen Gott in Wort und Tat nachahmte und durchscheinen ließ. Ja, das galt für diesen Soldaten Gottes: „Ohne Kampf keine Krone“. Das galt auch später für diesen Parade-Asketen, einen „miles Christi“, der mehr war als nur Mantelteiler; er, der im Jahre 361 das erste abendländische Kloster schuf und sich im Kampf gegen die heidnischen Götterstatuen, Kultplätze, heiligen Bäume und Tempel auch 'martialisch' und religiös 'intolerant' zeigte, der im Kampf um die Freiheit der Kirche vom Staat, in Trier vor dem Kaiser, sich auf die Seite des in der Lebensform ihm durchaus ähnlichen Bischofs Priszillian von Ávila stellte und angesichts des kaiserlichen Todesurteils über diesen Mann in Trier im Jahre 385 unterlag. Martinus war kein genialer Rhetor, Schriftsteller, kein einflussreicher Kirchenbeamter. Er war Bischof wider Willen (die Gänse verrieten ihn in seinem Versteck), kein kirchlicher Karrierebeamter. Es ist bezeichnend, dass er befürchtete, in seinem Bischofsstand seine Fähigkeit zu heilen und seine Wunderkraft zu verlieren. Darum blieb er auch als Bischof Mönch und Eremit.
In seinem langem Leben wurde ein Moment besonderer Dringlichkeit zur Schlüsselstelle seines Lebens - diese Lichtsekunde in winterlicher Zeit in der Garnisonsstadt Amiens wohl im Jahre 335.
Martinus ist ein Heiliger, der mich bewegt, im Herbst Lebensbilanz zu ziehen. Was habe ich verpasst und übersehen? Was kann ich noch nachholen, gut machen? Die Mantelteilung war buchstäblich ein Schnitt, ein 'Cut', ein einzigartiger und unwiederbringlicher Einschnitt im Leben. Ja, das Leben ist wie ein gewobenes Tuch, wie mit einem Schwert wird es geteilt. Martins Leben wurde durchkreuzt, so wie der Soldatenmantel von einem scharfen Stahl-Schwert zerschnitten wurde.
Vielleicht wird es in unser aller Leben einmal so sein, dass uns ein bestimmter Augenblick wie ein Standbild im Jüngsten Gericht gezeigt wird: eine Weichenstellung, wo das Profil meines Lebens hervortrat und ans Licht kam, wer ich war oder hätte sein können, wo ich gerührt oder ungerührt vorüberging, versagt habe oder das einzig Richtige tat. Ein Augenblick, als ich über meinen Schatten sprang und etwas von mir herausrückte - um eines anderen willen... Es werden womöglich Momente sein, wo ich vielleicht gar nichts Besonderes gemacht haben, nur das, was sich eigentlich gehört. Das waren Lichtsekunden, wo ich 'nur' stehengeblieben bin, nur genau und lange genug hingeschaut habe und mich erschüttern ließ, wo ich merkte: Nur ich bin jetzt gefragt, unersetzbar, unaufschiebbar; nur ich kann spontan helfen. Es verschlägt mir die Sprache, ich kann den anderen nicht mit billigem Rat abspeisen oder mir keine gute Ausrede zurechtlegen, die da lauten könnte: „Da kann ja jeder kommen; man kann sich schließlich nicht um jeden und alles kümmern; ich habe meine eigenen Probleme. Ich bin unter Zeitdruck...“
Wie fühle ich mich, wenn ich mich zu einer solchen guten Tat wie einer Mantelteilung hinreißen lasse? Bin ich über mich selbst überrascht und gerührt, weil ich mir das gar nicht zugetraut hätte, weil ich mich selbst darin nicht wiedererkenne. Bin ich glücklich, froh, eine wenig seelisch und moralisch gestärkt durch diese erbauliche Leistung, ohne großes Nachdenken etwas losgelassen zu haben, eine gute Tat verrichtet zu haben?
Hätte ich doch den Mut, den Blick, das Herz, die Hand dieses Martin! Werde ich je die geheimnisvolle Paradoxie des Glaubens verstehen; dieses: „Wer teilt, gewinnt“; dieses: „Wer nimmt, verliert“; dieses „Man behält nur, was man hergibt“. …?
Wann werde ich dieses Geheimnis des Glaubens, diese Mathematik des Himmels verstehen: „Wer andere groß macht, wird dabei nicht klein, der verdoppelt den Mantel...“?
In meiner Kindheit in Mönchengladbach kannten wir keine Sternsingeraktion; stattdessen gingen wir am Martinsabend, nach dem Zug zum Martinsfeuer, von Haus zu Haus. Da hieß es noch nicht im Halloween-Sound: „Süßes oder Saures“, doch ebenso dringlich, fast drohend:
Hier wohnt ein reicher Mann
der uns vieles geben kann.
Vieles kann er geben, lange soll er leben,
selig soll er sterben,
das Himmelreich erwerben.
Lass uns nicht so lange stehn,
denn wir müssen weitergehn, weitergehn.
„Wir sind Bettler, das ist wahr!“ Das sollen die letzten Worte Martin Luthers gewesen sein, der am Martinstag, dem 11.11.1483 auf den Namen des Tagesheiligen in Eisleben getauft wurde.
Wir sind Bettler, wir betteln um mehr Licht in dieser zwiespältigen und von Krieg und Kälte gequälten Welt, um Menschen, die stehenbleiben und helfen und um die Geistesgegenwart, selber stehenzubleiben und zu helfen.
Einen lichtvollen November wünscht
Kurt Josef Wecker
Erntedank – Nichts zu danken?!
Betrachtung zum Oktober von Kurt Josef Wecker
„Ich würde ja gerne danken, ich weiß nur nicht wofür…“, so ähnlich soll die hl. Elisabeth von Thüringen reagiert haben, als man sie mit ihren Kindern aus der Wartburg warf und sie sich in der Gosse von Eisenach wiederfand – ein Bündel voll schreiendem Elend. Wofür Gott danken? Manchen fehlen die Worte der Dankbarkeit; vielleicht ist der Adressat des Dankes verblasst. Ratlos und sprachlos erlebt sich selbst eine Heilige wie Elisabeth an einem Tiefpunkt ihres Lebens. Zu viele Dank-Tage? Am 3. Oktober sollten die Deutschen dankbar sein für die Wiedervereinigung, zu Erntedank für die Ernte. Der meteorologische Herbstbeginn läutet die Zeit der Bilanz ein, legt mir den Dank für das Geschenk des endlichen Lebens nahe. Erntedank – da können wir uns vor Gott eingestehen, wie schwer uns das dankbare und aufmerksame Leben fällt – dies auch angesichts üppig aufgerichteter Erntedanktische und -körbchen, die sinnenfroh vor dem Altar mancher Kirchen drapiert sind. Erntedank ist mehr als nur religiöse Folklore. Die Lebensernte, anschaulich und unsichtbar, aber auch manche Mangelerscheinungen sollen heute ins Herbstlicht, nein - in Gottes schöpferisches Gegenlicht hineingehoben werden.
Ich wünsche uns, dass wir alle einen sehr konkreten, urpersönlichen Grund haben, „Gottseidank“ zu sagen. Gottseidank – das ist ein wunderliches Kompositum. „Gottseidank“ (2 Kor 9,15), dass wir auferstehen dürfen und können. Danke, dass wir denken, nach-denken können, dass wir allen Grund haben, wohltuende Erfahrungen und Begegnungen hineinzulegen in den Erntekorb. Unsere Erntedank-Ensembles vor den Altären verdeutlichen: Ein wenig von unserem Überfluss fällt ins Auge – pure Natur und durch unsere Hände gegangene kultivierte Natur. Leicht verderbliche Ware mit Verfallsdatum, „die bunte Gnade Gottes“ (1 Petr.4,10). Wir zeigen uns heute vor Gott mit kleinen Zeichen für das, was uns kostbar und wichtig ist. Und wir gratulieren dem Schöpfer: Gott das hast du gut gemacht! Dankeschön sagen wir für das, was unfassbar ist wie die frische Luft und was mir nie selbstverständlich werden darf. Für etwas, was mich überwältigt hat oder was in mir ein flüchtiges Aufatmen hervorrief. Womit habe ich verdient, dass ich ‚Früchtchen‘ da bin, dass mir dieses Glück widerfuhr, dieser Mensch begegnet ist, dass ich aus dieser brenzlichen Situation so glimpflich und mit heiler Haut davonkam, dass ich das Verlorengegangene oder schon verloren Gegebene wiederfand? Es hätte ja auch ganz anders kommen und ausgehen können! Mit so mancher glücklichen Wendung war nicht zu rechnen. Oder mit der Wohltat, dass mir – trotz allem – Vertrauen geschenkt und mir – wider Erwarten – vergeben wurde!
Ja, es gibt Glücksmomente und Widerfahrnisse, dafür kann ich mich bei keinem Menschen bedanken. Da suche ich einen ganz anderen Adressaten, den ich mit meinem Gebet umarme. Wem anders als Gott kann ich Danke sagen dafür, dass ich Geschöpf bin und bleibe, auch wenn mir die ‚Selbstoptierung‘ nicht gelingt?! Wohin soll ich mich wenden, wenn ich dankbar wahrnehme, dass ich da bin, mich tagtäglich entgegennehme aus seiner Hand, dass mir immer noch, immer wieder Lebenszeit geschenkt wird? Dass es diese Welt gibt, auf der die Ernten wachsen und reifen? In wachen Augenblicken geht mir auf: Nein, ich bin nicht der große Macher; ich bin mir geschenkt, beschenkt mit mir selbst, auch mit meinen Talenten, meiner Phantasie. Ich wurde mir zugeeignet und durfte Fuß fassen auf ‚Schwester Erde‘. Erntedank - Denk dein Leben als Geschenk, als Zueignung. Ich habe ein Zuhause, eine Heimat und muss sie mir nicht erst erobern. So sehr ich für mich verantwortlich bin, gilt umso mehr: Für mich ist gesorgt. Diese Selbsterfahrung ist verwandt dem Bekenntnis: Ich bin Geschöpf, ich bin nicht Herr meiner selbst, meiner Welt, meiner Ernten. Zwar gilt: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Aber die andere, die gnadenvolle Wahrheit gilt genauso: Ich bin ein Bedürftiger und darf sogar ernten, wo ich nicht(!) gesät habe. Gracie!
Wir blicken hinein in den womöglich phantasievoll ausstaffierten Altarraum und nehmen darin die Spuren dessen wahr, der diese Resultate seiner Einfallskraft - und uns als seine Geschöpfe – ins Werk gesetzt hat. Die Erntegaben sind vielfältige Liebeserklärungen Gottes an uns, die wir mehr sind als Endverbraucher, Wir dürfen auch Genießer sein! Ja, wir dürfen die Erntegaben kultivieren und genüsslich verzehren. Wir wollen die Natur würdigen als Gottes Kunstwerk. Auf unseren Lippen, in Liedern und Gebeten outen wir uns und machen den Dank hörbar. Der Dank ist mehr als ein diffuses Gefühl. Dank stellt sich ein, wenn ich entdecke, dass ich mein Leben nicht in der Hand habe, dass ich von guten Mächten umgeben bin; dass es ein für die Geschichte Mitteleuropas ungewöhnliches Wunder ist, dass wir 85 Jahre nach Kriegsausbruch so lange in Friedenszeiten leben dürfen – ein fragiler Friede, wie der nahe Krieg in der Ukraine zeigt.
Womöglich macht sich weniger der ‚Geist der Dankbarkeit‘ als vielmehr ein Gefühl des Unbehagens in unserem Gotteshaus breit. Erntedank wirkt wie eine unzeitgemäße Tugend, die man neu polieren und zum Strahlen bringen muss. Wofür Dank sagen in einer Welt der Dienst-Leistungen, auf die ich Anspruch anmelde?
Viele kennen eine tiefe Dankbarkeit, die gar nicht an (einen) Gott glauben. Niemand, auch kein Gläubiger, ist von der Krankheit der Undankbarkeit, der Verbitterung, der Gleichgültigkeit, der Vergesslichkeit gefeit.
Es wird manche Zeitgenossen auch in unseren Pfarrgemeinden geben, die nicht sagen könnten, wem und worum sie – beim besten Willen – danken sollten. Menschen kommen in die Gottesdienste oder zur Marienwallfahrt, denen zum Klagen und Bitten, zum Suchen und Fragen, Schweigen und Trauern zumute ist, aber eben nicht zum Dankgebet. „Nichts zu danken“, sagen wir zuweilen beinahe abwehrend.
Wir müssen respektieren, wenn unter uns Menschen sind, die nicht genau wissen, an wen sie ihren Erntedank richten sollen und deren Leben eben keine einzige große Danksagung ist. Was, wenn unser Dank ins Leere ginge? Wenn ich meine Fähigkeit zu staunen verloren hätte? Es mag Gemeindeglieder geben, die können nur ihre Lippen bewegen zu unseren Erntedankgebeten, doch sie können beim besten Willen nicht für sich und ihr Dasein dankbar sein; oder es fällt ihnen niemand ein, für den sie dankbar sind. Es ist ein Wunder, wenn ich danken kann!
Auch Zeitgenossen, denen das Glauben schwerfällt, atmen dankbar auf: „Da habe ich noch mal Glück gehabt“. „Wie habe ich das nur geschafft…?“. „Womit habe ich das verdient…?“.
Verordneter und erzwungener Dank ist eine giftige Sache. Mir steht es nicht zu, Sie und Euch auf Erntedank hin zu trainieren, zu einem ‚Dankopfer‘ zu zwingen und zu vermitteln: „Nun bedankt euch gefälligst!“ - oder Ihnen mit pädagogisch drohendem Zeigefinger nahezulegen: „Du musst (Gott) dankbar sein!“ Was für eine seltsame Mixtur von Frömmigkeit, Zucht, Zwang, Vorwurf, eingeschliffenen Ritualen und erzwungenen Verhaltensmustern wäre das. Der Satz „Du sollst danken“ ist nicht das elfte Gebot, keine pflichtschuldige Floskel. Mein „Merci“ wächst spontan aus einem bewegten Herzen, dem das Leben nicht selbstverständlich ist.
Das wäre Erntedank: Mir fallen Menschen ein, für die ich Gott danke. Du bist dankenswert! Dankeschön, Gott, für den liebenswerten, aber auch für den schwierigen Anderen! Zu guter Letzt wollen wir dem danken, der seine Gnade auch dem Undankbaren schenkt und dem, welchem nicht nach Erntedank zumute ist. Gott ist auf meinen Dank nicht angewiesen und freut sich doch, wenn mein Herz Resonanz gibt. Danke, Gott, dass du da bist, einfach so …
Ihnen und Euch einen gesegneten, goldenen Oktober
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Christus triumphiert über den Tod in seinem Tod
Das Fest „Kreuzerhöhung“ und der „erhöhte“ Christus in der Pfarrkirche St. Johann Baptist
Betrachtung von Kurt Josef Wecker
„Triumphkreuz“, so nennen wir das große Kreuz, das vielleicht um 1220 entstand und nun bereits wieder nach gründlicher Restaurierung in der am 13. Oktober 2024 in der ebenfalls ‚rundumerneuerten‘ St. Johannes-Baptist-Pfarrkirche in Nideggen hängt. Es entstand im Hochmittelalter, im Übergang von der Romanik zur Gotik. Haupt, Rumpf und Beine des Christuskörpers sind Original; die Dornenkrone und die Arme wurden 1955 ergänzt, auch das wohl verlorengegangene Auflagekreuz mit den auffallenden Kreuzenden wurde erneuert. Damit ist diese hölzerne Plastik - vermutlich aus Lindenholz - aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts wohl das älteste und kostbarste Holzkreuz unserer GdG.
Am 14. September feiert die Kirche das Fest „Kreuzerhöhung“.
Unmerklich für die Augen der Öffentlichkeit, wurde das alte Kreuz bereits im Juli wieder – nach gründlicher Reinigung und Festigung - an einen zentralen Ort in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Nideggen zurückgeführt und „erhöht“. Hoch oben hängt es an seinem angestammten Platz über dem „Triumphbogen“, dem Langhaus/ Mittelschiff zugewandt, ein wenig tiefer als vor der Restaurierung, doch immer noch – erhöht, nun unberührbar, fast den Augen entzogen, und so, dass wir unseren Kopf in den Nacken zurücklehnen müssen, um zu ihm aufzublicken. Man könnte dieses Holzkreuz fast übersehen. In isolierter Position hängt Er dort oben und ermöglicht keinen Nahkontakt. Dieses Kreuz kann auch nicht am Karfreitag verhüllt und in die liturgische Handlung einbezogen werden. Doch ER beherrscht den Raum. Ein Triumphkreuz ist auf Entfernung angelegt, entweder wie in Nideggen oder (wie in vielen anderen Kirchen) auf einem Balken im Triumphbogen, auf einem Lettner. Unsere Blicke fallen zunächst auf die Apsis, auf das Fresko mit der „Maiestas Domini“, dem wahrhaft herrscherlich thronenden Christus, ein Gemälde, das fast eine ähnliche Entstehungszeit hat wie der Crucifixus. Das Triumphkreuz und die Maiestas Domini erinnern an die von Osten her erwartete Wiederkehr des richtenden Christus (vgl. Mt 24,30).
Die Aufhängung des Kreuzes an einem markanten Schnittpunkt im Kirchenraum, diese hoheitliche Höhe, macht auch das Triumphale dieses Gekreuzigten aus. Ein seltsamer Triumph! In Wahrheit ist der Triumph Christi in dieser Darstellung ganz tief verborgen. Christus triumphiert über dem Tod in seinem Tod. Hoheit in der Niedrigkeit. Es gibt riesige Triumphkreuze. Christus in Überlebensgröße. Der Corpus des hiesigen Christus crucifixus ist lebensgroß: 170 cm. Manche Kirchenführer bezeichnen das Nideggener Kreuz als „romanisches Triumphkreuz“. Doch dieses Triumphkreuz nimmt eine Mittelstellung zwischen Romanik und Gotik ein, ist eher eine Darstellung des Gekreuzigten, die durch den Wandel der Frömmigkeit und des Christusbildes in der Gotik verursacht wurde, und entstand in der Phase des Hochmittelalters, als die bildende Kunst Abstand nahm vom aristokratischen Christus victor, dem Siegerchristus, dem „Rex triumphans“, dem triumphierenden Christuskönig, dem Christus coronatus, der eine Herrscherkrone trug. Viele kennen das Gerokreuz aus dem Kölner Dom (um 965), das zwar aus der romanischen Epoche stammt, aber keinen triumphierenden Christuskönig zeigt. Dem zu Tode erschöpften „Christus patiens“ des Nideggener Kreuzes mit seinen drastisch dargestellten Wunden sieht man das gewaltsame Sterben an. Der leidende Erlöser und Schmerzensmann hat ausgelitten. Die durch den Lanzenstich nach dem Tod Jesu verursachte Seitenwunde ist überdeutlich erkennbar; Jesu Blut quillt hervor. Die Augen des Herrn sind zwar halb geöffnet, doch der Blick ist gebrochen: Christus im Augenblick seines Dahinscheidens. Der Kopf des Gekreuzigten ist ein wenig nach rechts geneigt. Blutspuren finden sich auf der Stirn. Der Mund ist nach dem Aushauchen des Lebens leicht geöffnet. Wir erkennen aus der Nähe die Rippenzüge, Jesu ovales, bärtiges Gesicht, die Nägel in den offenen Handtellern mit den stark blutenden Wunden, die auf den Schultern aufliegenden längeren Haare. Dieser Christuskönig trägt keine Königskrone, sondern eine (nach der Restaurierung behutsam kolorierte) Dornenkrone; sie ist Christus tief aufs Haupt gedrückt. Die Passionsreliquie der Dornenkrone wurde damals sehr verehrt und findet sich gehäuft ab 1220 auf den Kreuzigungsdarstellungen. 1239 erwarb König Ludwig IX. von Frankreich diese Reliquie in Konstantinopel. Jesus auf dem Kreuz in Nideggen trägt kein hohepriesterliches Gewand, keine Tunika (wie auf vielen romanischen Darstellungen), sondern einen bis zu den Knien reichenden, in königlichem Rot gehaltenen, blau gesäumten Lendenschurz, der rockartig bis zu seinen Knien reicht, gestaltet mit kunstvoll geschnitzten Quer- und Längsfalten. Der schlanke Corpus hängt frontal gestreckt und nicht gekrümmt am Kreuz. Die Darstellung der Schmerzen dieses Christus dolorosus/ Christus patiens ist zurückhaltend. Unsere räumliche Distanz zu diesem Holzkruzifix erschwert das Mitleiden, die ‚compassio‘ - die Aufforderung zu meinem Mitleid klingt eher verhalten an. Die erlittene Passion wird nicht dramatisch zur Schau gestellt. Jesu Füße stehen nicht – wie bei den romanischen Kreuzen - parallel nebeneinander auf einem Suppedaneum; im romanischen „Viernageltyp“ werden die Füße mit zwei Nägeln am Kreuzbalken festgenagelt. Die Füße des Christuscorpus von Nideggen werden nicht gestützt durch ein Fußbrett, sondern sind übereinandergelegt; mit einem einzigen Nagel sind sie an den Kreuzbalken geschlagen („Dreinageltyp“). Solch eine Wiedergabe des Kreuzigungsvorgangs steigert die Schilderung des Leidens Christi, ist wohl historisch zutreffend und wird auch vom Christusnegativabdruck auf dem Turiner Grabtuch bezeugt. Wir kennen nicht das Aussehen des ursprünglichen Nideggener Kreuzbalkens. War er kostbar geschmückt (crux gemmato) oder einem Lebensbaum nachempfunden (Lignum vitae)? Doch der Leib Jesu ‚braucht‘ das Auflagekreuz; er hängt am Balken, er steht nicht souverän, er schwebt nicht majestätisch quasi vor dem Balken.
Nur wenige konnten diesen nun wieder so unerreichbar „erhöhten“ Christus im Atelier der Restauratorin und bei der erneuten Aufhängung aus der Nähe betrachten und auf die edlen Gesichtszüge und in die - nun weit entrückte - klaffende Seitenwunde Jesu hineinblicken. Wer sich dem Christusleib aus der Nähe ausgesetzt hat, wurde durch die expressive Gestalt und die Details des Corpus erschüttert. Nur aus der Nähe fallen die Rotzeichnung der Lippen, die Lidränder, die Augenbrauenbögen, die Blutmale auf. Dankbar sind wir, dass wir dieses Kreuz so gut restauriert wiedererhalten haben. Doch sehen wir darin mehr als ein wunderbar konserviertes ‚Kunstdenkmal‘! Christi Opfertod strahlt aus. Gekreuzigte Liebe! Man spürt die suggestive Präsenz des Gekreuzigten. Sein brechender Blick sucht mich. „Die „Stunde“ (Joh 7,30) des Heils hat geschlagen. Wir werden gefühlsmäßig mitgenommen, das Leiden Christi nachzuempfinden. Das lateinische Original des Passionsliedes „O Haupt voll Blut und Wunden …!“ („Salve cruentatum“) entstand ungefähr zur Entstehungszeit dieses Crucifixus. Jesus, wo sind die Zeichen deines Sieges? Wir halten das ‚Hängen Christi‘ über uns aus. Was für eine Kreuzerhöhung! Die Gottesdienstgemeinde steht unten im Kirchenschiff, wie damals Maria, Johannes und das gaffende, betroffene oder an der Kreuzigung mitwirkende Volk. Die Gemeinde findet sich im Kirchenschiff wie auf dem „volkreichen Kalvarienhügel“ ein, und wir feiern auf dem Altar das Geheimnis von Golgotha.
Wie die Frauen am Karfreitag blicken wir aus der Ferne auf Ihn, rufen aus der Tiefe zu Ihm. Was für ein Anblick: Der tote Christus am Kreuz! Im tödlich verletzten Menschen aus Fleisch und Blut will Gott mir begegnen.
Ist der Corpus Christi zum Mitansehen? Vielleicht halten wir lieber Distanz zum Kreuz. Es ist kein schönes Zeichen für ungebrochene Ganzheit, Vitalität und schnelles Glück. Der Karfreitag ist keine Etappe der Heilsgeschichte, die ja eigentlich durch Ostern hinter uns liegt. Wir müssen die permanente Präsenz des Gekreuzigten über uns aushalten und sind „Gäste des Gekreuzigten“ (Ernst Käsemann). Ohne dieses Kreuzzeichen fehlte der Freude des Glaubens der letzte Ernst. Wir müssen uns das Wort vom Kreuz anhören und den Corpus crucifixus anschauen. Erhebt euer Haupt! Sucht ihn, blickt nicht weg! So viel hat Gott unsere Erlösung ‚gekostet‘. Wir brauchen Karfreitag und Kreuzerhöhung und solche Glaubenszeugnisse, damit wir nicht vergessen, auf welche Welt sich der Menschgewordene erlösend eingelassen hat.
Schau her! So heißt es in vielen Passionsliedern. Schaut hoch! Kommt und seht!
Einen guten Spätsommer im Schatten des Kreuzes wünscht
Ihr/ Euer
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Christi Himmelfahrt
Betrachtung zum Gemälde von Pieter Coecke van Aelst, entstanden 1542 in Antwerpen, jetzt im Stadtmuseum Simeonstift Trier.
Christus ist nicht zu halten! Ein vorübergehender Augenblick, den der flämische Renaissancemaler Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) und seine Werkstatt wohl im Jahre 1542 in Szene setzen. Nur eine Momentaufnahme, die Visualisierung des Bibelverses aus der Apostelgeschichte 1,9, der Augenblick eines Ortswechsels Jesu. Und wir sind mitten drin, haben keinen distanzierten Zuschauerplatz. Das Geschehen des Himmelfahrtstages können wir uns genauso wenig vorstellen wie das Ereignis der Auferweckung des Gekreuzigten. Das Gemälde ist ‚nur‘ ein Versuch, das Unanschauliche anschaulich zu machen. Das hochformatige, beinahe pyramidenförmig aufgebaute Bild mit dem steilaufragenden moosbedeckten Felshügel reißt uns in eine gewaltige Aufwärtsbewegung und in das emotionale Gefühlschaos einer ‚hinterbliebenen‘ Kirche hinein, der die Himmelfahrt ihres Herrn buchstäblich über den Kopf wächst. Im unteren Teil des Gemäldes sehen wir das Bild einer Kirchenkrise: Kirchenmänner, beschwert von der Schwerkraft; erdenschwere Menschen in der Tiefe, sprachlos vor dem, was sich in der Höhe vollzieht. Stellen wir uns den Ort des Ereignisses vor! Die Zurückbleibenden stehen auf dem Ölberg oder bei Bethanien (Apg 1,12 und Lk 24,50). Im Tiefenraum des Gemäldes ist eine Fernlandschaft, eher eine flandrische Stadt am Fluss als die Silhouette von Jerusalem, erkennbar. Meisterhaft versteht es der Künstler, das subjektive, psychologische Erleben der Jüngergruppe darzustellen, die Auswirkung Seiner Erhöhung, den - biblisch allerdings nicht überlieferten – Trennungsschmerz, die Bitte um Nähe. Ja, unsere Blicke werden von unten nach oben gezogen. Dorthin ist er unterwegs. „A-dieu“, Jesus! Geh zu Gott, deinem und unserem Vater! Doch das göttliche Woraufhin, auf das alles hinausläuft, bleibt jenseits des Bildes. Das Mysterium bleibt gewahrt. Die Wolke entzieht Jesus unseren Blicken. Sie erinnert an die Verborgenheit Gottes, in die der Sohn heimkehrt, an das unzugängliche Licht (1 Tim 6,16; Kol 3,3), in das der Auferstandene wie auch der Verklärte eintaucht. Weder die Jünger noch wir sehen das Ziel dieser Hinaufbewegung Jesu. Christus wird emporgehoben von diesem auffallend herausragenden Felsen, und die Jünger, zusammengedrängt und aufgeregt gestikulierend am Fuße des Felsens, haben das Nachsehen.
Einige dieser Himmelsgucker blicken gebannt auf die Fußsohlen des ‚in der Luft hängenden‘ Christus und den unteren Teil seines Gewandes. Der Herr entfernt sich. Uns wird nur der entschwindende Christus gezeigt, nicht das „Haupt“ Christi, nicht die Maiestas Domini oder das Platznehmen des Erhöhten zur Rechten des Vaters (Mk 16,19). Dieser von dem flämischen Künstler gewählte Typus der Himmelfahrtsikonographie ist seit dem 11. Jahrhundert bekannt und besonders in der Renaissancezeit verbreitet: Den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Betrachtern dieses Bildmotives war vielleicht der liturgische Brauch vertraut, am ‚Auffahrtstag‘ eine Christusfigur mit einem Seil durch ein Loch in der Kirchendecke verschwinden zu lassen. Mit den Jüngern sehen wir den Füßen des Herrn nach, die bald in der Wolke ‚stecken‘: Eine ungewollte Komik, Ausdruck der durchaus gekonnt inszenierten Hilflosigkeit, die Erhöhung des auferweckten Christus ins Bild zu setzen. Er – am Rand des Verschwindens. Ein transitorischer Moment: Gleich werden auch diese Füße verschwunden sein. Die von Maria aus Betanien gesalbten (Joh 12,3), die von den Salbfrauen nach Ostern verehrten Füße Jesu (Mt 28, 9) sind das Wenige, das von Ihm gerade noch sichtbar ist. Dieses Motiv ist Ausdruck der österlichen Grenzüberschreitung: ER überragt jedes Bild, das man sich von Ihm macht. Und darum ist das etwas unbeholfen wirkende Detail des Corpus Christi zutiefst sachgemäß. Himmelfahrt ist ein Fest, das unser Fassungsvermögen übersteigt, weil Er nicht zu fassen ist. Die Wolke (Mk 9,7) verbirgt ihn.
Fortan ist Christus der Verborgene, der wunderbar Fernnahe. Wir wenden uns von den Füssen Jesu ab und schenken unsere Aufmerksamkeit der leidenschaftlich bewegten Apostelgruppe, ihrem Staunen über das Widerfahrnis, ihrer Klage, ihrer Melancholie, ihrer Fassungslosigkeit, ihrer Überforderung. Sie leiden unter Entzugserscheinungen. Jeder der Jünger zeigt, je nach Temperament und Gefühlslage, seinen Schmerz anders. Heftige emotionale Bewegungen und Gesten bringt der Antwerpener Manierist in Szene. Die Apostelköpfe unterscheiden sich physiognomisch voneinander. Wir sehen keine zum Segen erhobenen Hände Jesu, sondern die ins Leere gehenden Arme ratlos gestikulierender Jünger. Was gibt es heute zu feiern? Ein Abschied, dem die frühe Kirche unter Schmerzen beiwohnt. Bedenken wir: ‚Eigentlich‘ haben die Jünger bereits den Segen des Herrn hinter sich, und trotzdem bleiben sie verstört zurück. Noch sind keine Engel zu sehen, die das Erstarren der „Viri Galilaei“ zu Salzsäulen auflösen und den verheißungsvollen Trost zusprechen werden.
Wir Betrachter sind im Bilde, werden hineingezogen in den Moment des Entschwindens Christi. Findet sich darin unsere zum Himmelfahrtsfest versammelte Gemeinde wieder? Das Fehlen der Engel (Apg 1.10f) irritiert. Wo sind sie, die Boten des Himmels, die weiß gekleideten Deuteengel, die trösten, neue Wege weisen und dieser Abschiedsszene einen Drehpunkt hinein in die Freude geben? Diese Gesandten des Himmels sind nicht im Bilde. Doch kämen diese Verkündigungsengel nicht dazu, dann bliebe der Kirche zu guter Letzt nur der wehmütige Blick auf den entschwindenden Christusleib. Nur von außen kann der Stimmungswechsel bewirkt werden. Freude können wir uns nicht einreden, sie muss uns von anderswoher nahegelegt werden. Können wir uns freuen, dass Er die Schwerkraft überwindet und nun frei ist von dem, was uns auf Erden festhält? Gönnen wir ihm, dass er nun die Perspektive des Himmels gewinnt und den Überblick hat? Wünschen wir uns das auch zuweilen, einfach in eine Wolke abtauchen und entschweben zu können? Ohne die von den Engeln bewirkte Blickwendung stände die Kirche verlegen und ratlos vor dem Fest des „Auffahrtstages“; und die Welt machte sich am ‚Vatertag“ einen eigenen banalen Reim aus dem Mysterium.
Maria ist unter den Aposteln. Ihr häufiges Dabeisein auf den Himmelfahrtsdarstellungen verdankt sich der frommen Vorstellungskraft der Maler, da die Apostelgeschichte erst nach der Erhöhung Jesu die Präsenz der Gottesmutter im Jüngerkreis bezeugt (Apg 1,14). Maria als Betende, in feierlichem Stille-Sein angesichts dieser gewaltigen Aufwärtsbewegung, kniend, wehrlos, selbstvergessen, gefasst, in ‚ernster Freude‘, wunderbar aufmerksam. Sie ist der ruhende, andächtige Pol, dargestellt mit auffallend bleichem Inkarnat. Sie nimmt sich auch in ihren Emotionen zurück. Inmitten der nach Verstehen suchenden, streitenden Kirche‘ bleibt sie das Sinnbild der schon vom Geist Christi erfassten, anbetenden Ecclesia. Sie ist diejenige, die die Erhöhung ihres Sohnes innerlich mitvollzieht, seine Erhöhung geschehen lässt, seinen Segen empfangen hat. Sie erkennt: „Alles hat er (der Vater) unter seine Füße gelegt“ (Hebr 2,8; 1 Kor 15,27).
Das Evangelium betont die freudige Rückkehr der Jünger nach Jerusalem (vgl. Lk 24,52), die uns Hörer des Wortes eher in Erstaunen versetzt. Der Künstler akzentuiert – vielleicht wirklichkeitsnäher – die Trauer in der Abschiedsstunde, den Schmerz aufgrund der Entfernung Jesu. Das biblische Ostern kam ganz ohne Halleluja aus: Wir hören von Frauen auf der Flucht, sich isolierenden Aposteln, einer verweinten Maria Magdalena, sich depressiv dahinschleppenden Emmausjüngern. Die großen Geheimnisse des Glaubens leuchten nicht schlagartig ein. Es braucht Zeit, bis die Freude in die Herzen einsickert und die Jüngerkirche begreift, dass Jesu Weggang Gutes bedeutet (Joh 16,6). Eine Kraft wird kommen, der Heilige Geist, der mehr ist als Antriebsenergie für atemlose Männer, mehr als ein Motivationsschub für Erschöpfte, die sich als Ersatzleute eines verschwundenen Christus missverstehen. Es dauert, bis die Kirche erkennt, warum ihr Herr gehen musste, um ihr Allernächster zu bleiben. Gerade in seinem Weggang erweist er sich als unersetzlich. Dieses Himmelfahrtsbild beschönigt nichts, es akzentuiert eher den Abschiedsmoment. Auch deshalb ist es so menschlich, weil sich die Freude über Jesu neue Präsenz eben nicht plötzlich einstellt. Noch sehen diese Männer nicht wie Verstehende und kraftvolle Zeugen aus. Ich muss die schmerzliche Erfahrung, dass Er „erst mal weg“ ist, mit der geistgeschenkten Gewissheit verbinden, dass Er mir kraft seines Weggangs „näher ist als die eigene Halsschlagader“ (vgl. Koran Sure 50,17). Der Gehende ist der Bleibende, der uns Nahegehende und der Wiederkommende. Es ist schwer zu verstehen, dass die Stunde der Erhöhung Christi kein Abschied ist, auch kein „Abschied auf Zeit“. Gottes Trostgeist muss der Kirche zugeschickt werden, damit sie erkennt, dass Er nicht mitten aus ihrem Leben gerissen wurde. Es wäre frustrierend, wenn die Kirche „entkernt“ zurückbliebe auf dem harten Boden der Welt und verkrampft irgendeine abstrakte „Sache Jesu“ fortzuführen versucht oder eigenmächtig die Lücke füllt, die Christus hinterließ. „Aus dem Auge, aus dem Sinn“. Solch eine Gedächtnisschwäche darf die Kirche nicht erfassen! Was jetzt? Wie wird sich eine erdenschwere Kirche neu sortieren? Sie ist nicht die traurige Erbin des „Neuen Testamentes“ und nicht der fromme Gedächtnisverein, der dem guten Mann von Nazareth ein ehrendes Andenken bewahrt. Fatal wäre es, wenn sich die Apostel mit dem Mut der Verzweiflung als Ersatzleute Jesu begreifen würden, die den Unersetzbaren ersetzen wollen. Suchend und fragend hoffen wir auf ein „unverhofftes Wiedersehen“ und Jesu Realpräsenz. Unendlich mehr bleibt von ihm als seine durchbohrten Füße; mehr bleibt als die seltsamen versteinerten Spuren des letzten Fußabdruckes Jesu in der Himmelfahrtsmoschee auf dem Ölberg, den die Pilger andächtig betreten. Nein, die Kirche bleibt nicht mutterseelenallein – was für ein Wort! – zurück, als müsse sie sich nun neu sortieren in der Zeit „nach“ Christus.
Eine Geisteskraft muss kommen, die eine auf sich selbst zentrierte Kirche weckt und in das Hier und Jetzt zurückholt. Christus muss sich nach seiner Entrückung neu vergegenwärtigen und uns daran erinnern, dass uns allen hoffentlich eine Himmelfahrt bevorstehen wird. Gottes Geist muss uns himmelwärts ausrichten, ohne dass wir dabei die Bodenhaftung verlieren. Das fast 500 Jahre alte Bild zeigt keine triumphierende Kirche, keine feuchtfröhliche Männerpartie, keine selbstbewusste Jüngerschar, die an der Macht des Erhöhten praktiziert, auch keine sich selbst Mut einredende Kirche in der Aufbruchsstimmung des „Jetzt erst recht“, sondern einen verstörten Haufen Zurückgelassener. Ein trauriger Anblick untröstlicher Apostel, angewiesen auf einen Trost, der nicht von dieser Welt ist.
Jesus ist im Übergang begriffen. Gerade weil Christus ‚im Himmel‘ ist, ist seine sakramentale Gegenwart ‚unten‘ so überlebensnotwendig. Nie sind wir mehr auf die Nähe Christi angewiesen als seit dieser Zäsur, welche das Himmelfahrtsfest markiert. Christi Himmelfahrt ist eines meiner Lieblingsfeste, auch wenn es sich zusehends verflüchtigt. Denn es lehrt eine neue Gestalt der Nachfolge - dem emporstrebenden Christus nach. Fortan wird der Kirche das Glauben schwer gemacht. Sie muss erwachsen glauben und ihn anderswo suchen, weil er nicht mehr in der Reichweite unserer Sinne ist. Christi Himmelfahrt gibt zu denken, denn an diesem Fest geht der Wegweiser entschieden vertikal nach oben, wir werden in eine Bewegung versetzt, die uns hoffen lässt auf das, was droben ist. Diese Zuspitzung zum Himmel hin, dieses schmerzliche Vermissen des Erhöhten, meine hoffentlich noch nicht stillgelegte Himmelssehnsucht – all das ruft dieser Tag wach. Die Jüngerkirche auf diesem Gemälde – mein Wunschbild der gegenwärtigen Kirche: Es wäre ehrlich, wenn sie ihm ratlos hinterherschaut, wenn sie in seine neue Gegenwartsform einwilligt und es zulässt, wie Christus sich unserem Zugriff entzieht. Wir können die Gegenwart Christi nicht erzwingen und ihn nicht funktionalisieren für unsere Zwecke, nicht einfangen in unsere eigenen Sätze und Interessen. Er ist – bei aller Liebe - nicht festzuhalten (vgl. Joh 20,17). ER ist gerade nach seiner Erhöhung unersetzbar. Und Kirche ist nicht Herrin über sich selbst. Wir gehören zu den ihn Loslassenden und ihn gerade darum neu Empfangenden. Wir sind angewiesen darauf, dass endlich die Engel Gottes zu uns treten, um uns zu entschlüsseln, dass Christus in das Geheimnis des Vaters eingetreten ist und Wege findet, von dorther unser Allernächster zu sein. Maria ahnt, wer auf die Apostel zukommt, wer uns fehlt: Der Heilige Geist, der uns geistesgegenwärtig leben lässt.
Kurt Josef Wecker, geboren 1961, Pfarrer im Wallfahrtsort Heimbach und in sieben weiteren Pfarren, Beauftragter für Wallfahrtspastoral im Bistum Aachen und Herausgeber einer Predigtzeitschrift.
Ostern 2024
Wo bist du? Die Urfrage im leeren Grab!
Osterbetrachtung von Kurt Josef Wecker
Erzähle mir Ostern! Das ist so schwer. Ostern, also das gänzlich Unerwartete, ist so schwer zu fassen, das können wir uns kaum ausmalen. Da stoßen auch Malbegabte an ihre Grenzen. Denn dieses Ereignis leidet unter göttlicher Überbelichtung. Die Wucht des Unfassbaren ist zu hoch für uns, das Gegenlicht zu blendend. Vieles bleibt unscharf. Die Auferstehung Christi kann nicht erzählt werden. Im Augenblick der Auferweckung des Gekreuzigten war niemand von uns dabei. Die Kirche hat das Nachsehen; die Jünger, ja und selbst die tapferen Salbfrauen kommen zu spät. Der Auferweckte ist uns voraus. Das Unsägliche geschah in aller Herrgottsfrühe, ganz tief im Verborgenen und so leise, wie eben Gott handelt. Ostern kommen wir immer zu spät, können nur noch ins Leere fassen. Ihn selbst aber sehen wir nicht im Grab. Er entzieht sich unseren Blicken und Zugriffen. Er fehlt uns. Er ist nicht im Bilde und hat das Weite gesucht. ER müsste sich uns anderswo zeigen. Die Gegenwart des Auferweckt-Gekreuzigten können wir nur glauben. Der Triumphalismus des Osterliedes „Das Grab ist leer, der Held erwacht“ passt kaum zum Ostermorgen. Das Wunder kommt auf leisen Sohlen auf uns zu. Es wird Ostern, auch wenn uns so wenig nach Ostern zumute ist.
Wie also einen Zugang finden zu diesem schön-schweren Fest? Vielleicht, indem wir uns einem zurückhaltenden Osterbild zuwenden, den Zugang durch die offene Grabhöhle durchschreiten und ohne Schwellenangst eine Grenzüberschreitung wagen. Unser Suchweg nach Jesu – mündet er im leeren Grab? Wenn wir uns in das zunächst nicht trostreiche Bild vertiefen, das ich Ihnen und Euch in diesem Jahr anbiete, dann befinden wir uns – im Grab und müssen mit der Abwesenheit Christi fertig werden. Was für ein seltsamer Aufenthaltsraum! SEIN Grab. Ein menschenleeres Bild. Wir blicken aus einer ungewohnten Perspektive in den Ostermorgen, aus dem dunklen Grabinneren in das grelle Licht, das den Golgothahügel umstrahlt. Das Loch zur Höhle wird zum Portal. Draußen herrscht kein Zwielicht mehr; draußen ist es gleißend hell. Es ist schon nicht mehr Morgengrauen. Die „Herrgottsfrühe“ liegt schon hinter uns. Wir werden geblendet vom Gegenlicht eines übernatürlich hellen Tages. Wir befinden uns auf dem Friedhof vor den Toren Jerusalems, in der Grabkammer mit einer leeren Ablage. Wir dringen ein in diesen anstößigen Ort, als wollten wir uns „am ersten Tag der Woche“ (Mk 16,1) mit eigenen Augen davon überzeugen, dass das Grab Jesu leer ist. Anders als auf unseren Friedhöfen sind die vorderorientalischen Gräber begehbar. Ungehindert haben wir Zugang zu einer Tabuzone. Hier ist niemand als wir. Es war die Stätte der seltsamen Osterpredigt eines Deute-Engels. Innerhalb des Grabes sagt der Engel den „Leichensalbfrauen“ (Peter Handke), die einen „Mumiendienst“ (Franz Kamphaus) vollziehen wollten: „Siehe, den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten!“ (Mk 16,6). Die drei Frauen wurden nicht genötigt, das Heilige Grab zu besichtigen; wir hingegen sind im Bilde und besuchen dieses Totenreich. Was haben wir hier verloren, was haben wir hier zu suchen, an der Endstation, dem Zielort eines Menschenlebens? Die Frage, wie wir da hineingelangen können, die Sorge, wer uns den Stein weg wälzt, hat sich erübrigt. Der Stein ist längst ins Rollen gekommen, ungehindert konnten wir diese Felshöhle betreten. Es ist Tag der offenen Tür! „Seht, der Stein ist weggerückt, nicht mehr, wo er war, nichts ist mehr am alten Platz, nichts ist, wo es war“, heißt es in einem modernen Osterlied von Lothar Zenetti. Der wie durch Zauberhand weggewälzte Stein – ein Zeichen dafür, dass Ostern etwas Stein- und Weltbewegendes geschehen ist. Zwar ist der Stein weg, doch rechte Osterfreude stellt sich nicht ein. Niemand hier, kein Engel gibt uns Klarheit. Eine seltsame Perspektive, eine offene Geschichte. Ich liebe das leere Heilige Grab von Jerusalem; der Grabeskult ist mir nicht fremd. Paradox: Ich will da rein, ich liebe das Grab. Es zieht mich an, immer wenn ich mich in Jerusalem in der Grabes- und Auferstehungskirche (der Anastasis) in die lange Warteschlange einreihe und mich endlich mit klopfenden Herzen hineinwage in das Denkmal des Osterglaubens, in das „Heilige Grab“. Unweit davon, in einer unscheinbaren Seitenkapelle, befindet sich das sogenannte „Grab des Josef von Arimathäa“. Diese dunklen Felsenspalten lassen noch heute ahnen, dass Jesus wirklich in einem Felsengrab inmitten des aufgegebenen Steinbruchs beigesetzt wurde. Dieser Joseph hat Jesus sein eigenes Grab zur Verfügung gestellt und den Leichnam des Herrn in Leinentücher gehüllt. Das kurze Verweilen im Heiligen Grab und im düsteren Felsengrab in der Nähe erschüttert selbst den unerschütterlichen Pilger. Was habe ich in einer Grabeskirche zu suchen, und welche Glaubenserfahrungen verspreche ich mir von dieser Expedition ins Totenreich? Wer erlaubt mir einzutreten? Ist der Ostertag der Tag der offenen Tür?
Das Bild wirkt leicht unscharf. Wir stehen im Gegenlicht, werden geblendet von einem übernatürlichen Glanz, von einer Überlichtung, die uns nicht klar sehen lässt. Selbst die dunkle Golgotha-Höhe (die „Stätte des Totenkopfs“), auf der Jesus liquidiert wurde, ist umstrahlt von diesem Verklärungslicht. Vielleicht ist „Unschärfe“ überhaupt ein Schlüsselwort, um unseren Eindruck vom Osterwunder zu beschreiben. Das diesjährige Ostermotiv lädt uns ein, mutig in die Grabhöhle Jesu hineinzugehen und von dort aus hinauszublicken in den ersten Tag der Woche. „Nichts Neues unter der Sonne“ (Koh 1,9), klagt der alttestamentliche Prediger. Einspruch! Wenn das wahr wäre, was wir an Ostern zu hören bekommen, dann wäre alles neu unter der Ostersonne! „Licht der Liebe! Scheinest du denn auch Toten, du goldnes!“, dichtet Friedrich Hölderlin. Wenn Ostern wahr wäre, dann läge Morgenglanz der Ewigkeit auf dieser Welt; ein verheißungsvolles Licht, unsagbar schön und fremd! Die Griechen sagen „Doxa“, herrlicher Glanz.
Das Grab - offen und leer, der Held – erwacht? Blinzelnd müssen wir uns an das Dunkle dieser Todeshöhle gewöhnen. Uns kommen hier eher trübe Gedanken. Wir grübeln. Was ist hier passiert? Ein Einbruch? Ein Ausbruch? Kein deutender Engel steht hilfreich bereit, der uns dieses Rätsel lösen könnte. Unser Verstehen bleibt blockiert. Müssen wir uns selbst einen Reim machen auf diese mysteriöse Szenerie? Oder davonlaufen? Denn eines steht fest: „Er ist nicht hier!“ (Mt 28,6a). „Hic non est!“ (Mk 16,6). Das leere Grab ist kein freudiges Ostermotiv, es war für die Frauen sicherlich kein Trost. Es machte sie sprachlos, ratlos. Sie hatten am Abend des Karfreitags „den Ort gesehen, wohin er gelegt worden war.“ (Mk 15,47; Mk 16,6). Und nun? Ein Leichnam ist abhandengekommen, dem sie mit Salben Gutes antun wollten, um ihn dann endgültig loszulassen. Nicht einmal die Leiche blieb den Frauen, die ihn trauernd suchten. Nicht zu fassen! Wohin hat sich der geliebte Jesus verflüchtigt? Der Leerraum markiert einen Verlust. Den Frauen ist nicht nur der lebendige Jesus gestorben, selbst der Leichnam kam abhanden. Alles weg! Die suchenden Frauen greifen ins Leere und können ihren Jesus nicht einmal salben. Ein untröstlicher Augenblick. Was ist hier passiert? „Keine Erdstöße, sondern Himmelsbeben“ (Tomas Tranströmer, Sämtliche Gedichte, München 1997, S. 182). Eine übermenschliche Gewalt hat die Grabkammer geöffnet und die todsichere Ordnung dieser Welt durcheinandergebracht. Etwas Welterschütterndes muss hier passiert sein. Wenn Ostern wahr ist, dann ist es eine Zeitenwende, ein „Zeitbeben“. Hermetisch Abgeriegeltes wird durchlässig; Grabsteine geraten ins Rollen; der Weggesperrte ist fort. Ist ein solcher Stein-Bruch schön oder schrecklich? Sollen wir staunen und vor Freude Halleluja singen, oder sollen wir uns mit Furcht und Zittern von diesem ‚Andersort‘ davonmachen? Sind wir im Bilde? Die einzig plausible Erklärung für dieses unbeschreibliche Ereignis: In diesem Totenhaus muss - Gott gehandelt haben. Über Nacht ist alles anders geworden. Ostern macht nur Sinn, wenn es Gott gibt. Auferweckung Jesu – das ist die reine Tat Gottes, seine ureigene Herzensangelegenheit! Nur Gott kann so ganz neu anfangen!
Ja, wir wissen es und haben es als Theologen oft genug gehört: das leere Grab allein ist kein Beweis für die Wahrheit der Auferweckung des Gekreuzigten. Doch mein Glaube kann auf das leere Grab nicht verzichten. Ostern feiern wir nicht im Grab. ER müsste sich selbst anderenorts zeigen. Es treibt ihn ins Freie. Darum: Ortswechsel, eine Kehrtwende ist angesagt. Das leere Grab allein wäre eine Sackgasse, es kann nur Wendepunkt und Transitort sein. Der Engel sagt den Frauen: Hier seid ihr am falschen Ort. Haltet euch nicht zu lange hier auf! Hier bekommen wir den Lebendigen nicht zu sehen. „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“ (Lk24,5) In dieser Höhle könnte ich nur die deprimierende Wahrheit feststellen: Fehlanzeige! Er ist nicht hier. Also: Mach dich davon, dreh dich um, geh ins Licht, nutze die Graböffnung als Tür ins Freie, suche das Weite, suche seine Spuren, suche ihn anderswo. Wagt die Nachfolge! Vielleicht werdet ihr ihm draußen plötzlich und unerwartet in die Arme laufen und erlebt ein unverhofftes Wiedersehen. Vielleicht werden wir diejenigen sein, die den Auferweckten zum ersten Mal sehen und seine unentrinnbare Nähe spüren. Er vor uns - gefüllt mit Gottesleben. ‚Draußen‘ steht er uns bevor. Wir können ihn nie in unseren Besitz bekommen und in Mausoleen einmauern. Er selbst muss an uns vorübergehen und sich uns zeigen. Die Kirche kann ihn nicht hervorzaubern. Und vor allem kann sie ihn nicht ersetzen; sie kann ihn nur staunend bezeugen.
Nehmen wir uns noch einmal in dieser Grabhöhle wahr. Im Grab herrscht keine gähnende Leere. Wir sind dort - als Zeuginnen und Zeugen eines für uns unerklärbaren Ereignisses. Ein Steinsarkophag fehlt. Doch zurück bleibt (nach dem Evangelisten Johannes 20, 5 und 6; vgl. 19,40 und Lk 24,12) etwas Stoffliches, ein Textil auf der Grabbank, das zur Umhüllung des Leichnams notwendige und nun überflüssige Leinentuch. Der, welcher sich in dieser ganz gewöhnlichen Grabhöhle - ohne Ausschmückung oder Inschriften - befand, war nur flüchtig hier und ließ das Leinentuch beinahe so lässig zurück, wie wir, wenn wir am Morgen das Bettlaken von uns werfen, das Bett verlassen und in den neuen Tag auferstehen. Als Jesus das Weite suchte, trug er nicht dieses wallende weiße Leichentuch. Jesus war nicht zu halten; der Tod griff nach ihm, in seinen Händen bleibt nur dieses Tuch (griech. sindon, vgl. Mk 15,46; Mt 27,59; Lk 23,53; Joh 19,40f). Als das „Turiner Grabtuch“ wird diese Christusreliquie heute verehrt. Was trug Jesus dann, wenn er dieses Linnen zurückließ? Von wem wurde Er neu „überkleidet“ (2 Kor5,2ff)? Das Leinentuch ist ein geheimnisvolles Relikt, ein ‚Zeichen‘, etwas buchstäblich Zurückgebliebenes, Abgeworfenes, eine Spur des abwesenden Christus, ein „heiliger Rest“. Als sei dieses ‚Schwellengebiet‘ eine Schlafhöhle; als habe sich hier eine verpuppte Raupe zum Schmetterling verwandelt und habe die leere Hülle zurückgelassen. Als sei jemand aufgestanden und habe nur einen Lichteindruck hinterlassen. Mysteriös! Das leere Grab allein bleibt ein eher negatives Zeichen, vieldeutig, rückwärtsgewandt, missverständlich. Fragen bleiben offen. Das ist kein Bild einer geschenkten Nähe Jesu, nicht einmal ein Trauerort. Das leere Grab ist ein stummer und mehrdeutiger Zeuge der Auferweckung Jesu; es weckt vielleicht unsere Neugier, aber keine Osterfreude, keinen ‚Evangelisierungsschub‘. Die Leere ist ein Ausdruck des „Du fehlst uns, Jesus!“ Mit dieser Leerstelle allein kann unser Glaube nichts anfangen. Das Bild bedeutet alles oder nichts. Es macht uns „auferstehungssehnsüchtig“. Da muss noch mehr kommen … Bleibt nicht zu lange im Bilde, im Grab! Lauft ihm nach, sucht ihn in eurem ‚Galiläa‘. „Dort werdet ihr ihn sehen“ (Mk 16,7), in einer Welt, die fortan im Osterlicht liegt. Feiert ihn draußen, erzählt von ihm, lasst ihn an unerwartetem Ort an euch heran! Das leere Grab alleine wäre unwichtig, und wir würden unnötigerweise dort verweilen, auf Kosten dessen, was wirklich wichtig ist. Das wäre das Osterwunder: Jesu leise Annäherung draußen, sein Lockruf, der uns im Freien, in meinem Leben ereilt. ER hat sich uns entzogen und er kommt uns entgegen. Eine offene Geschichte der Jesussuche beginnt am offenen Grab. Wir vermissen dich so! Lassen wir das Grab hinter uns, treten wir hinaus ins Offene, denn Ostern ist ein offenes, ein auch uns öffnendes Geheimnis. Brechen wir auf ins Licht – überwältigt vom Glanz, staunend über das Unfassbare, in der Gewissheit, dass sein Grab nicht Endstation ist, dass Er draußen auf mich wartet und darauf hofft, entdeckt zu werden. Hoffentlich entdecken wir draußen – auch in der frühlingshaften Schöpfung - Spuren der Erlösung. Hoffentlich treffen wir Ihn. Weil es Ostern gibt, darum hoffen wir weit über unser Grab hinaus, darum werden auch wir Christus in die Arme laufen. Ja, es ist ‚Vorübergang des Herrn‘!
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen und Euch
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Türöffner gesucht! Weihnachten – ein öffentliches Geheimnis!
Bildbetrachtung von Kurt Josef Wecker zu einem Gemälde von Federico Barocci (1597)
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in unserer GdG,
ich weiß nicht, ob wir Ihnen und Euch in den Gottesdiensten ein alle Jahre neues,
abwechslungsreiches, jeweils andere Geschmacksnerven ansprechendes ‚Weihnachtsmenü‘ zaubern
können. „Früher war mehr Lametta“, heißt es unnachahmlich in einem Sketch des unvergessenen
Menschenkenners Loriot. Früher habe ich womöglich anders gepredigt, opulenter, glanzvoller,
„lametta-reicher“. Heute spüre ich: Ich bin kein Weihnachtsengel. Mir fehlt das „englische
Mundwerk“ (Magdalena Frettlöh). Ich suche nach Worten, das Mensch gewordene Wort zu bezeugen
und nach Schlüsseln, den Zugang zum Geheimnis zu öffnen. Wenn wir manche Schlüssel zum
Geheimnis verlegt haben, dann steht uns die Kunst bei, damit uns neu die Augen aufgehen.
„Komm her, freu dich mit uns, tritt ein!“ (GL 148). Damit eröffnen wir manche Messfeier. „Kommet,
ihr Hirten, ihr Männer und Frauen“, „Ihr Kinderlein, kommet!“, so klingt es in weihnachtlichen
Liedern. Lieder sind Lockrufe. Lasst euch nicht lange bitten, nur hereinspaziert! Heute sind wir Gäste
bei einem geheimnisvollen Kindergeburtstag. Freier Eintritt am Tag der offenen Stalltür! Kommt und
seht! Kommt in diesen geschützten Raum und überzeugt euch, dass euer Weg ein Ziel hat und ihr hier
richtig seid. Denn „das habt zum Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegend“ (Lk 2,12). Hoffentlich sind wir noch neugierig genug auf Weihnachten und keine
lustlosen Spielverderber beim nächtlichen Suchspiel. Los also! Entdeckt ihn! Überzeugt euch selbst:
„Christus, der Retter, ist da!“
Wie aber gelangen wir hinein in das Geheimnis? Nur dann, wenn jemand es lüftet und uns eintreten
lässt. Wer hat mir und dir die Tür ins Leben und in die Glaubenswelt geöffnet? Was, wenn niemand
da ist, der mir zum Einweiser in das Geheimnis, zum „Mystagogen“ wird? Ich wünsche mir, dass z.B.
die Christmette ein „Türöffner-Gottesdienst“ sein wird. Neue oder selten gesehene Gesichter werden
an der Krippe auftauchen. Gelingt es unserer Kirche noch, Türen zu öffnen in die Stallgeschichte von
Bethlehem?
Von einem Türöffner-Moment erzählt das diesjährige Weihnachtsbild. Ein sehr inniges, zartes,
gefühlvolles Gemälde wird uns in diesem Jahr vor Augen gestellt. „Il Fiori da Urbino“, genannt
Federico Barocci (Baroccio) aus Urbino in den Marken / Mittelitalien hat es geschaffen. Er lebte
zwischen 1535 und 1612 und malte das Bild um 1597. Es fiel mir bei einem Besuch im Prado in
Madrid vor einem Jahr ins Auge. Dort hängt es, weil es der Herzog von Urbino der Königin von
Spanien 1605 zum Geschenk gemacht hat. Barocci war ein Künstler im Übergang von der Renaissance
und dem Manierismus zum Barock. Er hat sich einige Jahre in Rom aufgehalten, dort auch zwischen
1560 und 1563 den vatikanischen Belvedere-Palast und das Casino in den Vatikanischen Gärten mit
Fresken ausgemalt. Vom heiligen Filippo Neri wurde er sehr verehrt. Doch überstürzt zog sich Barocci
ab 1563 für die weiteren 47 Jahre in die Provinz, in seine (und Raffaels) Heimatstadt Urbino zurück,
weil er den Verdacht hegte, in Rom hätten neidische Künstlerkollegen versucht, ihn mit Gift im Salat
umzubringen. Er war ein hochangesehener, wohlhabender, gesuchter Künstler, der für Päpste und
mächtige Kardinale gearbeitet hat. Barocci stand in der Nachfolge von Raffael und Correggio. Er war
von schwacher Gesundheit und vermochte deshalb nur einige wenige Stunden am Tag zu malen. Ja,
dieser viel zu wenig bekannte Barocci schuf ‚im Geist der Gegenreformation‘, treu den 1563
erlassenen Kunstvorgaben des Konzils von Trient - sehr katholisch, sehr kontemplativ und ‚andächtig‘
diese stimmungsvolle Weihnachtsszene. Mir geht Baroccis affektive ‚Geburt Christi‘ nahe. Dieses Bild
ist „Auftragskunst“. Und doch: Was für eine wunderbare Idee führt Barocci aus! Es wird den
Betrachtenden warm ums Herz. So viel Gefühlstiefe und Menschlichkeit war in den mittelalterlichen
Weihnachtsdarstellungen nicht denkbar.
Die Geburt Jesu geschah zur Nacht (Lk 2,8). In diesem ‚Nachtstück‘ führt Gott im dämmrigen Dunkel
eines Stalles Lichtregie. Ja, wir spüren in den dunklen Kriegszeiten im Osten Europas, im Nahen Osten
die Nachtseite der Welt. „Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt“ (GL 220,5). Eine
Geburt wird zum öffentlichen Ereignis. „Hirten erst kundgemacht“. Diese ersten frohen Boten der
Weihnachtsbotschaft haben sich durch die Nacht hindurchgearbeitet; die Nacht ist nicht allein zum
Schlafen da. Wunderbar gestaltet der Künstler die nächtliche Stimmung. In einen dämmrigen Stall
werden wir zusammen mit den beiden Hirten hineingezogen. Ich fühle mich eingeladen, wie sie
einzutreten in den sehr wirklichkeitsnah dargestellten Schutzraum und dem geheimnisvollen,
übernatürlichen Lichteinfall zu folgen. Die Mutter und das wie von einer Lichtaura umhüllte Köpfchen
des Kindes werden erhellt. Alle Aufmerksamkeit ist auf den Kleinen in der Krippe gerichtet. Weißes
Licht umgibt sein Köpfchen, beglänzt seine Armseligkeit. „In dieser hochheiligen Nacht ist uns das
Licht aufgestrahlt“, singt die Liturgie. Woher kommt das Bildlicht? Jesus ist nicht im Scheinwerferlicht
dieser Welt zur Welt gekommen. Keine Stalllaterne, keine Kerze erhellt den Stall, kein Neonlicht
beleuchtet diesen ‚Kreißsaal‘. Das Licht ist das einzig Übernatürliche in dieser so menschlichen
Szenerie und kommt aus einer anderen Welt. Ja, es ist die Nacht des offenen Himmels; aus diesem
Lebensraum Gottes dringt übernatürlicher Glanz in die dunkle Hütte. Licht auf Gesicht. Das Licht der
Welt (Joh 8,12) kommt zur Welt. Wir Betrachter befinden uns in diesem Innenraum. Ein wenig Heu
und Stroh bedecken den Boden des Stalles, der eher eine gemauerte Hütte ist.
Für mich am originellsten gelungen in Baroccis Meisterwerk ist die Gestalt des Josef, obwohl dieser im
Hintergrund bleibt. Josef steht im Halbschatten des Stalles. Nein, dieser Josef ist kein Zweifelnder,
kein alter Grübler, kein Statist, keine Nebenfigur. Sein Zeigefinger wird zum Wegweiser. Nach Mt 1,20-
24 wurde Josef vom Engel über das Geheimnis dieses Gotteskindes ‚aufgeklärt‘. Er übernimmt eine
ganz entscheidende Aufgabe und wirkt wie ein Mittler zwischen Draußen und Drinnen; er hält die Tür
einen Spalt weit offen, als würde er den Vorhang zum Mysterium öffnen und für die erwartungsvoll
hineinlugenden, lauschenden Hirten den Zugang zum Allerheiligsten auftun. Ein Engel hat sie auf den
Weg gebracht. Und Josef gestikuliert seinen Willkommensgruß: Tretet näher, ihr Fremden und
Fernstehenden! Noch stehen die Ankömmlinge vor der Schwelle und sind Randfiguren, doch diese
Neugierigen werden hineingerufen und die Ersten sein, die das Christfest mit Josef und Maria feiern
dürfen. Selbst ein Schaf drängt durch den Türspalt hinein. Josef versetzt mit dem einladenden
Zeigegestus in Bewegung. Schaut euch das Wunder dieser Nacht an! Wir folgen dem Fingerzeig und
erblicken das Kind. Josef ermutigt: Egal, wie weihnachtlich gestimmt ihr seid: Ihr dürft, wie die Hirten,
näher treten und mitspielen bei diesem göttlichen Krippenspiel! Endlich ist er da, auf den Israels
Hoffnung gerichtet war. Entdeckt den Messias – kaum zu glauben! - in der schwachen Gestalt des
Kindes. Josef selbst hält sich zurück. Nicht sein Gesicht ist wichtig, sondern sein Zeigefinger, sein
Gestus: Ich mache den Weg frei. Das ist seine wichtige Rolle in diesem Krippenspiel und das ist die
wichtigste Aufgabe einer ‚josephinischen‘ Kirche: dem Mysterium nicht im Weg zu stehen. Josef lüftet
das Geheimnis und macht es öffentlich. Weihnachten ist kein privates Familienfest, kein
Kindergeburtstag im kleinen Kreis. Das Kind, das dort liegt, gehört aller Welt! Schaut, was sich hier
ereignet hat! Es ist nicht zu fassen! Fremde, neugierige Menschen, unerwartete späte Gäste wie du
und ich werden eingeladen, die Schwelle zu überschreiten. Dabei sein ist alles.
Marias Gestalt steht im Zentrum. Sie ist mit schweren Gewandstoffen auffallend üppig gekleidet. In
der Darstellung des sorgfältig drapierten Faltenwurfs von Untergewand und Mantel und der grellen
Farbgebung - ein leuchtendes Goldgelb und Rosa – kann der Künstler seine Meisterschaft unter
Beweis stellen. Marias dunkles Haar ist nicht verschleiert. Kein Heiligenschein umgibt ihr Haupt. Der
Gestus Marias - das ist ihr intensiver Blickkontakt zum Kind und die Gebärde der Darbietung. Auf
diesen Augen-Blick und auf diese Geste des Staunens kommt es zur Weihnacht an. Ein Miteinander
im Blickwechsel. Maria lädt ein zur Meditation des Geheimnisses und macht das Gemälde zu einem
Andachtsbild. Sie steht nicht im Weg, sie bleibt in einiger Entfernung zum Kind und harrt still aus vor
dem Geheimnis des Glaubens. Was für ein Blick voll gläubiger Intensität! Das Inkarnat der Mutter ist
deutlich heller als die Gesichtshaut des Neugeborenen. Sie kann es nicht fassen, denn Er ist nicht zu
fassen. Durch sie hindurch kam er zur Welt. Sie lässt Jesus los und gibt wie Josef den Weg frei für uns.
Sie lädt uns zur Verehrung des Menschgewordenen ein. Richtet euren Blick auf das Kind! Alles ist ganz
still, alles läuft auf das Gotteswunder zu. „Ich sehe Dich mit Freuden an und kann mich nicht satt
sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen“ (GL 256,4). Der Neugeborene
liegt Gott sei Dank nicht ganz unten, bibbernd und splitternackt auf dem harten Boden, nicht straff
bandagiert als Wickelkind. Das Gotteskind schläft nicht. Liebevoll in eine blaue Decke bis auf den Kopf
warm und geschützt eingewickelt, wurde es gebettet auf einer hölzernen Liegestatt im Krippenstroh
wie auf einem Holzaltar. Das Holzgestell des Schuppens über ihm wirkt wie ein improvisierter
Baldachin.
Das Kind wird vom Atem weihnachtlicher Tiere gewärmt. Ochs und Esel, die großen Tiere, dürfen
überraschend nahe an den Neugeborenen heran. Mit neugierigem Blick drängen sie übereinander
gestaffelt an das Kind heran und bekommen auch ein wenig Lichtglanz mit. Sie sind dabei, erkennend
und verstehend - wie wir Bildbetrachter in der ersten Reihe. „Der Ochs kennt seinen Besitzer und der
Esel die Krippe seines Herren; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht“, heißt es
in Jesaja 1,3. „Inmitten zweier Lebewesen wirst du erkannt werden“ (Habakuk 3,2, Septuaginta). Auch
wenn der Evangelist Lukas sich darüber ausschweigt - diese beiden Kreaturen müssen einfach dabei
gewesen sein. Sie sind mehr als Staffage und Stallzubehör, sie gehören zu den Erstzeugen des neuen
Adams. „Muh!“ und „Iah!“ – das sind die ersten Weihnachtslieder, die die stille heilige Nacht mit dem
‚Seufzer der Kreatur‘ unterbrechen. Nach traditioneller Deutung stehen sie für Juden und Heiden. Alle
Kreatur ist zum Lob Gottes aufgerufen, wie gerade Franziskus hervorhob, der vor 800 Jahren in
Grecchio die Menschlichkeit der Christgeburt erstmals in Szene setzte. Werden wir die Stelle dieser
beiden Tiere einnehmen und uns genauso verstehend und andächtig Ihm annähern?
Barocci beherrscht in dieser Nachtszene die Kunst des „Chiaroscuro“, den meisterlichen Umgang mit
Licht und Schatten und versetzt uns in die Atmosphäre des Hell-Dunkels, welches die Heilige Nacht so
prägt. Wir als Betrachter sind gewissermaßen im Bilde, bereits im Stall angekommen und dürfen die
konzentrierte, kontemplative Haltung der Gottesmutter mitvollziehen. Will ich dem Fingerzeig des
Josef folgen? Will ich nähertreten und in diesem Bild den eigenen Standpunkt finden?
Welche Weihnachtsgefühle weckt dieses Gemälde? Seit mehr als 35 Jahren bin ich nun Priester. Alle
Jahre wieder versuche ich das Fest göttlicher Annäherung zu verstehen. Wie können wir einander
Weihnachten nahe bringen, so wie es ein Künstler vermag, damit das Fest mehr ist als ein alle Jahre
wiederkehrendes sentimentales Märchen aus Tausendundeiner Nacht, mehr als schmerzliche
Erinnerung an unwiederholbare Kindheitstage oder die momenthafte Gedankenflucht in eine
verlorene Heimat? Gelingt es uns, je älter wir werden, dass wir „gleichzeitig“ werden mit dem
Geheimnis der Christnacht? Weihnachten weckt ambivalente religiöse Gefühle. Es ist schön schwer.
Ich wünsche es uns, dass uns die ‚Liveschaltung‘ nach Bethlehem gelingt und uns 2024 Menschen
begegnen, die wie Josef den Türöffner-Dienst in das Geheimnis leisten. Wir werden alle buchstäblich
hineingewickelt in das ganz und gar nicht goldene, sondern erdfarben glänzende Geschenkpapier des
Weihnachtsevangelium - wie in die Windeln Jesu, die im Sommer 2023 in Aachen bei der
Heiligtumsfahrt verehrt wurden. Wir alle dürfen Mitspieler sein bei diesem Heiligen Spiel der
Weihnacht; denn allen wird Er geboren. Hereinspaziert in das öffentliche Geheimnis!
Ich danke den Vielen, die in unseren Pfarren in krisenhafter Kirchenzeit das Gemeindeleben
verlebendigen und den Türöffner-Dienst des Josef heute in Tat und Wort verrichten. Im Helldunkel
unserer Tage wünsche ich Ihnen und Euch das Licht der Weihnacht und ein gesegnetes 2024!
Ihr Kurt Josef Wecker,
Grecchio 1223-2023
Vor achthundert Jahren „entdeckt‘ Franziskus die lebendige Krippe und die Weihnachtskrippenfeier
Erinnerung an das franziskanische Jubiläum von Kurt Josef Wecker
Viele kennen es aus eigenem Erleben: Den Kinder-Krippenspielen oder den „Sprechmotetten“ am Heiligen Abend gelingt das, was vielen Predigten nicht gelingt: der Funke springt über, das abstrakte Wort „Menschwerdung“, „Inkarnation“ wird greifbar und anschaulich im Spiel der Kinder.
So gerne möchten wir einander Weihnachten nahe bringen. Wird uns Predigern die Aktualisierung, der Brückenschlag gelingen? Und werden wir Jesus im Gedächtnis behalten und nicht wieder vergessen? Es wäre mein Wunsch, dass wir einander dazu bewegen, Christus in die Arme zu nehmen, ihn zu umarmen, mich in Ihn und „in seine Lieb‘“ zu versenken, wie die Mystiker und Lieder (GL 239,2) sagen. Dieses Weihnachtsgeschenk wünschen wir uns: dass das Fest uns ergreift und wir das Geheimnis von Weihnachten ‚erleben‘ mit allen Sinnen, damit uns der Menschgewordene buchstäblich auf den Leib rückt. Es wäre wahrhaft Weihnachten, wenn wir in unseren Gottesdiensten und Begegnungen die Jesusbegegnung anbahnen und das Geheimnis verlebendigen. Hoffentlich wird in unseren Weihnachtsmessen oder in persönlichen stillen Stunden vor der Krippe das Gespür dafür geweckt: Ich bin gemeint! Wir alle werden buchstäblich hineingewickelt in das ganz und gar nicht goldene, sondern erdfarben glänzende Geschenkpapier des Weihnachtsevangelium - wie in die Windeln Jesu, die im Sommer in Aachen bei der Heiligtumsfahrt verehrt wurden. Alle dürfen Mitspieler sein bei diesem Heiligen Spiel der Weihnacht; denn allen wird Er geboren. Dann passiert es: Das Licht der Weihnachten springt über und wird als Restlicht das ganze übrige Jahr erhellen. Wir wollen seine Krippe zum Anfassen haben. Das Wunder göttlicher Selbstherablassung soll uns ergreifen, nicht nur vorübergehend für einige rührselige Stunden. Wir meinen, Krippen und Krippenspiele – das ist doch selbstverständlich. Die gab’s doch schon immer … Nein, 1200 Jahre lang war der Kirche diese Weihnachtsfrömmigkeit fremd und unbekannt. Einer musste sie ‚erfinden‘ und damit eine beinahe vergessene Wahrheit des Glaubens neu in Erinnerung bringen. Einer half uns, mit allen Sinnen zu begreifen, das Er wahrhaft Fleisch und Blut angenommen hat, in einer kalten Nacht, armselig, fremd, draußen vor der Tür. Dieser eine war ein Bettelmönch, ein Liebhaber der Randexistenzen und des armen, verletzlichen Jesus: Franziskus von Assisi. 3 Jahre vor seinem Tod schuf dieser kreative ‚Spielmann‘ vor Gott das Spiel der Geburt Jesu.
Greccio war der Ort, an dem Weihnachten neu entdeckt wurde; die Einsiedelei der Minderbrüder ist ein herrliches Wanderziel in Mittelitalien; Greccio war eine der Lieblingsorte des heiligen Franziskus; vielleicht bereits 1209, sicher aber 1217 war er zum ersten Mal in Greccio; auf allen Seiten von Bäumen umgeben, schmiegt sich die Pilgerstätte an die Felsen. Im Komplex der um 1228 entstandenen Einsiedelei von Greccio im „heiligen Tal von Rieti“ - im Herzen Italiens 90 km nördlich vom Rom - befindet sich das Felskloster, darin die Franziskuszelle und die anderen Zellen aus der Zeit des hl. Bonaventura (1221-1274), des langjährigen Generalministers des Ordens, das winzige Refektorium, die kleine Essküche, der Schlafsaal, die alte vom hl. Bernhardin und den Observanten errichtete Kirche und die neue Kirche (1959). Dort ist die Lukaskapelle von 1228, genau an/über der Stelle, an der vor 800 Jahren etwas Innovatives geschah, in der Mariengrotte. Darin aufbewahrt ist die ‚Höhle der Weihnachtsfeier‘ (Cappella / Grotta del Presepe). In der Altarapsis findet sich das Fresco (des Meisters von Narni?) aus dem 14. Jahrhundert. Maria hält Jesus ihre Brust hin: Maria, die stillende Madonna, ‚Maria lactans‘. „Gott hat an der Brust einer Frau gehangen“, sagte Franziskus. Ein Riss geht durch das beschädigte Fresko. Wir sehen den alten Josef und – untypisch für ein Weihnachtsbild – die Büßerin Maria von Magdala. Das Fresko habt die Weihnacht von Bethlehem und die von Greccio nebeneinander abgebildet. Auf dem Fresko zu sehen ist auch der knieende, das streng bandagierte Kind anbetende Franziskus und das staunende Volk im Hintergrund. Ein Priester feiert die Weihnachtsmesse, denn die Eucharistie ist die Vergegenwärtigung des Menschgewordenen: Jesus, der im Krippenheu im Erdtrog lag, kniet sich in die Hostienscheibe hinab. Hier in Greccio, zu Ehren des Franziskus und des denkwürdigen Geschehens vor 800 Jahren, unterschrieb der Papst am 1. Dezember 2019 seine schöne Krippenmeditation, das Apostolische Schreiben (Motu proprio) „Admirabile signum“.
Was geschah dort in der heutigen Region Lazio im Jahre 1223? Einer musste den Anfang machen, zum Entdecker werden und das Christkind gewissermaßen zum Leben erwecken. Einer musste das Evangelium wortwörtlich übersetzen und Erfinder einer Weihnachtsfrömmigkeit werden, die aus unseren Kinderkrippenfeiern nicht mehr wegzudenken ist. Das konnte nur der Heilige inszenieren, der wie kaum ein anderer von Christus ergriffen, durchglüht und neu gestaltet worden ist. Er war es, der ein Leben lang Christus umarmt und ihn quasi zum Leben erweckt hat. Was für eine Innovation, das Christentum wieder als die große Neuigkeit, als Religion der Zärtlichkeit Gottes und der Menschwerdung zu entdecken! Was für eine Provokation! Vor genau 800 Jahren wird das Geheimnis von Bethlehem quasi versetzt in das Bergdorf Greccio, auf den Monte Lacerone, in die von Wölfen durchstreiften Wälder des Apennin. 90 Kilometer südlich von Assisi liegt das Bergstädtchen in der „valle Sacra“, dem „heiligen Tal von Rieti“, dort, wohin sich Franziskus gerne in die Grotten und Erdspalten der Umgebung, in die ‚loci‘ und Einsiedeleien zurückzog, buchstäblich verkroch. Dieser Minderbruder war damals schon von Krankheiten, einem schweren Augenleiden und einer tiefen Enttäuschung über manche Entwicklungen in seiner Bewegung gezeichnet, wurde in Beschlag genommen von der Erarbeitung der Ordensregel. Was in Greccio geschah, lag in der letzten Lebensphase des ca. 40-jährigen Heiligen. Wenige Monate später empfing er in einer ähnlichen Landschaft (in La Verna in der Toskana) die Wundmale Jesu. Am 3. Oktober 1226 starb er in Assisi. Uns wird das Wunder der Weihnacht vorgespielt. Franziskus kam damals wohl zu Fuß aus Rom ins Rietital. Dort nahm er im Lateran bei Honorius III. die päpstliche Betätigung der Ordensregel (die „bullierte Regel“) entgegen. Auch dieses Ereignis vom 29. November 1223 ist ein franziskanisches Jubiläum und ein Wendepunkt dieser Bewegung! In der Naturkulisse von Greccio und nicht in einem Sakralraum geschah das Wunder der Verlebendigung des Christusgeheimnisses. Das war kein pompöses geistliches Spiel, keine feierliche Zeremonie für privilegierte Zuschauer, sondern eine sehr einfache Inszenierung mit schlichten Gesten vor dem mitfeiernden und mit Fackeln die Szenerie beleuchtenden Volk. Alle, die das Geschehen der Heiligen Nacht 1223 dort erlebten, wurden mit Bethlehem ‚gleichzeitig‘. Franziskus von Assisi war der große ‚Spielmann Gottes‘, ein Mensch voller Gesten, theatralisch begabt. Heute würde man sagen: Franziskus gelang eine meisterliche Performance, er inszenierte vor und mit einfachen Leuten ein denkwürdiges Ereignis mit Eventcharakter. Das war keine Spielerei. Dem ‚Poverello‘ war es ernst dabei. Der Sehnsucht nach dem armen schutzlosen Jesus gab er eine Szene, die sich tief einprägte in das abendländische Gedächtnis. Überspitzt könnte man sagen: Franziskus rettete den armen Jesus vor dem Vergessen. Vielleicht gelangte Franz bei seiner Orientreise (1219), die ihn mitten im 5. Kreuzzug auch zum Sultan Muhammad -al Kamil führte, nach Bethlehem; wahrscheinlich ist dies nicht. Der Heilige musste auch wegen seines Augenleidens und der Konflikte in seiner Bewegung alsbald zurückkehren nach Italien. Franziskus, dieser kreative ‚Spieler‘ vor dem Herrn, war also nie im historischen Bethlehem, doch er hat sich Bethlehem imaginiert. Er entschloss sich, die Geburtsnacht des in Bethlehem ‚heruntergekommenen‘ Gottes, die Abwärtsbewegung und Selbstverkleinerung Gottes hier im Grenzgebiet zwischen Umbrien und Latium in Szene zu setzen. Weihnachten war wohl sein Lieblingsfest, an dem er sich quasi in seinen Betrachtungen berauschte: „Wenn der Herr auch in seinen anderen Festen unser Heil erwirkt hat, sind wir dennoch gerettet, weil Er uns geboren ist.“ (Franziskus, zitiert in der Legenda Perusina 14) In der eher milden Weihnacht zum 25. Dezember 1223 war einiges los in Greccio. Leute mit Lichterketten, Fackeln und Lampen zogen durch den Eichenwald, der erfüllt war von Gesängen, Trommeln und Trompeten; die Dorfbewohner zogen zu einem Felsvorsprung, einer Höhle. Sie zogen an den ‚Rand‘ zu dem, der als Randexistenz ausgesetzt und schutzlos zur Welt kam. Dort nahe der Einsiedelei hatten die Brüder des Franziskus und Dorfbewohner Tage vorher bereits etwas vorbereitet. Die Nacht von Greccio war nicht völlig spontan. Auch Jesus ließ sich von den Jüngern den Abendmahlssaal vorbereiten (vgl. Mk 14,12-16 par). Franziskus hatte sich die Erlaubnis und Unterstützung geholt von Giovanni da Velta, dem Grundherrn dieses Dorfes, einem Freund und Gönner des Franziskus, der ihm den bewaldeten Berg mit dem Felsvorsprung geschenkt hat (I Cel 84-87). „Wenn du möchtest, dass wir in diesem Jahr in Greccio Weihnachten feiern, dann geh schnell an die Vorbereitungen und tue genau das, worum ich dich bitte. Ich möchte die Erinnerungen an das Kind wachrufen, das in Bethlehem geboren wurde, und so greifbar wie möglich mit eigenen Augen die schmerzlichen und ärmlichen Umstände sehen, worunter er zu leiden hatte. Ich möchte sehen, wie es in der Krippe auf Stroh zwischen Ochs und Esel lag“. Die sterblichen Überreste dieses Johannes Velitas di Greccio sind in einer Metallurne in der Grotte der Krippe aufbewahrt; ihm kam das Verdienst zu, die entscheidenden Vorbereitungen für die Krippenfeier geleistet zu haben. In die einsame Bergwelt zog sich der „Poverello“ gerne zurück; er kroch in die Naturgrotten – zusammengekauert: er ganz allein vor dem verborgenen Gott. Weihnachten 1223 aber war es mit der Stille vorbei; vor 800 Jahren wurden Ochs und Esel, Schafe und Lämmer - diese „vernunftlosen Geschöpfe“ mit dem Sensus für das Heilige – und genügend Heu und Stroh zu einer Felsenhöhle gebracht; die Landbevölkerung spielte zusammen mit den Begleitern des Franziskus, den Minderbrüdern, dieses ‚religiöse Schauspiel‘ (André Vauchez) der Heiligen Nacht mit. In Italien nennt man diese Art, Weihnachten in Szene zu setzen, bis heute „Presepe vivente“, eine Inszenierung, ein ‚Krippenspiel‘ mit lebenden Personen und Tieren. Diese Greccio-Weihnacht 1223 war wohl liturgisch eine Vigilfeier, verbunden mit einer außerhalb eines Sakralraums zelebrierten Eucharistiefeier. So wie Jesus im Heu, in der Futterkrippe lag, wird uns in der Messfeier das unscheinbare Lebensbrot und darin das Wunder der Nähe Christi gereicht, und wir schmecken die ‚Selbstverkleinerung‘ und demütige Herablassung Gottes. Man muss sich diese Liturgie recht frei und gar nicht zeremoniell streng vorstellen; lebensnah und spontan und ‚im Freien‘ wurde die Gottgeburt gefeiert. Der Sakralraum über der Felsenhöhle und die Eremitage entstanden erst 1228, fünf Jahre später. Seltsam: Eigene ‚Rollen‘ für Maria und Josef, die Hirten und die Engel gab es nicht. Einige Traditionen erzählen, Franziskus habe eine Stoffpuppe für Jesus eingesetzt; nach anderen Traditionen fehlte das Jesuskind wohl. Jesu Präsenz wird durch die Predigt des Franziskus quasi ‚hervorgerufen‘ und imaginiert. Die Symbolfiguren Ochs und Esel hingegen waren Franziskus (im geistlichen Verstehen von Jes 3,1, Habakuk 3,2 LXX und dem apokryphen Pseudo-Mt-Evangelium) wichtig - wie bereits vor Franziskus den Malern und Reliefkünstlern der Weihnacht. Ochs und Esel stehen für Juden und Heiden, die sich friedlich an der Krippe versammeln. Alle Welt, auch die nicht vernunftbegabte Kreatur, finden in Frieden an der Krippe zusammen. Es mag auch vor Franziskus geistliche Spiele gegeben haben, doch dieses ‚Event‘ ist Erstaufführung! Eine lebendige Krippe mit lebenden Krippenfiguren! Teilnehmer waren die Menschen aus der Umgebung, die unmittelbar in das Geschehen einbezogen wurden und Bethlehem in Greccio ‚verheutigten‘. Verleiblichung des Weihnachtswunders! Dabei sind Menschen, die nicht unbeteiligte Zuschauer bleiben, sondern eins werden mit den Figuren der Christnacht. Der Anblick dieser ‚Krippe‘ steckte wie eine heilsame ‚Grippe‘ an; unbeschreibliche Weihnachtsfreude kam auf. Ochs und Esel sollen laut mitgebrüllt haben. Die Naturbühne für das heilige Schauspiel ist – wie wohl auch in der Urweihnacht von Bethlehem - eine Höhle/Grotte, kein Stall, keine Ruine. Giotto und seine Malerschule werden in dem berühmten Freskenzyklus (um 1290) in der Oberkirche der Grabeskirche des Franziskus in Assisi diese einzigartige Weihnachtsfeier in einen geschlossenen Kirchenraum, in einen Altarraum, verlegen, inmitten einer vornehm-starren Liturgie, während der die Menschen wohlgeordnet das Gloria singen. Doch Greccio geschah draußen, improvisiert, unter dem funkelnden Sternenhimmel! Franziskus kam ganz ohne die Klischeefigur eines hartherzigen Herbergswirt aus, eine Rolle, die in unseren modernen Krippenspielen oft wie ein moralischer Zeigefinger auftaucht und von keinem Laiendarsteller gerne übernommen wird. Franziskus war womöglich Diakon; ein anwesender Priester feierte in Greccio die heilige Messe. Ein mit viel Stroh gefüllter Futtertrog wird zur Krippe. Manche Quellen sagen, eine Puppe aus Wachs sei auf das Stroh gelegt worden. Daneben wurde der Tragaltar für das Messopfer errichtet. Und so kam der für Franziskus so wichtige Dreiklang zusammen: Krippe-Kreuz-Eucharistie – und darin die Liebe des Bettelmönchs zum winzigen Jesus, der ‚draußen‘ geboren wurde und improvisiert im Futtertrog den „letzten Platz“ einnimmt. Wir wissen nicht genau, ob Franziskus schon Diakon oder noch Laie war. Die Quellen erzählen: Diakon Franziskus trug - als “levita“ - die Dalmatik und sang das Weihnachtsevangelium von der „Demut der Menschwerdung“, des „heruntergekommenen Gottes“. Er wird die Frohbotschaft von der „Geburt des armen Königs“ so ergriffen vorgetragen haben, dass der Funke dieser Gottesleidenschaft auf die Mitfeiernden übersprang; alle unter dem freien Himmel hatten Anteil an diesem Wunder. Manche meinten, dass dem Franziskus im Vortrag der heiligen Worte das Christuskind erschienen sei. Ein frommer Mann hatte eine Vision: Ihm schien es, dass Franziskus, der Christusähnliche (neun Monate später, am Michaelstag im September 1224, wird er auf La Verna mit den Wundmalen Jesu gezeichnet), das schlafende Kind aus der Krippe genommen und es erweckt habe. „Ein tugendhafter Mann hatte eine Vision. In der Krippe sah er ein lebloses Kind liegen. Franziskus trat zu dem Kind, und er sah, wie das Kind aus einem tiefen Schlaf erwachte. Es war eine zutreffende Vision. In den Herzen vieler Menschen war das Kind Jesus ja zu einem Unbekannten geworden, aber durch die Gnade Gottes hatte Franziskus es wieder zum Leben erweckt.“ (Thomas von Celan, I, 87). „Da wurde er ihnen mit seiner Gnade durch seinen heiligen Diener Franziskus wiedererweckt und zu eifrigem Gedenken eingeprägt“, so schreibt der Biograph. Giotto malte in Assisi den Moment, als Franziskus das Christuskind selbst (und nicht eine Puppe) in die Krippe legt. Thomas von Celano, der erste Biograph, berichtete fünf Jahre nach dem Ereignis (1228), dass Franziskus im Vortrag des Gotteswortes die Worte „Kind von Bethlehem“ und „Jesus“ nicht aussprechen konnte, ohne dass er mit der Zunge seine Lippen leckte und so „die Süßigkeit dieses Namens verkostete und schlürfte“. Niemand bei dieser Außen-Weihnacht war bloßer Zuschauer, alle waren innerlich Beteiligte, vom Jubel Angesteckte. Alle ahnten, wie ernst es der bettelarme Franziskus meinte mit der Liebe zur demütigen Armut unseres Gottes. Diese Vigilfeier war keine sentimentale Spielerei; Franziskus war sich bewusst, dass das Kind, das in Bethlehem geboren wurde, „im Schatten des Todes“ lebte. Alle waren Beteiligte und Beschenkte; sie wurden eins mit dem Wunder der Weihnacht, quasi live hineinversetzt in das Geschehen von Bethlehem. Was für eine Weihnacht! Was für ein Augenblick!
Bethlehem in Palästina ist im Kriegsjahr 2023 leer; Israel hat die Geburtsstadt Jesu im Westjordanland abgeriegelt. Bethlehem steht vor einem traurigen Weihnachtsfest, ohne Arbeit, ohne Pilger, ohne Lichterketten, ohne Hoffnung. Die Krippengrotte, sonst überfüllt, wird nur von wenigen palästinensischen Christen und Ordensleuten besucht. In Greccio wird seit 1973 die Tradition der lebendigen Krippe und des franziskanischen ‚Krippenspiels‘ fortgesetzt und viele Pilger sind in dem Bergstädtchen. Auch die Krippe auf dem Petersplatz in Rom erinnert 2023 an die Innovation des Heiligen aus Assisi.
Oh ja, zu schnell wird nach Weihnachten dieser winzige Jesus vergessen. Denn er ist leise, sein Auftreten schwach und bittend. Im Mund des Franziskus wir der arme Jesus lebendig unter den Worten des Evangeliums. Er ruft ihn uns in Erinnerung. Haltet ihn euch vor Augen! Die ekstatisch-glühende Liebe des Franziskus zum Namen Jesus ist uns vielleicht fremd. Und doch wünsche ich uns, dass wir hineinwachsen in die Weihnachtsgeschichte und Jesus eine Bleibe geben, für ihn heute zur Krippe werden. Ich wünsche uns, dass wir im aufmerksamen Wahrnehmen der Weihnachtsbilder, während unserer Krippenwege und beim Miterleben der Kinderkrippenfeiern in unseren Gemeinden quasi ‚im Bilde‘ sind und mitvollziehen, wie menschenfreundlich nahe uns der winzige Jesus in seinem Geburtsfest kommt. Weihnachten ist kein alle Jahre wieder auftauchendes und im Kalender abwanderndes Fest. Dieses göttliche Geschenkfest will bleibend verlebendigt werden. Wenn auch im Januar die Außenkrippen wieder abgebaut werden, so soll doch die Krippe in mir für Christus bereit stehen. Franziskus wurde in Greccio von Christus gepackt. Solch eine Ergriffenheit kann man nicht inszenieren; sie überkommt uns wie ein Weihnachtsgeschenk vom Himmel. Franziskus! Dir sei Dank für diese Erfindung, für die Verlebendigung des Weihnachtswunders!
Kurt Josef Wecker
Kontexte:
Dann predigte Franziskus dem umstehenden Volk von der Geburt des armen Königs und bricht in lieblichen Lobpreis über die kleine Stadt Bethlehem aus. Oft wenn er Christus ‚Jesus‘ nennen wollte, nannte er ihn, von übergroßer Liebe erglühend, nur ‚das Kind von Bethlehem‘ und wenn er ‚Bethlehem‘ aussprach, klang es wie von einem blökenden Lämmlein und mehr noch als vom Worte floss sein Mund über von süßer Liebe…. Wenn er das ‚Kind von Bethlehem‘ oder ‚Jesus‘ nannte, dann leckte er gleichsam mit der Zunge seine Lippen, indem er mit seinem glückseligen Gaumen die Süßigkeit dieses Namens verkostete und schlürfte.
(Thomas von Celano in der ersten Lebensbeschreibung des heiligen Franziskus 1228/29 in 1 C 86)
Der allerheiligste Knabe,
der Geliebte,
ist uns gegeben.
Und geboren wurde er
Für uns
am Wege
und gelegt in die Krippe,
da in der Herberge kein Platz war
(Franziskus von Assisi, Weihnachtspsalm)
Schau am Anfang des Spiegels die Armut dessen, der in die Krippe gelegt ist und in die Windel gelegt. O wundervolle Demut! O erstaunliche Armut! Der König der Engel, der Herr des Himmels und der Erde – in die Krippe gelegt! … Wenn also der Herr von solcher Erhabenheit und solch edlem Wesen in den jungfräulichen Schoß eintreten und verachtet, bedürftig und arm in der Welt erscheinen wollte, damit die Menschen, die ganz und gar arm und bedürftig waren und überaus großen Mangel an himmlischen Speisen litten, in ihm reich würden und die reiche der Himmel in Besitz nehmen könnten, so jubelt von Herzen und freuet euch, erfüllt von übergroßer Freude und geistlichem Jubel.
(Klara von Assisi 1. Brief an Agnes von Prag)
Das Fenster – ein adventlicher Ort. Schauen wie „Wächter auf der Zinne“
Mein Fenster zur Welt
Liebe adventliche Gemeinde! Vielleicht nehmen Sie in der kommenden Adventszeit immer wieder einmal die Bibel zur Hand und gehen auf Entdeckungsreise. Ich schlage vor, dass Sie einmal nachschlagen, was es in der Heiligen Schrift über das „Fenster“ als möglichen geistlichen Ort zu finden gibt, z.B. Gen 6,16 (Fenster in der Arche), Ri 6,28; Hohelied 2,9; Buch der Sprichwörter 7, 6.
Farbige Kirchenfenster sind normalerweise nicht zu öffnen; zumindest ist das nicht ihr primärer Zweck; solche ‚Fenster des Glaubens‘ lenken den Blick in eine andere Welt - ganz anders als die Fenster eines Wohnhauses. Das unterscheidet sie auch von den kühlen und fensterlosen Glasfassaden moderner Bauten.
Viele Künstler haben Fensterszenen, Alltagsmomente aufbewahrt, in denen Menschen an diesem Zwischenbereich zwischen drinnen und draußen stehen. Die Meistermann-Fenster in der Heimbacher Salvatorkirche, die den auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Christus wie auf einem „gläsernen Meer“ (Offb 15,2) präsentieren, sind vielleicht die bedeutendstes Fensterflächen in unserem Pfarrverband. Fensterbilder strahlen eine eigenartige Ruhe und Konzentration aus. Nüchtern gesagt, ist ein Fenster nur eine Öffnung in der Mauer, und doch eine segensreiche Erfindung, die das sonst hermetisch abgeschlossene ‚Weltenhaus‘ auftut und mir Entgrenzung schafft. Ich lade uns ein, uns bewusst dieser adventlichen Fenstersituation zu stellen, am offenen Fenster den Blickkontakt mit der Außenwelt zu suchen und dabei die eigene Innenwelt wahrzunehmen. Durch ein Fenster fällt Licht aus der weiten Landschaft in meine Innenwelt. Oft sind Fensterbilder Sehnsuchtsbilder, Fern-Seh-Bilder. In der ersten Phase der Pandemie und des Lockdowns gab es in der FAZ eine schöne Artikelserie „Mein Fenster zur Welt“, in der Literaten und Journalisten im Ausnahmezustand diesen eigentümlichen Fern-Blick des einsamen Beobachters aus dem Fenster und sich selbst dabei in dieser Welt-Distanz wahrnahmen: der alltägliche Blick nach außen und der Blick nach innen. Viele Alleinstehende finden sich am Fenster ein, schauen durch die geöffneten Flügel oder scheu durch die Gardinen nach außen in die Außenwelt. Die Sinne werden am offenen Fenster geschärft; Geräusche werden erlauscht und Vogelstimmen aufgefangen, die sonst untergehen im Zivilisationslärm.
Fenster sind adventliche Orte, Stätten des Lichteinfalls; und Fensterbilder wirken wie Türchen eines Adventskalenders. Die Maler stellen meist weibliche „Rückenfiguren“, dar, die durch nichts abgelenkt sind; Menschen, die auf ihrem Zimmer bleiben können oder müssen, geschützt, ungestört, ungesehen. Fast möchte man den Betrachterinnen zurufen: Drehe dich mal um! Doch ihr Zeitvertreib ist der Blick nach außen; das Fenster wird zur Schwelle in ein ‚Jenseits‘, das unbestimmt bleibt. Selber unbeobachtet, nehmen solche Gucker die Außenwelt wahr. Sie verharren erwartungsvoll, wunderbar passiv, manchmal fiebrig nervös und in erregter Erwartung: wann kommt der erwartetet Gast!? Für mich sind solche Fenster-Bilder ein Ausdruck der Ruhe und Sammlung; wir werden hineingezogen in eine Haltung kontemplativer Weitsicht; es sind in sich ruhende Menschen, die die Welt durch ein Fenster hindurch erblicken, unaufgeregt, ohne hektische Bewegung, ohne Lärm; Betrachter, die aufgehen in reiner Wahrnehmung, denn die Sinne sind „das Fenster der Seele“ (Heraklit).
Ruhiges Ausschauhalten statt hektische Aufbruchsstimmung
Ausschauhalten – das ist eine adventliche ‚Aktivität‘, auch keine „Aufbruchsstimmung“, die wir Prediger zuweilen den Gemeinden abverlangen. Am Fenster passiert nichts weltbewegendes. Ein solches Rückenbild ist das Gegenbild zu meiner Geschäftigkeit: diese Gestalten backen nicht, sie basteln oder telefonieren nicht; sie schmücken ihr Interieur nicht aus, lenken sich nicht ab, verausgaben sich nicht im Kirchenalltag. Völlig in sich ruhend, sind sie – wachend und wartend - auf das Wesentliche konzentriert. Das sind keine Macher und Macherinnen, ‚nur‘ Ausschau Haltende, gespannt auf etwas, was sich - womöglich - ereignet, erwartungsvoll ausgerichtet auf einen Besuch, Das ist die große adventliche Frage Kommt denn jemand? Bist du auf dem Weg oder müssen wir weiter warten, auf einen ganz anderen…? Wann kommst du, wenn du kommst? Wo bleibst du nur? Hoffentlich kommst du! Wirst du je kommen? Frage ich mich ehrlich: Erwarte ich jemanden, diesen fremden Gast, um dessentwillen es die Adventszeit gibt? Fehlst du mir? Vermisse ich dich? Oder bleibe ich in meinem fensterlosen ‚Weltinnenraum‘, ohne Hoffnung auf einen offenen Himmel? Kommt Er wie ein Geliebter (im „Hohelied der Liebe“ ist ein Fenstermotiv aufbewahrt: Hohelied 2,9) - oder bleibt alles unerfüllt und gehen wir auf eine große Leere, auf einen ständig zurückweichenden Horizont zu? Und würde ich den von weitem Erspähten reinlassen oder bliebe er ‚draußen vor der Tür‘? Vertreibe ich mir die großen Fragen mit schnellen Antworten? Habe ich längst meine Erwartungen und Hoffnungen abgespeckt?
Mit Adventsaugen wie ‚Wächter auf der Zinne‘
Und darum ist dieser dichte Ort am Fenster so adventlich und verheißungsvoll, ein besonderer Schwellenort zwischen draußen und drinnen, Zeit und Ewigkeit, manchmal auch Geborgenheit und unheimlich fremder oder kalter Außenwelt. Das Fenster wartet auf Menschen mit Lust auf neue Perspektiven, auf fern-sehende Zeitgenossen, die noch neugierig sind, was von außen kommt: das Licht, das Heil. Adventsaugen! Das wäre ein gespannter Blick, erwartungsvoll, traumverloren, vielleicht skeptisch, ungeduldig, neugierig. Ja, wer kommt an, was kommt auf uns zu, wer besucht uns? Horch, wer kommt von draußen rein! Kommt mehr Licht hinein? Im Advent sind wir Fern-seher – wie die „Wächter auf der Zinne“ (GL 554,1). Adventliche Menschen sind die, deren Blick erwartungsfroh in eine andere Welt gelenkt wird, kein himmelnder Blick in ein Traumland.
Ein Gottesdienst im Advent ist wie ein Fenster zur Ewigkeit, zum Entgegenkommenden. Es ist der Ewige, der das Fenster des Himmels öffnet und hervorschaut, uns zuwinkt, uns den zusendet, den wir so sehnlichst erwarten. Das Spiel der Kinder mit dem Adventskalender passt dazu; Kalendertürchen gehen auf und darin tun wir uns auf für den „fremden Gast“, der von außen kommt und sich in meinem Innenleben einquartieren möchten. Ich warte, weil ich dem uns entgegenkommenden Gott mehr zutraue als meinem Machwerk, auch mehr als den hektischen Reform-Prozessen einer mit sich beschäftigen Kirche.
Kann ich das noch sagen: Es gibt guten Grund, wieder Advent zu feiern, ein Ausschau Haltender zu bleiben, Seinen Besuch zu erhoffen, ihm entgegenzuwarten? Lerne ich am Fenster zur Ewigkeit zu warten und Ihn in dieser schwerkranken Welt zu vermissen? Ist das zu glauben: dass Er ‚aus der Ferne‘ ausgerechnet zu mir kommt? Will ich ihn zuerst erspähen und keinesfalls verpassen? Ihn, der, wenn er kommt, mich vielleicht stört und total überrascht inmitten meiner Geschäftigkeit und Beschleunigung und Zerstreuung…? Wir können Gottes Ankunft nicht beschleunigen. Das Fest kommt doch ohnehin – auch ohne mein Warten. Für manche kommt es zu schnell, für andere viel zu langsam; ein Warten, das kribbelig macht. Ich wünsche mir, dass in meinem Warten noch Hoffnung steckt; eine Prise Sehnsucht. Ich wünsche es, dass man es mir ansieht, dass es Erlösung ist, auf die ich warte. Und wenn ich schon nicht die Fenster öffne und in meinem Mief verkomme – dann beeile dich, Heiland! Reiß die Himmel, die Türen und Fenster auf! Öffne du dich für mich! Es ist höchste Zeit, dass du kommst, damit nicht alles beim Alten bleibt, wie es ist. Höchste Zeit, dass ein Wunder geschieht und du vor der Tür stehst vor dem Wartezimmer dieser Welt. Wird er Wartende finden, wenn er kommt? „Du bist das Letzte, was ich missen möchte!“, so eine Spruchkarte. Nehmen wir uns am Fenster Zeit zu solchen oder ganz anderen Gedanken. Einen erwartungsvollen Advent wünscht
Ihr/ Euer Pfarrer Kurt Josef Wecker
Nachdenkliche Friedhofsgänge
Novembergedanken von Kurt Josef Wecker
Ich wohne neben einem Friedhof; seltsamerweise war das auch so in meiner Kaplanszeit in Gillrath; und fast 14 Jahre lang in Bonn lebte ich neben dem „Alten Friedhof“. Das schmiedeeiserne Eingangstor, das ich hier nebenan auf dem alten Friedhof am Gotteshaus auf dem Burgberg in Nideggen scheppern höre, wenn es geöffnet und geschlossen wird, markiert eine Schwelle zu einer ‚anderen Welt‘. Friedhöfe sind Nekropolen, Erinnerungsorte derer, die verschwunden sind. Zeitgenossen, uns so nahe Menschen, die wir – an Gott verloren haben. Verschwundene Gesichter. Manche Friedhofstore werden bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen. Dann sind die Toten mit sich allein. Der November führt uns auf diese ‚Gottesäcker‘. Wir sehen frisch gepflanzte Stiefmütterchen, durchschreiten die alten Alleen auf gewachsenen Friedhöfen, rechen welkes Laub zusammen, erfahren im Dunkel das flackernde Lichtermeer als Trost. Lichter und Blumen machen den Ort des Todes schön. Noch prägt der Friedhof das Bild unserer Dörfer und Kleinstädte. In Großstädten ist er oft die einzige Grünanlage, eine stille Oase in einem Meer von Häusern: Der Friedhof - ein markanter Erinnerungsort an die eigene Endlichkeit inmitten der Alltäglichkeit. Noch ist der Tod nicht vollständig ausgewandert in die Idylle der Friedwälder, in denen die menschliche Vergänglichkeit mit dem Kreislauf der Natur verschmolzen wird. Friedwälder sind oft weit genug weg sind, um die Geschäftigkeit des Hier und Jetzt zu ‚stören‘. Doch noch hat die Stätte der Toten ihren Platz neben der Stadt der Lebenden, allerdings klar abgegrenzt mit Mauer, Zaun und Tor. Die Lücken unbesetzter Grabfelder werden immer größer.
Friedhöfe versinnbildlichen eine gute Nachbarschaft von Lebenden und Toten. Die Toten sind nicht aus dem Auge, aus dem Sinn … Die Friedhofskultur kann ein uns bereichernder und berührender Teil des Lebens sein, aber sie darf das fortschreitende Leben nicht bestimmen und beherrschen. Wir besuchen die Friedhöfe, wir kommen, verweilen dort eine gewisse Zeit lang und gehen wieder und überlassen die Toten unserem Gott. Totenandenken darf kein Ahnenkult werden.
Einige Male im Jahr weitet sich der kleine Grenzverkehr privater Besuche am Grab zum kollektiven Ereignis; in manchen Orten zur Kirmes und natürlich bei Beisetzungen. Und dann durchkreuzt und bremst der ‚Totenmonat‘ November den Gang des Jahres. Nun spüren wir die Kürze der Tage, die Zumutung der eigenen Sterblichkeit. Wir ‚pendeln‘ hinüber auf die Friedhöfe und stoßen auf unsere eigene Sterblichkeit. Der Friedhof inspiriert uns.So vieles wurde uns damals in der Schule beigebracht. Womöglich habe ich in einem Fach geschwänzt: Die Stunde der Lebenskunde, die den Tod nicht verdrängt. Bedenke, dass du sterblich bist! Sobald ich, sobald wir an das Ende des eigenen Lebens denken, geraten wir womöglich in Panik, oder wir üben uns in der Kunst der Verdrängung. Gibt es eine Lebenskunst des Sterbens? Wer von uns Sterbende begleitet, nimmt eine anstrengende Lehrstunde der eigenen Sterblichkeit auf sich. Wie sehr lasse ich den eigenen Tod an mich heran, der ich so oft darüber predige, der ich in meinen über 35 Priesterjahren hinter Särgen und Urnen herging und ‚unglaubliche‘ Trostworte zu sprechen wage: dass Gott das Leben will und uns nicht zum Sterben gemacht hat, dass Gottes Pläne mit uns weit über das Grab hinaus reichen, dass wir alle Zukunft haben bei ihm. Ja, davon singen wir, predigen wir, das erbitten wir: die Hoffnung auf das Auferstehen. Doch für den Sterbeunterricht bin ich wohl immer noch zu unreif, dieser letzte Unterricht, den uns die Schwerkranken an den Sterbebetten lehren. Es ist oft das Letzte, was uns unsere Lieben lehren, die uns vorangegangen sind - manche sanft entschlafen, andere aus dem Leben gerissen, manche nach hartem Todeskampf.
Wenn das Leben rund läuft, dann sage ich mir: Das Leben ist zu schön, um an den Tod zu denken, an die Zeit, die dann ohne dich und mich weitergeht. Der Philosoph Hans Blumenberg erinnert mich an diese Diskrepanz zwischen Weltzeit und Lebenszeit. Ich mit meiner Lebenszeit nehme nur einen Bruchteil lang teil an der Weltzeit vor mir und nach mir. Das kränkt. Kann das möglich sein: Ein Leben, an dem ich nicht mehr teilhabe? Der andächtige Friedhofsgang erinnert mich an die verdrängte nackte Wahrheit: Nein, ich bin nicht unsterblich. Das tägliche Aufstehen, der Wechsel der Jahreszeiten, die Vorfreude auf den nächsten Sommer, Urlaubsplanungen …; all das ist nicht selbstverständlich.
Im November endet das alte Kirchenjahr; Zeit, um vor Gott Bilanz zu ziehen: Was bleibt in Erinnerung? Was hat Bestand in aller Vergänglichkeit? Unsere Friedhofsblicke sind im November eher rückwärtsgewandt. Wir erleben uns alle als Hinterbliebene. Ein Dichter hatte dafür ein schönes Bild: Wir erleben uns wie in der Eisenbahn, wenn man entgegen der Fahrtrichtung sitzt und zurückschaut, auf das, was längst vorbei ist, Zeiten und Begegnungen, wie vorbeifliegende Landschaften. Das Ziel liegt im Rücken, uns verborgen, doch auf uns zukommend. Und wir nähern uns diesem Ziel an, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir leben und bewegen uns von Gott zu Gott! Darum sind wir nicht friedhofsfixiert. Unsere Blicke und Fragen gehen weit über diesen Ort hinaus.
„Herr Pastor, werde ich nach dem Tod meine Lieben wiedersehen?“ Kannst Du, Gott, der du der Schöpfer „aller Seelen“, vielleicht von hundert Milliarden Seelen bist, die Seelen meiner Lieben im Blick behalten? Und kannst du einmal meinen Seelenfunken am Glühen halten? Gestehen wir uns diese Hoffnungsbitte ein, nicht nur an den Gedenktagen im November: Gott, lass nicht alles vergehen! Schenke ein Wiedersehen! Ich versuche, mit einem Satz des evangelischen Theologen Karl Barth zu antworten: „Ja, ich glaube, dass wir unsere Lieben nach dem Tod wiedersehen – aber die anderen auch!“ Die anderen - alle Seelen! Wir dürfen unvorstellbar groß von Gottes Gedächtnis und seinen unbegrenzten Möglichkeiten denken. Für mich ist die Hoffnung auf die Auferstehung das Gegenstück des Vertrauens auf Gott den Schöpfer: Er hat alles aus dem Nichts geschaffen, er kann das Werk seiner Hände nicht einfach zu Bruch gehen lassen; und er kann auch uns neu gestalten in seiner Schöpferkraft. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie wir uns dann hoffentlich im Himmel wiedererkennen werden.
Wahrscheinlich erkennen wir uns nicht an einer Nelke im Knopfloch. Vielleicht wird diese Frage auch keine Bedeutung mehr haben, denn wir werden „gleichgestaltet“ sein der Gestalt Christi und gemeinsam Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Wir werden verwandelt in die Herrlichkeit der Gestalt Christi. Diese Herrlichkeit ist nicht losgelöst von Jesu Person zu verstehen. Unsre Zukunft hängt am seidenen Faden der Wahrheit Seiner Auferstehung! Das Osterlicht ist der „Glanz“ der Gegenwart Gottes, der über dem Leben Jesu liegt und von ihm ausstrahlt. Seine Heiligkeit, in die wir eintauchen, längst eingetaucht sind in der Taufe, als wir nicht in irgendeine kirchliche Institution, sondern in IHN hinabgetaucht wurden, in Seinen Tod und in Sein Auferstehungsleben. Im Vertrauen auf Jesus Christus verliert die Grenze zwischen Toten und Lebenden ihre irdische Bedeutung. „In ihm“ leben sie alle, Lebende und Tote (Lukas 20,38). Und im Glauben sind die Toten bei Gott lebendiger als wir zufällig hier und jetzt Lebenden. Sie leben beim heiligen Gott. Wir wünschen unseren Verstorbenen Gottes übersprudelnde Heiligkeit.
Wenn wir den Friedhof verlassen, bleibt der Eindruck der Kreuze auf vielen Grabsteinen. Das Kreuz ist eingraviert vor dem Todesjahr; das Erkennungszeichen einer Gemeinschaft, die viele Namen verbindet – das Heilszeichen, welches das Todesdatum – einmal auch mein Todesdatum - mit einem großen Pluszeichen versieht.
Ein trostreiches Fest Allerheiligen / Allerseelen und einen nachdenklichen November wünscht
Euch und Ihnen
Ihr
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Am seidenen Faden – Der ROSENKRANZ, die rettende Glaubenskette
Zum Rosenkranzmonat
Betrachtung von Kurt Josef Wecker
Ist jemals die Tragkraft eines Gebets plastischer dargestellt worden als in diesem ergreifenden Einzelmotiv aus dem 'Jüngsten Gericht' Michelangelos in der römischen Sixtinischen Kapelle?
Wir sehen zwei Menschen im 'letzten Akt', die von der starken Hand eines Engels an einer Glaubenskette empor gezogen werden. Zwei Auferstehenden, zwei offensichtlich Auserwählten wird eine Rettungsschnur zugeworfen. Sind es Eheleute, Mann und Frau? Oder hängen sie zufällig zusammen an dem Seil des Rosenkranzes? Sie klammern sich gemeinsam an diesen 'Rettungsanker'. Sie blicken besorgt nach oben auf die muskulöse Gestalt des Rettungsengels. Und man fragt sich bang: Wird die Schnur reißen oder wird sie beiden zum Heil?
Vor 459 Jahren starb hochbetagt der geniale Maler dieser Szene. Zwischen 1536 und 1541 schuf Michelangelo das 'Jüngste Gericht' in der Vatikanischen Papstkapelle. Gezeigt wird in diesem Spätwerk ein Augenblick, ein unvorstellbares Ereignis: das Geschehen des Gerichts Jeder Betrachter, der das grandiose Wandgemälde nicht nur cool als Tourist wahrnimmt und abhakt, fragt sich: Was wird dann aus mir, wenn der Herr einst wiederkommt? Will ich dann auch dabei sein? Und wie werde ich vor Ihm stehen? Worauf wird es ankommen, wenn Er über mich das Urteil spricht? Wird einer da sein, der mir den Rettungsring zuwirft?
Michelangelo war bei der Entstehung des Freskos ein von Leid und Enttäuschung gezeichneter Künstler. Die Weltfreude des Renaissance-Menschen war dahin, die zerstörerische Einnahme Roms 1527, die Glaubensspaltung und auch persönliche Rückschläge und Verluste haben das ohnehin eher schwermütige Wesen des Künstlers weiter verdüstert. Aus dem riesigen Fresko (mit 391 Personen!) in der Vatikanischen Sixtinischen Kapelle werden zwei Menschen und ein flügelloser Engel fokussiert. Es sind zwei, die aus der Tiefe kommen und an einer rettenden Kette hängen. Sie haben die Auferstehung 'hinter' sich und schweben dem Gericht entgegen. Angstvoll klammern sich an den Rosenkranz wie an ein Rettungsseil. Die Rettungstat des Engels bewahrt sie vor dem Absturz. An dieser Schnur werden sie durch starke Hände nach oben gezogen, in die Nähe des richtenden Christus. Dieser wird scheiden, entscheiden, auserwählen oder in die Unterwelt abstürzen lassen. Hat Er bereits über diese beiden entschieden? Im Schrecken des Jüngsten Gerichts ist es eine fast intime Szene, obwohl die beiden dunkelhäutigen Menschen nicht erlöst wirken. Es heißt, niemand auf diesem Gemälde lächelt. So viele Menschen stürzen in diesem von Christi Erscheinen bewirkten Wirbel nach unten, werden hinabgestoßen oder von einer unwiderstehlichen Sogkraft hinabgezogen; doch diese beiden für uns anonymen Menschen gewinnen an Höhe. Sie hängen gemeinsam, quasi als Seilschaft in einer unlösbaren Schicksalsgemeinschaft verbunden, am seidenen Faden, an einer Gebetskette, vermutlich dem Rosenkranz. Der eine sehr verkrampft, der andere deutlich von der Schwerkraft seines Leibes belastet. Wird die Schnur halten? Wird sie das Gewicht zweier Menschen tragen? Oder zieht sie die Schwerkraft ihrer Leiber unerbittlich hinab? Die Rettung des Menschen ist nichts Menschenmögliches. Bei diesen beiden geht es buchstäblich „wie am Schnürchen“. Das ist übrigens eine Redewendung, die sich vom Rosenkranzgebet ableitet.
Manche sehen in diesem Motiv ein starkes Bekenntnis des Künstlers zum katholischen Glauben, die Nähe des Malers zur katholischen Reformbewegung. Dem evangelischen „allein aus Glauben“ scheint der Katholik Michelangelo das gute, verdienstliche Werk des Rosenkranzgebets entgegenzusetzen. Es sieht so aus, als verherrliche der Maler die Kraft und Bedeutung dieser religiösen Gebetsübung. Sein Zeitgenosse Luther hat das Rosenkranzgebet abgelehnt (nicht jedoch die biblisch geprägte Marienverehrung!). Und viele sehen darin bis heute ein fremdes Gebet, das man mechanisch und ohne innere Anteilnahme abspult. Kann von der Pflege dieses Gebets das Heil abhängen?
Die zwei Menschen hängen an diesem alten Gebetsutensil. Es sind Laien, die in ihrem Leben – vielleicht gemeinsam – das Rosenkranzgebet gepflegt haben. Der Rosenkranz war ein 'Laienpsalter'. Den Betern halfen Gebetsketten, geknotet oder mit Perlen durchsetzt. Paternoster-Schnüre, Ave-Schnüre und eben der 'Rosenkranz' begegnen uns seit dem Hohen Mittelalter. Das waren keine Amulette oder Talismane, sondern Heilszeichen für eine 'zählbare Frömmigkeit'. Gebetszählschnüre gibt es nicht nur im katholischen Christentum, sondern auch im Islam. Die Muslime nutzen die Gebetsketten (genannt: Misbaha bzw. Sibha), damit sie sich im Ertasten der Perlen im Alltag an die 99 Namen Gottes erinnern.
Michelangelos unglaubliche Kunst setzt den Augenblick der Entscheidung über Heil oder Unheil in Szene: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde“. Soll es am Ende das unscheinbare Rosenkranzgebet sein, das uns gemeinsam rettet. Oder eine andere von mir unterschätzte Geste? Wird uns am Ende gar das eine, wahrhaft inbrünstig gestammelte Gebet, die eine Liebestat retten? Hat dieses wahrhaftige Beten 'im Geist und in der Wahrheit' das „Gewicht der Ewigkeit“? Vielleicht werden wir nur ganz selten in unserem Leben das Vaterunser oder den Rosenkranz geistesgegenwärtig sprechen. Das Rosenkranzgebet ist ein einfaches und zugleich 'schweres' Gebet, es kann auch von 'müden Christen' - wie nebenbei, im Gehen, bei der Arbeit - gesprochen werden. Der Rosenkranz ist nach einem Wort des verstorbenen Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher „kein Sessellift, sondern ein Mountainbike der Frömmigkeit“. Dieses Wiederholungsgebet führt in die Konzentration, ist gewissermaßen eine wiederholte 'Tiefenbohrung' in die Welt des Glaubens. Ja, der Rosenkranz vermag im Alltagsleben den Weg in die „Tiefe“ zu bahnen. Im Augenblick des Gerichts aber führt er in die „Höhe“. Wer sich zu Lebzeiten in den Abgrund Gottes gestürzt hat und an der 'Glaubenskette' festhielt, wird am Tag des Gerichts emporgehoben – so die ernste Bildpredigt Michelangelos.
Wie viele Menschen – 'einfältige' und 'kluge' - in Vergangenheit und Gegenwart haben in diesem Gebet Halt gesucht, haben sich an den eisernen Proviant dieser Worte wie an ein Rettungsseil geklammert? Sie konnten es stammeln, wenn ihnen auch sonst nichts mehr einfiel. Ich denke an den berühmten Brot-Rosenkranz eines Kriegsgefangenen aus Dachau, der auch in den Vatikanischen Museen gezeigt wird. Der Gefangene aus Dachau hat sich Brotstücke vom Mund abgespart und sie an Fäden aus seiner Häftlingskleidung aufgereiht. Ähnliches wird von polnischen Häftlingen aus Auschwitz erzählt. Brot-Rosenkränze haben Menschen geistlich über Wasser gehalten.
Am Ende heißt es nicht „Rette sich, wer kann...!“ Wir werden eben nicht allein gerettet, sondern stets mit dem anderen, „im Doppelpack“. „Einer trage des Anderen Last“ (Gal 6,2). Einer sorge sich um das Heil des anderen. Bewegend ist, dass zwei Menschen gemeinsam an diesem Rettungsseil hängen, welches der Engel ihnen hinhält. Womöglich würde die Glaubenskette reißen, wenn der eine Mensch den anderen wegträte, um sich vermeintlich leichter retten zu lassen.
„Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“ (Joh 12,32). Das Wandgemälde Michelangelos wirkt wie eine wortlose gewaltige Predigt über dieses Bibelwort.
Gerade das Detail mit der an der Glaubenskette hängenden Zweiergruppe unterstreicht das Schriftwort. „Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes“ (Lk 1,42), heißt es im Rosenkranz. So wie im Fresko Christus im Mittelpunkt steht, so ist der Rosenkranz kein reines Mariengebet, sondern auf Christus, seinen 'Leib', hin zentriert. Im Blick auf dieses Motiv könnten wir den endzeitlichen Rosenkranz beten mit dem Zusatz: „... der kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten“...
Fragen wir uns: Mittels welcher Zeichen halte ich im Alltag Verbindung zum verborgenen Gott? Hilft mir das Rosenkranzgebet dabei, die Verbindung ‚nach oben‘ nicht abreißen zu lassen? Ist meine Verbindungsschnur zu Gott strapazierfähig, reißfest? Wem werfe ich sie zu? Oder habe ich den Kontakt zu Ihm gekappt? Wen will ich 'mitnehmen' hin zu Gott? Wir Menschen brauchen 'Glaubensketten', um uns an das Geheimnis heranzutasten. Wohl dem, der eine solche Glaubenskette als Rettungsseil hat, für sich und den Anderen!
Michelangelo schreibt in einem seiner Gedichte: „O jene Kette reiche, Herr, mir dar, /Die alle Himmelsgabe an sich knüpft: Den Glauben, den ich fest umklammern möchte. / (…) Schließt Glauben nicht des Himmels Pforten auf?“
Ihnen und Euch einen segensreichen Rosenkranzmonat Oktober
Ihr Kurt Josef Wecker
Ein Lob des Sommers und auf die „gute Sommerreligion“ (H. Heine) des Katholizismus
Das Votum auf die Frage: Sind Sie für oder gegen die Sommerzeit, die Reaktion auf die zweimalige Zeitumstellung im Jahr spaltet die Gesellschaft. Meine Option, sollte das Ritual der Zeitumstellung einmal abgeschafft werden: die Beibehaltung der Sommerzeit auch im Winterhalbjahr. Aber das ist nur mein unmaßgebliches Votum. Vielleicht können nicht alle von Ihnen meine alljährliche Liebeserklärung an diese Jahreszeit nachvollziehen - und mein Eingeständnis, dass ich mir das ewige Leben wie einen nie aufhörenden Sommer vorstelle. Ja, ich weiß, es gibt vermutlich mehr Frühlingsmenschen als Sommer-Fans. Ja, ich weiß auch: Gott hat Sommer und Winter gemacht (Gen 8,22 und Ps 74,17, Ps 104), und dazu noch zwei weitere Jahreszeiten. Alles hat seine Zeit (Koh 3,11f.17) und der Schöpfer liebt die bunte Gnade, die Abwechslung und die Vielfalt. Doch ich muss nicht alle Schöpfungsgaben und Zeiträume Gottes gleich liebhaben und halte früh Ausschau nach Vorboten des Sommers (vgl. Mt 24,32). Ein Supersommer würde mir nie auf die Nerven gehen. Ich werde besonders im Sommer Schöpfungstheologe und besinge die Schönheit dieser Zeit. Soviel Blühen und Reifen war nie! Leben ist schön – dieser Satz geht mir besonders in dieser Zeit oft durchs Gemüt und über die Lippen.
Was predigt mir der Sommer? Vielleicht ist das übertrieben, und diese Jahreszeit wird von mir überschätzt … Schön und irgendwie leichter als sonst; vielleicht auch, weil der Sommer die bevorzugte Urlaubszeit ist. „Geh aus, mein Herz und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit“ (Evangelisches Gesangbuch 503 und in manchen Diözesananhängen im Gotteslob). Ich Stubenhocker bin dann gerne draußen, mit zunehmendem Alter eher im Schatten als in der prallen Sonne, am Strand oder auf einer schattigen Parkbank, auf den Boden gestreckt in einem verwunschenen oder paradiesischen Garten, auf Balkonien oder im Außenbereich der Gartenlokale. Ja, im Sommer werde ich außenorientiert und zugleich langsamer. Ist es das politische Sommerloch, das uns eine Weile von den schweren Themen des Tages ablenkt, die eisig kalten Weltprobleme, die ja leider durch keine Sommersonne weggeschmolzen werden? Nicht für alle ist der Sommer ein Vergnügen. „Ich hasse den Sommer, der mich vernichtet“, dichtet der Rimbaud. Und Gottfried Benn dichtet 1936 „Einsamer nie als im August.“. Bei diesem Dichter kommt der Sommer auch darum schlecht weg, weil Benn ihn mit einer „Erfüllungsstunde“ vergleicht, mit einer erhofften Zeit, die nun einfach ‚da‘ ist. Wenn sich etwas am Gipfel oder Ziel erfüllt, kann man schwermütig werden, weil der Höhepunkt nun erreicht ist und im Sommer das Tageslicht wieder nachlässt … Fans anderer Jahreszeiten singen eher ein Loblied auf den sehnlichst herbeigewünschten Frühling oder werden nachdenklich wegen des Herbstes mitsamt den dramatischen Veränderungen in der Natur, die er mit sich bringt; oder sie gewinnen dem grimmigen Winter – den ich fürchte- zu freundliche Züge ab. Mit Sommer assoziieren einige allererst Wespen, Sonnenbrand und Schwitzen, Extremwetter, Dürre und Waldbrände, verregnete langweilige Ferientage, Hitzeperioden und ersehnte Abkühlung, schlechten Schlaf wegen der warmen Nächte und wenn die Luft ‚steht‘. Oder die abgeernteten staubigen Felder erinnern viel zu früh an den Herbst und stimmen melancholisch. Auch die Bibel weiß um die Gefahren und Mühen des Sommers, die unerbittliche Hitze und das Lechzen nach Kühlung (Jes 25,4 und Sir 34,19); sie empfiehlt Augenschutz vor der gleißenden Sonne (Sir 38,29 und 43,3) und preist den wohltuend kühlenden Morgentau im Hochsommer (Sir 18,16), sie gibt der Sehnsucht nach Schatten Ausdruck (Jes 49,10) und stöhnt: Wer hält es aus in dieser Bullenhitze! (vgl. Sir 43,2f). Die Heilige Schrift weiß um die tödliche Kraft der Hitze (Offb 16,9; Sir 14,27) und den Durst an einem Sommermittag, den Jesus spürt (Joh 8,12). Doch der Bibel war die Sehnsucht nach einem kühlenden Bad im Meer, nach einem Sonnenbad am Strand und dem Besteigen sonnenumglänzter Gipfel fremd. Für mich ist die dritte Jahreszeit eine wunderbare Gabe des Schöpfers; und ich kann Gottfried Keller verstehen, der dichtet: „Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt.“. Es ist buchstäblich Zeit, sich zu betrinken am Überfluss der Farben und Gerüche, am Glanz des Sonnenlichtes, an der Farbe der Erdbeeren und Kirschen, der Bläue des Himmels und des Meeres, an den Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden freien Zeit. Jetzt wo das Jahr wie im Gleichgewicht ist -“die große Waage ruht“ (GL 465,1), die Zeit stillsteht und Sommernachtsträume wahr werden, da wird der Hunger nach Wärme und Licht gestillt, der uns allen im Blut liegt. Könnten wir doch -anders als Rilke – in der Gegenwartsform sagen: Herr, dieser Sommer ist groß!
Der zum Protestantismus konvertierte Jude Heinrich Heine wagt einen augenzwinkernden Konfessionsvergleich und sagte es unnachahmlich (im 3. Teil seiner ‚Reise von München nach Genua‘), im Blick auf einen sommerlichen Dombesuch in Trient: „Man mag sagen, was man will, der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es lässt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man träumt dort die kühle Andacht, ein heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend in ihren Nischen, weiblich gesinnt verzeihen sie sogar, wenn man ihre eigenen holden Züge in den sündigen Gedanken verflochten hat, und zum Überfluss steht noch in jeder Ecke ein brauner Notstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.“
Würde man die Kirche mit einer Jahreszeit vergleichen, dann wohl am ehesten mit dem Winter (sprichwörtlich ist Karl Rahners Dictum von der „winterlichen Kirche“) oder dem Spätherbst. Mit dem Frühling oder Sommer vergleichen wir unsere gegenwärtige Kirchenphase weniger.Wir stellen uns Jesus vor, wie er im „galiläischen Frühling“ auf einer Erfolgswoge schwimmt und wunderwirkend durch seine Heimat zieht. Wir denken an seine Sommer-Gleichnisse von Saat und Ernte (vgl. Mt 6,25-34).
In Gottesdiensten im Sommer feiere ich ein Dankeschön für geschenkte Zeit. Ich weiß nicht, in welchem Lebensalter ich (schon oder noch nicht) bin. Ist es noch Sommer? Vielstimmig predigt der Sommer zu mir. Ich entdecke im Sommer eine Facette meines Gottesbildes die ich in den ‚Übergangsjahreszeiten‘ und im Winter vergesse: Gott geizt nicht. Er mutet uns Vieles zu, die Hitze des Alltags, Dürrezeiten, „Durst und Staub der langen Reise“, das Geblendet-Werden von seiner brennenden Nähe und auch das Suchen und Fragen nach Ihm angesichts seiner tiefen Verborgenheit. Er gönnt uns Großes: Licht, Leben, Früchte, Reife, Wärme. Verschwendung; Geiz und Ausschweifung haben nicht immer den Geruch der (Tod)Sünde. Und vielleicht bin ich deshalb – trotz vieler Sympathien für die protestantische Frömmigkeit und Musik – so gerne ein katholischer Christ, weil uns Katholiken der quasi barocke Überschwang eher im Blut liegt, ein Glücksgefühl, eine sinnliche, überbordende Lebensfreude, die Lust am Genuss, überwältigt vom Füllhorn und der Großzügigkeit des Schöpfers. Und so singe ich mit Ihnen wie ein Kind: „Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da…“
Ihnen und Euch einen großen, erholsamen Sommer!
Kurt Josef Wecker
Heimbach -ein besonderer „Ort von Kirche“
Die Wallfahrt zur „Schmerzhaften Mutter“ – Ein Fest mit einem Gnadenbild
von Kurt Josef Wecker
Immer wieder werden wir, die wir uns mit der ‚Schmerzhaften Mutter von Heimbach‘ verbunden fühlen, gefragt: Was habt Ihr Besonderes zu bieten? Was haben Menschen in Heimbach verloren, was haben sie dort zu suchen und was erhoffen sie, dort zu finden? Warum zieht es Menschen seit so vielen Jahrhunderten zu einem Andachtsbild und seiner anspruchsvollen Botschaft? Wir Christinnen und Christen in der GdG Heimbach/ Nideggen, die wir Tür an Tür mit diesem Glaubensschatz leben, müssen Auskunft geben, werben und eine Willkommenskultur schaffen, damit dieser Pilger- „Ort von Kirche“ attraktiv bleibt und Zukunft hat. Das Bild, das im ‚goldenen Schrank‘ des Schnitzaltars stellt, will gedeutet werden. Ein Wallfahrtsort lebt auch von seinen Erzählungen und Ursprungslegenden. Sie lassen den spezifischen Flair eines Pilgerortes ahnen, die Wirkungsgeschichte seiner mit dem Kermeter-Wald und Mariawald tief verbundenen Entstehungsgeschichte. Ein Wallfahrtsort wie Heimbach ist geprägt von einem unverwechselbaren Charisma. Ihr ist ein Genius loci eigen. Und dieser ‚Genius‘ ist Maria.
Glück im Unglück
Heimbach hatte Anfang des 19. Jahrhunderts „Glück im Unglück“. Das beschauliche (und bis zum Bau der Rurtalbahn) ein wenig entrückte Dorf geriet geistlich aus seiner Randlage und wurde unerwartet Hüterin eines Bildes und eines kostbaren spätmittelalterlichen Schnitzaltars. Arm war die Gemeinde (auch wenn der Straßenname „In der Goldkuhl“ von kühnen Träumen erzählt...); und von einem Fremdenverkehrsort war damals nicht die Rede. Durch das unerwartete Geschenk einer kleinen ausdrucksstarken Holzfigur erfuhr der Ort vor 210 Jahren eine Bedeutungssteigerung und wurde zum Kurort für Leib und Seele. Ursprünglich gehörte das Gnadenbild nicht zur Genese Heimbachs und nahm folglich auch keinen siedlungs- bzw. wirtschaftsgeographischen Einfluss auf diesen Ort. Die schlichte Figurengruppe der Mater dolorosa mit ihrem toten Sohn wurde nach Aufhebung des Klosters Mariawald nicht versteigert, sondern gottlob der Gemeinde überlassen. Gut, dass dies erst 1804 geschah; denn am 23.5.1687 hatte ein verheerendes Feuer große Teile Heimbachs mitsamt der um 1476 neu errichteten Pfarrkirche S. Clemens in Schutt und Asche gelegt; und das hätte wohl auch das Bild zerstört. Doch dieses befand sich seit 1470 bzw. 1486 bis 1804 im Kermeter, „auf Berscheid“, in guten Händen. Zisterzienser waren Hüter des Bildes. Alte Wallfahrtspfade führten hinauf in die Waldeinsamkeit. Diese bewährten Strecken der Fußpilger vergangener Jahrhunderte wurden durch die Übertragung des Gnadenbildes „unserer Lieben Frau vom Walde“ aus dem Maria-Wald ins Tal umgelenkt. Dem kleinen Ort wurde von höherer Hand ein kostbarer Schatz zugespielt. Weltgeschichte beeinflusste die Heilsgeschichte Heimbachs. Der Ortsgemeinde erhielt Gelegenheit, die festliche Begehung eines Andachtsbildes in einer Abtei im Wald zu beerben, weiter zu führen und neu zu inszenieren. „Moddejoddes-Shlèf“ heißt der Pfad, auf dem mit Erlaubnis des Aachener Bischofs Berdolet die nur 52 cm hohe Holzfigur am 22.Juni 1804 hinabgetragen wurde. Ohne die durch Säkularisierung (die Aufhebung der Zisterzienserabtei Maria Wald 1795/97) und französische Besetzung der linken Rheinlande bewirkte Übergabe des Vesperbildes mitsamt des kostbaren Antwerpener Schnitzaltars an die Pfarrgemeinde in Heimbach gäbe es manches nicht in diesem Ort. Es gäbe dort keine zweite Kirche (neben der 1725 eingeweihten Clemenskirche die Salvatorkirche von 1981), keine Wallfahrtskapelle (von 1956, also den heutigen Kommunikationsraum der St. Clemens-Pfarrgemeinde), keine durch die Wallfahrt bedingten Brauchtümer, keine Oktavwoche, kein halbjähriger sommerlicher 'Saisonbetrieb' der Wallfahrt.
Die Spätfolgen und Nebenwirkungen einer Laienfrömmigkeit
Der Strohdachdecker (Ströhedecker) Heinrich (der) Fluitter (=Flötenspieler?) wurde, ohne es zu beabsichtigen, zum Gründer der Wallfahrt aus dem 15. Jahrhundert. Er hat sich um 1470 mit dem Erwerb dieses Bildes eine Freude gemacht; das Bild entsprach seiner ur-persönlichen Frömmigkeit, die jedoch charakteristisch war für die spätmittelalterliche Glaubenspraxis vieler einfacher Laien. Er, der mit der Herstellung von Strohdächern beschäftigt war, hat sich quasi in dieses Bild verliebt. Er kehrte zunächst nach Heimbach zurück, lieh sich „neun marck“ und erwarb in Köln diese Schnitzfigur. Er trug sie dann von Köln eigenhändig in den Kermeter. Dort „auf Berscheid“ setzte er sich als Einsiedler für einige Jahre dem Anblick der Karfreitags-Szene im Wald aus. Doch nie hat er daran gedacht, dass sich dieses machtlose Bild, das wohl schon um 1479 Platz in einer hölzernen Kapelle fand, zum attraktiven Magneten und Zielpunkt eines Wallfahrts-Festes entwickeln könnte. Fluitter wurde wohl schon früh in seiner Waldeinsamkeit von Hilfesuchenden 'gestört', die im Blick auf das kleine Bild Entlastung und Orientierung erfuhren. Dem 'Verehrungs-Gegenstand’ ging also bald ein guter Ruf voraus; er erweckte fromme Aufmerksamkeit; an ihm geschahen Zeichen und Wunder; er beschäftigte auch Gelehrte. So entwickelte sich eine lokale Wallfahrt in den Wald. Für kurze Zeit übernahmen Laien nach dem Tod des „Ströhedeckers“ den Hütedienst am Bild. Nachdem man zunächst vergeblich Dürener Franziskaner angefragt hatte, ließen sich Zisterzienser-Mönche aus Bottenbroich bei Kerpen im Wald nieder und wurden für ca. 300 Jahre Hüter des Bildes. Es fand Schutz in der am 11.11.1511 eingeweihten und mit 12 Altären ausgestatteten Klosterkirche. Um 1520 entstand der (vielleicht um 1518 von Wilhelm von Berg und seiner Gattin Eva von Hetzingen gestiftete) Schnitzaltar, in dessen Zentralnische das Bild Aufstellung fand. Fortan sorgten sich die Zisterzienser im Priorat im Walde, im 'Monasterium ad nemus beatae Mariae virginis’, um die geistliche Begleitung der Wallfahrer.
Die Säkularisierung bewirkte einen Ortswechsel des Bildes, das nun in den Heimatort Heinrich Fluitters gelangte. Der Bekanntheitsgrad Heimbachs (als marianischer Hauptwallfahrtsort des Bistums Aachen) jedenfalls wurde durch die Präsenz der unscheinbaren Holzfigur der 'Schmerzhaften Mutter' mit ihrem toten Sohn in ihrer Pfarrkirche erheblich gesteigert; und der flandrische Schnitzaltar, in den das schlichte Bild eingefügt wurde, scheint so etwas wie das „goldene Wunder“ von Heimbach zu sein. Spannungsreich kommen zusammen, was unter den Augen des Glaubens zusammengehört: das künstlerisch anspruchslose Gnadenbild und der prächtige goldene Rahmen. Heimbach erging es wie Maria. Die unbedeutende Magd wurde in Nazareth erhöht; und der um 1804 eher ärmliche und karge Ort erfuhr eine unerwartete Aufwertung und musste eine neue seelsorgerische Herausforderung annehmen. Das Gnadenbild fand zunächst in der alten Clemenskirche, dann in einer eigens 1956 dafür errichteten Wallfahrtskapelle und bis heute in der modernen, großräumigen, zeltartigen Salvatorkirche einen Schutzraum. In ihm wird die spätmittelalterliche Pietà aufbewahrt und von den Pilgern verehrt. Unter das Zeltdach treten Pilger, die ähnlich wie Camper mit leichtem Gepäck, aber vielfach mit schweren seelischen Lasten unterwegs sind zur 'Mutter der Schmerzen'. Menschen im Leid suchen Zuflucht bei der Frau, die im Leiden innere Größe zeigt. Sie kommen nicht ins „Jammertal“, sondern ins schöne Rurtal.
Ein Gnadenbild feiern
Heimbach hat weder Marienerscheinungen noch besonders kostbare Reliquien, Heiltümer oder ein Heiligengrab zu bieten; auch der legendäre Aufenthalt der hl. Irmgard von Süchteln auf der Burg verleiht dieser Gemeinde keinen besonderen geistlichen Flair. Es ist allein dieses stille Bild und seine geheimnisvolle Anziehungskraft, das den Glauben der Menschen seit Jahrhunderten bewegt. Anders als der vergoldete Flügelaltar (und die bekannten Glasfenster von Georg Meistermann in der Salvatorkirche) macht das Bild nichts her, befriedigt keine Augenlust, beeindruckt keinen Kunstliebhaber.
Um die geheimnisvolle Skulptur hat sich nur ein spärliches Brauchtum entwickelt. Früher gab es Andachtsbildchen und Votivtafeln; auch Krücken wurden wohl nach erfahrener Stärkung dankbar zurückgelassen; heute steht das Vesperbild, unberührbar für seine Verehrer/innen, erhöht in der Nische des als Blickfang inszenierten Schnitzaltars in der modernen Kirche. Es gibt ein auf die Geschichte des Bildes hin zugeschnittenes Wallfahrtslied, das Pfarrer Peter Hoffmann 1965 verfasst hat. Für 1904 ist auch die Prägung einer Wallfahrtsmedaille bezeugt. Devotionalien werden fast ausschließlich in der Kirche angeboten; eine 'Andenkenindustrie' und Verkaufsstände gibt es nicht. Andere Brauchtümer und Charakteristika Heimbachs („Heimbachesel“, „Heimbachstühlchen“...) erwuchsen unabhängig von diesem Wallfahrtsziel.
Auch wenn das Bild für Kunstkenner womöglich keine „Augenweide“ ist - trotzdem oder gerade deshalb wurde Heimbach zu einem volkstümlichen Wallfahrtsziel mit einem überregionalen und nicht nur bistumsgebundenen Einzugsbereich. Die Prozessionsgebiete sind weit, denn auch Fußgruppen aus der Erzdiözese: aus Brauweiler, Zülpich und dem Raum Erftstadt finden den Weg zur Wallfahrtsstätte. Anders als beim Fest der Zeigungen der Heiligtümer in Aachen, Mönchengladbach, Kornelimünster oder Trier, ist die Pietà von Heimbach permanent zugänglich. Eine solche 'niederschwellige' Zugänglichkeit gehört zum Charisma eines volkstümlichen Gnadenbildes, auch wenn es in Heimbach durch seine erhabene Stellung in der Nische des Flügelaltars und durch die erforderliche Alarmanlage auf Distanz gehalten wird und beinahe wie ein ‚Kultbild‘ wirkt.
Dieser Figur wird also seit Jahrhunderten ein Fest bereitet. Wallfahrt – das ist ein zielgerichteter Fuß-Weg, eine Lockerungsübung des Kirchen-Leibes, eine sportliche Spiritualität. Das Andachtsbild markiert den Fluchtpunkt einer festlich begangenen geistlichen Reise, einer Tagesreise mit oder ohne Übernachtung, eines geordneten Prozessionsganges. Auch wegen der Anreise vieler mit dem Pkw hat sich die Verweildauer vieler Pilger/innen auf einige Stunden verkürzt. Die Oktavwoche bot früher den äußeren Anlass für einen „Krammarkt“ und eines Feuerwerks-Spektakels am Ende der Oktavwoche.
Der katholische Glaube liebt diese zeitlich begrenzte und geordnete Ekstase. Wallfahrt hat mit 'Verschwendung', selbstvergessener Aufbruchsstimmung und Überschwang zu tun, ist eine willkommene Unterbrechung des Alltags, ein Ausnahmezustand für Jung und Alt, also ein außergewöhnliches Fest, ein schönes „Handlungsspiel“ (Iso Bäumer) für Jung und Alt, ein ernstes Erwachsenenspiel der Bruderschaften und der Fußgruppen, ein Fest für Leib und Seele. In früheren Epochen, denen das gegenwärtige Maß an Abwechslung, Mobilität und Zerstreuung abging, wurde der unbeschwerte Fest-Charakter einer Wallfahrt intensiver empfunden als heute. Viele Menschen lebten das Jahr über auf diesen Höhepunkt zu. Auch wenn es Not- und Pestzeiten waren, die dem Bild Zulauf verschafften, stets war die Bildverehrung auch das Fest freudiger Danksagung. Wallfahrt war (und ist) eine Ablenkung vom schweren Dasein, ein Ausbruch aus der Langeweile, auch eine schöne Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, die Welt im Nahbereich kennen zu lernen und kleinere Geschäfte und Einkäufe zu erledigen. Da lag es nahe, dass die kirchliche Obrigkeit und der absolutistische Staat in der Phase der Aufklärung diesem 'frommen Treiben' mit Misstrauen, Verboten und Kontrollen begegneten; auch die Preußen reglementierten im 19. Jahrhundert diese manchmal übermütige Laien-Frömmigkeit. Sie vermuteten hinter diesem katholischen Fest Subversion und aufkeimende Anarchie, ein unkontrolliertes „Geläuf“, arbeitsscheues Vagabundentum...
Glaubensfest - mehr als Brauchtum
Die Heimbach-Wallfahrt war und ist ein Fest der Sinne. Glockengeläut und Weihrauch, triumphale oder gemütvolle Marienlieder und Pilgercafé gehören dazu. Die alljährliche Kernzeit der Wallfahrt beginnt am „Schmerzensfreitag“, dem „schmerze Friedach“ (dem vierten Freitag nach Karfreitag) und endet im Frühherbst, dem Sonntag nach der Heimbacher Kirmes (Kirchweihfest der am 9.9.1725 konsekrierten Clemenskirche). Die Pilger begehen den Höhepunkt der Wallfahrtssaison in den schönen hellen Sommerwochen, also dann, wenn sich unser Lebensgefühl nach außen verlagert. Spielerisch gehen die Wallfahrer mit dem Gnadenbild um. Sofern es das Wetter und der Konservierungszustand des Gnadenbildes zulassen, wird die Pietà zu Beginn der Wallfahrt nach draußen in die Rur-Auen, in den Kurpark begleitet. Und einmal im Jahr gedenken wir des Ursprungsortes der Bildverehrung durch Heinrich Fluitter in einer Heiligen Messe am ‚Bildstöckchen‘ im Walddom zwischen Mariawald und Wolfgarten. Maria wird inmitten der Schöpfung unter freiem Himmel gefeiert. So mancher Wallfahrer geht über den Kreuzweg – gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem ehemaligen und dem jetzigen Wallfahrtsziel - die Strecke hinauf zur früheren Trappistenabtei, manche pilgern Woche für Woche zu diesem „Bildstock“ zwischen Mariawald und Wolfgarten und erinnern sich an den uns unbekannten Ort, an dem das Bild zunächst im Wald stand und in Heinrich Fluitter den ersten, stillen Verehrer fand. Gewissermaßen wurde er zum Prototypen eines postmodernen Pilgers und einer individuellen Beterin, die sich vielleicht wortlos in die leere Salvatorkirche setzen – der geschnitzten Personengruppe gegenüber - und sich von dem Gnadenbild berühren und ergreifen lassen. Dann geschieht das Wunder, dass sich die im Bild vergegenwärtigte Gottesmutter und ihr Sohn und die stillen Betenden einander Präsenz und Aufmerksamkeit schenken.
Alle Beteiligten spüren, solch eine Bildverehrung ist mehr als das mühsame Aufrechterhalten spätmittelalterlicher Frömmigkeit und dieses Glaubensfest ist mehr als Brauchtum und fromme Folklore. So manche 'religiös neutrale Touristen' werden im Angesicht der Pietà zu Pilgern, manche Spaziergänger reihen sich ein in die jahrhundertealte Kette der Wallfahrer und werden zu Bildverehrern.
Seltsam ist, dass eine so ernste Figur, die uns den Anblick des toten Gottessohnes und die Erinnerung an die Todesstunde Jesu zumutet, zum Festanlass und -ziel wird. Die Leidensthematik, die das Bild, den Passionsaltar und das auf den Karfreitag hin konzentrierte Patrozinium der Salvatorkirche so prägt, gibt – äußerlich gesehen – wenig Anlass zu einem Fest der Lebensfreude, doch stand sie gerade den Pilgern nahe, die in Pestzeiten (1629/30) und während des 30jährigen Krieges den Weg zur Schmerzhaften Mutter von Mariawald fanden. Viele finden sich wieder in diesem so anrührenden Bild und verbinden ihr Leid mit dem Leid der Gottesmutter („Compassio“).
Das Bild ist nicht gefällig, es bleibt schwer und eine katechetische Herausforderung. Wie passt der Passionsweg Jesu, den das Vesperbild und der Schnitzaltar wie in einer unerbittlichen Bilderfolge festhalten, zum ausgelassenen Wallfahrtsweg? Kann dieses schwere Bild Trost schenken? „Das Gute ist in gewissem Sinne trostlos“, nimmt Franz Kafka wahr. Wallfahrer verkörpern das 'Trotzdem' des Glaubens. Sie verehren das Bild, sehen doch darüber hinaus und hoffen auf den, der uns am Ende unserer Lebensreise mehr zeigen wird als die „schöne Aussicht“ auf ein Gnadenbild. Das ausdrucksstarke Andachtsbild - auch wenn es wurmstichig geworden und auf fachkundige Restaurierung angewiesen ist - ist belastungsfähig. Es ist ja kein eingefrorenes Standbild des ewigen Karfreitags, sondern Teil einer Sequenz, die sich auf Ostern hin öffnet, ein transitorischer, vorübergehender Augenblick. Darum lohnt sich die Bewegung nach Heimbach zu der Frau, die so still und andächtig und treu bei ihrer Sendung bleibt, den „Fronleichnam“ hält und uns Jesus Christus wie eine Kommunionhelferin darbietet. Darum kann man auch weiterhin die ernste Pietà (das Bild des Mitgefühls) in einem frohen Fest feiern.
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Literatur:
Heinrich Appel, Die Vesperbilder von Heimbach und Drove: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 23 (1960), S.259-279.
Georg Andreas Bachem, Hengebach. Eine städtebauliche Untersuchung nach gegenwärtigem Befund und vor dem Hintergrund der urkundlichen Überlieferung, Abtei Mariawald 1985.
August Brecher, Pilger zum Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter. 250 Jahre Heimbach-Wallfahrt der Pfarre St. Johann Baptist zu Vicht, Aachen 1994, S. 9-31.
Franz Büttgenbach, Mariawald. Ein Bild des Trappistenordens, dessen Wirkung und soziale Bedeutung, Aachen 1897.
Paul Fischbach, Mariawald, Mönchen-Gladbach 1892.
Albert Gerhards, Katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche Heimbach/Eifel, Erstausgabe 1991, 2. neu bearbeitete Auflage München 2004.
Cyrillus Goerke, Das Zisterzienserkloster Mariawald, 4. Auflage Abtei Maria Wald bei Heimbach 1937.
L. Grubenbrecher, Zur Geschichte der Cisterzienserklöster Bottenbroich und Mariawald in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 26/27 (1874), S. 372-379, 392-397.
Maria Anna Hahn, Siedlungs- und wirtschaftsgeographische Untersuchung der Wallfahrtsstätten in den Bistümern Aachen Essen Köln Limburg Münster Paderborn Trier, Düsseldorf 1969.
Ursula Hagen, Die Wallfahrtsmedaillen des Rheinlandes in Geschichte und Volksleben, Köln 1973.
Peter Hoffmann, Die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von Heimbach 1471 – 1964, Heimbach o.J.
Ders., Die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von Heimbach, in: Pejo Weiß (Hg.), Maria – Zu Dir kommen wir! 350 Jahre Wallfahrt von Monschau zur Schmerzhaften Mutter nach Mariawald-Heimbach 1646-1996, Monschau 1996.
Wilhelm Kaspers, Die Ortsnamen der Dürener Gegend in ihrer siedlungsgeschichtlichen Bedeutung,
Johann Heimrich Kaltenbach, Der Regierungsbezirk Aachen, Aachen 1850.
Heinz Köllen, Abtei Mariawald auf dem Kermeter in Heimbach (Eifel), Köln 1994.
Mariawald. Geschichte eines Klosters, hg. von der Abtei Mariawald, Heimbach/Eifel im Selbstverlag 1962.
Heinrich Pütz, Das Schloss Heimbach und die Grafen und Herren von Hengebach. Beiträge zur Geschichte des Herzogtums Jülich (neu bearbeitet nach der Erstauflage von Regidius Müller und Johann F. Martin Aschenbroich), Düren 1905, S. 51-57.
Ders., Heimbach und Umgebung, Trier 1904.
Christian Quix, Die Grafen von Hengebach; Die Schlösser und Städtchen Heimbach und Nideggen, Aachen 1839.
Norbert Saupp, Heimbach. Geschichte einer Stadt, Heimbach 1993.
Hans Peter Schiffer, Kirchen, Kapellen und Kreuze im Stadtgebiet Heimbach, Weilerswist 2008.
Karl Schorn, Eiflia sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel, 2 Bände, Bonn 1888 und 1889.
Ernst Wackenroder, Die Kunstdenkmäler des Kreises Schleiden = Paul Clemen (Hg), die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz Bd XI,2), Düsseldorf 1932, Neudruck 1982.
Kurt Josef Wecker, Die Pietà von Heimbach. Ein spätmittelalterliches Andachtsbild und seine schweigende Predigt, in: 200 Jahre Wallfahrt zum Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter in Heimbach, Festschrift zum Jubiläum 2004, Heimbach 2004, S. 43-56.
Christoph Wendt, Heimbach und die Rureifel, Streifzüge und Entdeckungen, Aachen 2012.
Beate Weiler-Pranter, Heimbach. Historische Stadt im Nationalpark Eifel, Düsseldorf 2007.
Dieter P. J. Wynands, Geschichte der Wallfahrten im Bistum Aachen, Aachen 1986.
Ostern 2023:
Was habe ich im Grab verloren
und was habe ich im Grab zu suchen?
Ostergedanken nach dem Besuch der Jerusalemer Grabeskirche
von Kurt Josef Wecker
Wer geht schon freiwillig ins Grab? Ins Grab Jesu gehen Pilgernde
freiwillig und gelangen auch wieder ins Freie. Ich nehme Sie mit an einen
seltsam - faszinierenden Ort, die Grabeskirche in Jerusalem mit der Rotunde,
die die Ädikula, die das Heilige Grab umgibt. Als Heiliglandpilger setze ich
mich erneut der Anziehungskraft dieses Grab aus. Ja, zum wiederholten Mal
habe ich mich eingereiht in die Warteschlange ins Grab. Ich will da rein!
Tage zuvor kroch ich hinein ins Mariengrab im Kidrontal nahe des Gartens
Gethsemane. Und jetzt der Höhepunkt. So oft ich schon hier war - scheu
betrete ich erneut die Kapelle mit den Resten des Felskammergrabes in der
Grabeskirche von Jerusalem, wenige Meter von der Kreuzigungsstätte
Golgotha entfernt. Das Bild lenkt unseren Blick vom Heiligen Grab hinauf
in die kürzlich restaurierte Kuppel des Zentralbaus in Jerusalems Altstadt,
der seit Kaiser Konstantins Zeiten den Ort markiert, an dem Jesus am 7.
April des Jahres 30 in einer Felsengrabkammer in einem aufgegebenen
Steinbruch - damals noch vor den Toren der Stadt - beigesetzt wurde.
Konstantin, auch durch seine Mutter Helena unterstützt, ließ ab 326 das
Heilige Grab aus dem Felsen herauspräparieren, den Felsen drumherum
abtragen. Er schuf einen Kuppelbau darüber und vollzog so die
Inbesitznahme und Sicherstellung eines Grabes! Diese Stätte umkreisen wir
Christen - wie die Muslime die Kaaba in Mekka. Wir blicken durch
geheimnisvolle Löcher ins Innere der Grabkapelle, durch die hindurch der
griechisch-orthodoxe Patriarch am Karsamstag das Osterlicht
hindurchreichen wird an die Schar der Gläubigen, nachdem das
unerklärliche Feuerwunder in der Kapelle geschah. Dann verteilt sich das
Licht aus dem Grab buchstäblich wie ein ‚Lauffeuer‘ unter den Gläubigen.
Wer in die „Grabeskirche“ tritt, die die Orthodoxen „Anastasis“,
„Auferstehungskirche“ nennen, scheut keine Wartezeiten, um Augenblicke
in einem Leerraum zu sein, in dem ER nicht mehr ist. Wer es an diesem Ort
aushält, der wirkt danach ‚mitgenommen‘.
Wer die Grabeskirche als Höhepunkt einer Heiliglandfahrt besucht,
verspricht sich große religiöse Emotionen, feuchte Augen, klopfende
Herzen, Schaudern angesichts der Ewigkeit! Doch – dieses Gotteshaus ist
kein Himmel auf Erden und bereitet keinen spirituellen Event. Alles ist
irritierend in der „Mutterkirche der Christenheit“, wenig erhaben, etwas
chaotisch und diffus; fromme Geschäftigkeit. Uns fehlt der Überblick; dieser
Bau aus der Kreuzfahrerzeit ist ein Konglomerat von Kapellen, Treppen,
Gruften, momentan eine Dauerbaustelle, ein Gleichnis der Kirche und
Kirchen in ihrem chaotischen, zerstrittenen und manchmal unansehnlichen
Zustand. Nur frühmorgens und am späteren Abend ebbt die Massenflut derer
ab, die ‚es‘ gesehen haben wollen. Am frühen Morgen gehört der Bau den
Beter/innen und den hier ansässigen Glaubensgemeinschaften. Tagsüber
wird manche fromme Erwartung enttäuscht: keine andächtige Stille, keine
barocke Pracht, keine ordentlichen Abläufe; man erlebt eher einen
Konfliktraum. „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“, so lautet
ein empfehlenswerter Dokumentarfilm über die Zustände und Abläufe in der
Auferstehungskirche. Die sechs unter sich zerstrittenen Konfessionen unter
dem Dach der Grabeskirche beten nebeneinanderher, ohne sich eines
Blickkontakts zu würdigen. Es kommt immer wieder zu kleinen Rangeleien.
Eifersüchtig verteidigen sie ihre Orte und Zeiten. Dieser Bau ist das
ungeschönte Abbild eines oft desolaten Kirchenzustands, kein himmlischer
Thronsaal, keine schöne Gegenwelt. Darum ist die fast unansehnliche
Ästhetik der Grabeskirche Jesu in Jerusalems Altstadt ehrlicher als die
makellose Pracht des römischen Petersdomes, die Grabeskirche des Petrus.
Das Outfit der Grabeskirche versinnbildlicht eine Kirchenkrise, die alle noch
so gut gemeinten Reformversuche und aller synodale Aktivismus nicht
beseitigen können. Was, wenn die Kirchen die „Grabmäler Gottes“
(Friedrich Nietzsche) wären? Selbst am heiligsten Ort der Christenheit, in
der Grabeskirche, stoßen wir auf unzählige Bruchstellen, auf Pathologien der
Frömmigkeit und einer armseligen Kirche! Sei’s drum!
Ich muss da unbedingt rein ins Grab! Welche religiöse Erfahrung
erhoffe ich hier? Wird es ‚Klick‘ machen? In der Warteschlange habe ich
Zeit, mir Rechenschaft zu geben über das, was mich darin erwartet. Lange,
viel zu lange halte ich mich womöglich vor dem leeren Grab auf. Seltsam ist
das Heilige Grab, weil ich darin trotz mancher religiöser Accessoires Leere
erlebe. Der Leichnam, der darin lag, fehlt. Christus, du fehlst an diesem Ort!
Ich greife ins Leere wie die Frauen am Ostermorgen. Sehnsucht nach Leere?
Es ist die fromme Pilgersehnsucht, die mich packt und anzieht. Sehnsucht ist
die Sucht nach dem, der fehlt. Ich vermisse Jesus. Wohin ist der Körper Jesu
verschwunden? Scheu und ergriffen werde ich eintreten, die Marmorplatte
berühren und küssen. Die marmorne Altarplatte bedeckt den Felsenrest, der
übrigblieb, nachdem ein muslimischer Kalif im Jahre 1008 große Teile der
felsigen Grabhöhle wegzuschlagen befahl. Das Grab Jesu ist ein
merkwürdiger Hoffnungsort, löst gemischte Gefühle aus. Ich werde Steine
betasten, Felsen küssen, Stoßgebete murmeln. Suche ich wirklich hier Jesus,
den Gekreuzigt-Auferstandenen? Oder genieße ich die stolze Bestätigung
und Befriedigung: Ich bin auch hier gewesen, ich habe es geschafft ...? Ich
habe mich zum wiederholten Male davon überzeugt: Das Heilige Grab ist
kein „Beinhaus“. „Hic non est“ (Markus 16,6). Er ist nicht hier! Was tun
wir also hier? Wir könnten enttäuscht sein, weil wir nichts finden und nur
Steine betasten – wie die Juden den Stein der Westmauer (Klagemauer), wie
die Muslime unter dem Felsendom den Abrahamsfelsen Morija streicheln.
Nur Steine, nur Ritzen, nur Leere! Ist der Besuch im Heiligen Grab ein
Stelldichein mit der Stätte des Nullpunkts? Im Grab rieche ich kein
Osterparfüm, sondern stickige Luft, Schweiß, abgestandenen Atem, kalten
Weihrauchduft. Der Stein vor dem Grab ist zwar weg, aber kein Pilger,
keine Touristin kann ungehindert eintreten. Der Weg ins Grab Jesu ist eine
Einbahnstraße (anders als beim Mariengrab). Man muss kehrt machen; der
Eingang ist der Ausgang; auch darum stauen sich die Grabbesucher vor
diesem höhlenartigen Raum. Da, wo der Rollstein lag und wo die römischen
Besatzer ihre Wächter postiert hatten, stehen nun zuweilen ruppige
griechisch-orthodoxe Wächter, die den ‚Personenverkehr‘ am Eingang
regulieren und bestimmen, wer sich wie lange in den beiden winzigen
Kammern aufhalten darf: in der eigentlichen Grabkammer und in dem
Vorbau, in dem der Osterengel das unfassbare Geschehen gedeutet hat.
Ab ins Grab! Alles andere ist unwichtig, belehrt uns der Gide und
ich gebe ihm Recht; es zählt diese Grabesvisite, das Betreten eines
Leerraums, die kurze private Frömmigkeit, das erregende Gefühl, dass man
leibhaftig am Ort der „Zeitenwende“ ist. Ein Grab als Sehnsuchtsziel.
Heiliglandpilger wollen wenigstens einmal im Leben dorthin: ins Grab und
zuvor hinaufklettern auf den Golgothafelsen. Der Gide verspricht: Da bringe
ich euch hin! Dafür müsst ihr Zeit mitbringen! Und so kämpfen wir uns
friedlich und doch energisch den Weg dorthin frei und ahnen, wie im
Mittelalter die Kreuzritter den Zugang zum Heiligen Grab mit allen Mitteln
freikämpfen wollten. Der Kurzbesuch in der zweiteiligen Grabkammer kann
enttäuschen und verwirren, er kann aber der Höhepunkt nicht nur einer
Heiligland-Pilgerfahrt, sondern eines ganzen Glaubenslebens werden. Ich
war schon weit mehr als dreißigmal dort. Die Spannung wächst jedes Mal:
Gleich bin ich da, wo ER lag und ‚es‘ passiert ist ... Und doch: Ich bin zu
spät, wie damals die Frauen mit ihren Salbgefäßen. Hier hat sich Gott längst
zu schaffen gemacht, ohne dass es dafür Zeugen gab; in aller Herrgottsfrühe.
Gott war’s, der hier die Friedhofsruhe gestört hat. Ich betrete das Geheimnis
der heiligen drei Tage. Ob‘s wahr ist? Nur, wenn Ostern, die Auferweckung
des gekreuzigten Jesus, wahr ist, dann hat unser Leben Zukunft. Ich möchte
tiefer glauben an das Wunder, welches Grab und Tod übersteigt. Wenn ich
in das Heilige Grab eintrete, werde ich mit meiner eigenen Endlichkeit
konfrontiert und blicke im Glauben weit über diesen Nullpunkt
menschlichen Lebens hinaus. Christi Auferstehung erlebe ich hier nicht.
Sein Körper ist weg. Das muss man aushalten. Wir haben keine
Verabredung mit Ihm. Wenn Christus mir nahe kommt an heiligsten Stätten,
wenn ich ihm plötzlich und unerwartet in die Arme laufe, dann wäre dies ein
Geheimnis des Glaubens und der souveränen Freiheit Jesu Christi. Trotzdem
will ich da rein! Wir stellen uns an, schubsen, reagieren verbissen auf
Vordrängler mit unwirschen Bemerkungen, als ob es im Inneren dieses
seltsamen Gebäudes etwas umsonst gäbe. Ja, wer weiß -vielleicht gibt es
etwas umsonst ...?! Eine unerhörte Verheißung! In der Warteschlange hat
man Zeit, sich zu fragen: Was habe ich hier verloren? Will auch ich dem
Engel der Osterfrühe begegnen? Und werde ich enttäuscht sein, wenn mir
dieser Engel nicht begegnet, dieser Freudenbote, der den tapferen Frauen am
Ostermorgen Beine machte und sie wegschickte von dieser Felsengruft?
Deren Gefühle sind überliefert: Furcht und Schweigen, Entsetzen und
fassungsloses Erstaunen. Mit welchen Gefühlen werde ich aus dem Grab
wieder auftauchen: mit Bewunderung, Entsetzen, Staunen, mit Befriedigung
und dem stolzen Gefühl, es hineingeschafft zu haben? Ja, was habe ich hier
verloren? Mich überkommt ein wenig das schlechte Gewissen. Ich komme
mir vor wie einer, der dem Engel des Ostermorgens nicht glauben will. Er
hat die Frauen belehrt: Stopp! Bis hierhin und nicht weiter! Macht kehrt und
sucht ihn anderswo! Kehrt um, lasst das Grab hinter euch! Geht nach
Galiläa, dorthin, wo alles gut anfing! Frei läuft er draußen herum. Er ist so
frei, euren Weg zu kreuzen, wo ihr es nicht vermutet. Dort ist er, der
Lebendige! Geht in euren Alltag, wo ihr dem lebendigen Christus nicht
entkommen könnt. Dort umgibt euch seine Geistesgegenwart von allen
Seiten, bereitet er euch Fortsetzungsgeschichten von Ostern. Das Grab ist
leer, der gekreuzigte Held erwacht! Er ist ganz woanders. Du, Herr, bist
nicht zu fassen, nicht von Gräbern aus Stein und nicht von frommen
Besitzansprüchen der Kirchen. Er ist uns voraus, läuft frei in unserem
Galiläa herum. Er hat einen Vorsprung. Wir sind ihm nicht gewachsen.
Ostern ist größer als die sterbliche Kirche, größer als mein skelettierter
Glaube, größer als meine allzu bescheidene Hoffnung. Die Kirchen können
ihn nicht an heiligen Orten konservieren und in Besitz nehmen. Der
Lebendige kommt ungefragt und gibt Antworten auf die Fragen, die wir
kaum noch zu stellen wagen: Was wird mit mir, wenn ich im Grab liege?
Wer wird für die stummen Toten sprechen?
Na, wie war’s im Grab? Ja, ich bin darin gewesen, als Pilger, nicht
als ‚Ritter vom Heiligen Grab‘. Danach ging es zurück ins Hotel, danach
nach Galiläa, dann zum Flughafen, dann nach Hause in die vertraute
Umgebung der eigenen vier Wände. Hat sich etwas geändert, weil ich 45
Sekunden im Heiligen Grab war, am Nabel der Welt? Habe ich dem Tod ins
Auge geschaut und die Hoffnung neu belebt, dass das Wunder des
Ostermorgens auch auf dich und mich überspringt? Oder geht alles so weiter
wie zuvor? Würde sich an meinem Leben und dem ganzen Kirchenbetrieb
etwas ändern, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wenn Jesus tot wäre?
Es wäre schön, wenn uns Pilger nicht bloß die Neugier, sondern die
Sehnsucht nach unserer eigenen Auferstehung ins Grab Jesu triebe, wenn
wir im Heiligen Grab nicht nur unserem eigenen Grab ins Auge schauen,
sondern neu zu hoffen wagen, dass der Lebendige mich mitnimmt in das
„himmlische Jerusalem“.
Wir Sterbliche kommen nicht weiter als bis
zum Grab. Doch mein Leben ist keine Reise zum
eigenen Grab – mein Pilgerweg geht weit darüber
hinaus in den Ostergarten, der sich auch uns öffnen
wird. Dieses leise Versprechen Gottes höre ich im
Grab Jesu. Das leere Grab von Jerusalem, vielleicht
der heiligste Ort der Christenheit, ist keine
Monstranz; denn der Leib Christi fehlt, will
anderswo entdeckt werden. „Entdecke mich!“ –
dazu lädt die Heiligtumsfahrt in Aachen ein. Das
Grab ist ‚nur‘ ein Weg-Weiser, eine Folgeerscheinung des österlichen
Handelns Gottes am Gekreuzigten, ein Drehpunkt. Dieser denkwürdige Ort
reicht nicht für unseren Osterglauben. Die leere Erinnerungsstätte fasziniert,
aber tröstet nicht. So prickelnd der Augenblick im leeren Grab auch ist: das
ist kein Ort zum Verweilen. Der Osterengel untersagt die lange
Verweildauer in diesem Un-Ort (Marc Augé). Das Grab Jesu ist, wie seine
Geburtshöhle, ein bloßer ‚Transitort‘ Christi. Haltet euch nicht zu lange an
solchen heiligen Orten auf, so auratisch und suggestiv sie auch sind. Los,
wagt den Ortswechsel, sucht den Auferweckten anderswo! Sucht ihn dort,
wo ihr es kaum für möglich haltet. Er ist uns näher als wir denken. Überall
kann er uns mit seiner Präsenz überraschen. „Niemals können wir sagen:/
dort nicht“ (Gottfried Bachl).
Ihnen und Euch ein frohes und ermutigendes Osterfest!
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Reflexionen am Weihetag: Seit 35 Jahren Priester sein
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in der GdG Heimbach/ Nideggen,
wie man etwas altmodisch sagt: ich gehöre nun 35 Jahre „zum geistlichen Stande“. Normalerweise predige ich selten übers Priestertum oder thematisiere auch ‚die Kirche‘ kaum. In diesen Tagen um meinen Weihetag herum denke ich zurück an diese Stunde, als ich mit einigen Mitbrüdern am 20. Februar 1988 mit klopfendem Herzen auf dem Teppich, vor dem Altar in der Bischofskirche lag und den heiligen Vorgang der Priesterweihe über mich ergehen und in mich einsickern ließ. Was habe ich damals von der Handauflegung durch Bischof Klaus Hemmerle erwartet? Wurde ich da irgendwie neu gemacht? Vielleicht hatte ich in diesem Augenblick nichts Großes im Kopf, erwartete keine Einflößung von Geisteskraft und übernatürlichen Begabungen, von ungeahnten Einfällen und übernatürlichen Möglichkeiten. Damals bei dieser Hoch-Zeit und noch bei der anschließenden Primiz hat mich noch ein spürbar volkskirchlicher Rückenwind hoch leben lassen. Hatte ich mir eingebildet, mir werden kraft dieses Weiheaktes bestimmte geheime Einsichten zugänglich gemacht, die ich zuvor nicht besaß? Wurden wir Neupriester kraft der Weihegnade fit gemacht für den anstrengenden Auszug aus einer allzu vertrauten Kirchenlandschaft? Hielten die Priesterausbildung und die Weihe einen „geistlichen Vitamincocktail“ bereit, der uns Anfänger widerstandsfähiger machte für den Umgang mit den Umbrüchen, die damals bereits in der Luft lagen und die uns alle schneller eingeholt haben als geahnt – mit all den Folgen, die wir bis heute gerne verdrängen? Ja, ein bisschen erhofft man sich als junger Weihekandidat, dass in der Priesterweihe eine mysteriöse Übertragung von Allmacht, Allgegenwart und Allzuständigkeit stattfindet, eine Impfung mit übernatürlicher Energie, gepaart mit der problematischen Einbildung, ich besäße als Priester nun ‚mehr‘ vom heiligen Geist als Sie, liebe Gemeinde; als hätte er einen besseren Draht zu Gott oder zu Petrus als die ‚Normalsterblichen‘, als werde ein Priester wie ein Schamane oder ein Druide mit Geheimwissen, exklusiven Privilegien und Geheimnissen ausgestattet, die den Kleriker zum Vertreter einer „Elite“ macht, zum Träger von Geheimnissen, die nicht oder nur selektiv an die Öffentlichkeit gehören… Als griffen wir Privilegierte gnädig in eine Schatzkiste, aus der wir den Bedürftigen übernatürliche Gaben austeilen dürfen (oder diese Austeilung verweigern) … Sicherlich kamen bei mir damals große Gefühle hoch - und dazu die Sorge, jetzt bloß nichts falsch zu machen bei der Choreographie der Weihe. Damals war ich bereit, mich einzulassen auf einen uralten Ritus, der uns Neupriester einweist in eine besondere Aufgabe und ausstattet mit geistlichem Reiseproviant. Und doch: Was wurde anders, nachdem mir der Bischof die Hand auflegte?
35 Jahre bin ich nun auf dem Dienstweg. Man kennt sich inzwischen in vielen Bereichen aus, ist im Kirchenjahr zu Hause, beherrscht manches aus dem ff, hat Gebete in- und auswendig parat, predigt zuweilen harmlos redselig daher. Anderes wurde mir nach 35 Jahren fremd, die Heimat Kirche wurde fremder, alte Gewissheiten und selbstsicher heruntergebetete Behauptungen sind angeknackst. Das Vertrauen in die Kirche ging vielen verloren. Der Missbrauchsskandal desillusioniert und schockiert. So viele Zeitgenossen gehen zur Amtskirche und dem Amtsträger auf Distanz. Einer wachsenden Mehrheit ist das, was Kirche verlautbart, tut und feiert, einfach nur noch gleichgültig. Ja, das schmerzt. Doch trotz dieser Brüche mache ich weiter; instinktiv vertraue ich in schwachen Stunden einer gesunden Routine und dem Heiligen Geist, die jeweils erwarteten guten und tröstenden Worte punktgenau zu finden und die liturgischen Zeichen mit schlafwandlerischer Sicherheit zu beherrschen. Als ‚Pilgerbegleiter‘ auf vielen Wallfahrten kenne ich mich aus an so manchen heiligen Orten und bin – das ist die Folge der wiederholten Besuche unbeschreiblicher Stätten - gewissermaßen durch nichts mehr zu überraschen. Vieles ist schon mal da gewesen. Man bewegt sich auf bekannten Gleisen, manchmal mit dem Leichtsinn eines Tänzers auf dünnem Eis. Nach 35 Jahren auf dieser Dienstreise lasse ich die Jahrzehnte wie eine rasante Bahnreise Revue passieren. Ereignisse kommen in der wehmütigen Rückschau in den Sinn, auch Aktionen und Initiativen, die sich im Rückspiegel als überflüssig, vergebliche Liebesmüh, als wirkungslos erweisen. Unzählige Planungssitzungen kommen schemenhaft ins Gedächtnis, auf denen man Sitzfleisch ausgebildet hat, seine Zeit und auch die Zeit der anderen ‚totgeschlagen‘ hat.
Und dann gab es auch das: wunderbare Unterbrechungen und Augenblicke, für die sich ein Priesterleben lohnt. Ich glaube, die Aufgabe der Kirche ist es, nüchtern gesagt, solche heilsamen österlichen Unterbrechungen zu gestalten und Gott Raum zu lassen, damit ER wirkt, ihm diesen Segensraum offen zu halten, nur das Drumherum zu , nur die Bühne für Seinen Auftritt zu inszenieren. Unersetzbar ist der Dienst, Menschen das erlösende Wort zuzusprechen, das nicht von mir stammt, ihnen eine Kraftnahrung zu reichen, die nicht von dieser Welt ist. Diese Momente, etwas zu geben, was nicht ich bin und habe, sind das, was im Priesterleben zählen; sie sind mir unendlich wichtiger als Organisation und Bautätigkeit. Unersetzbar in der Erinnerung an die 35 Jahre sind die Trauerfeiern, in denen wir uns - allen Ernstes - an das kommende Heil erinnern lassen und die Kostbarkeit jedes Menschenlebens im Gedächtnis halten. Oh ja, es gab in diesen 35 Jahren so viele Namen, Ereignisse, Gesichter, Versuche, Bruchstücke, Orte, Erkenntnisse … auf meinem priesterlichen Weg. Und auch so viel wieder Vergessenes, gleichgültig vertaner Alltag, die immer wieder aufblitzende Freude am Dienst, leider auch der Zynismus und Sarkasmus über den Zustand des Lebensraumes Kirche, in dem man Dienst tut, aber auch das Staunen über die Schönheit der Liturgie, der Gotteshäuser und Kunst in unserer Kirche.
In den 35 Jahren musste auch meine Priestergeneration aushalten, was auch Ihnen, vor allem den Älteren, zugemutet wird: So viele Abschiede, Reduzierung, so viel Absterben, Desillusionierung. Nichts ist mehr selbstverständlich, so vieles fließt … Die Abwärtsspirale im kirchlichen Leben - wie ist sie zu unterbrechen? „Die Zeichen des Heils sind stärker als die Zahlen des Unheils“, sagte Klaus Hemmerle. Oh ja, wir starren wie Karnickel auf die Schlange auf diese Zahlen, die nichts Gutes verheißen, Kirchenaustritte, innere Emigration, Leerraum. Doch wir erleben hoffentlich den heilen Kern unserer Kirche, feiern sakramentale Zeichen, die ich nicht habe, sondern nur Hungernden und Dürstenden weiterreiche. Wir finden und hören Worte, die zu Herzen gehen, geben die Einladung weiter zum großen Innehalten vor Gott, auf den alles ankommt. Wir wollen uns helfen, das „Effata“ zu glauben, , das ich in der Taufe dem Täufling im Namen Jesu zuspreche, dieses „Öffne dich“ mit allen Sinnen für das Geheimnis, ohne welches du und ich nicht wären. Dazu sind wir Priester da, um das „Vergiss-mein-nicht“ Jesu wachhalten. Seelsorger richten Jesu Bitte um unser Gedächtnis weiter, denn Er bittet um unsere liebende Aufmerksamkeit.
Diese Sendung dürfen wir Priester wagen trotz mancher Enttäuschung, weil man im Kirchenalltag auch verzweckt wird zum Funktionär, Manager, „Ritendesigner“ und Verwaltungsexperten. Zunehmend zählt man in den Augen der Öffentlichkeit zu den Exoten und letzten Mohikanern. Angesichts des Rückgangs der Priesterweihen stehen wir fast auf der Nulllinie. Immer weniger gibt es von uns, die sich auf die Reise ins Unbekannte im priesterlichen Zeugendienst einlassen. Wer wird das in Zukunft tun - IHN essbar und hörbar gegenwärtig halten, wo doch Christi Angesicht auf Erden tief verborgen und darum übersehbar ist? Ihn in zerbrechlichem Brot und verfliegendem Wort den Gemeinden und den „religiösen Individualisten“ hinüberreichen?
Wir Priester sollten das – ansteckende -Staunen nicht verlieren, dass Er sich auf uns Menschen einlässt, um bei uns zu sein, dass er Menschen findet, die sich ohne Absicht auf die „wertlose Wahrheit“ (Eberhard Jüngel) des Evangeliums einlassen. Wir dürfen vor Gott Menschen sein, die auch in sich eine zunehmende Müdigkeit und Lustlosigkeit erfahren, den Verlust der anfänglichen Begeisterung, das traurige Mitansehen-Müssen einer sterbenden Kirchengestalt, Ohnmacht angesichts des Abwanderns vieler, die früher engagiert dabei waren, den wachsenden Ärger über die Schönrederei derer, die uns weismachen wollen, dass durch die Strukturreformen alles besser werde.
Am meisten bedrückt mich der fatale Eindruck, als plustere sich diese eher armselige Kirche auf, als schiebe sich die Kirche ungebührlich dazwischen, als verwechsle sie sich mit dem lieben Gott, als ginge es bei den strukturellen und synodalen Aktivitäten und schweißtreibenden Reformdebatten um den Bestand der Kirche als solche, um ihr eigenes Überleben, ihren Einfluss, ihre geschickten Strategien der Selbsterhaltung. Der ganze Aufwand, den die Kirche um ihre eigene strategische Positionierung in der Moderne betreibt, geht mir auf den Wecker. Diese zeitraubende und Ressourcen verschlingende Hyperaktivität kreist um eine allzu menschliche Institution. Das Bemühen um die Formierung der Kirchengestalt absorbiert die Aufmerksamkeit für die Nähe des unsichtbaren Gottes. Das nervt mich nach 35 Jahren zunehmend: dieses Getue mancher in der Institution Kirche, der Selbstgenuss, die Selbst-Faszination, die Selbstbespiegelung, auch das Selbstmitleid der Kirche! Als sei die Kirche um ihrer selbst willen interessant. Interessant ist sie nur, wenn sie einen ganz Anderen interessant macht: den verborgenen Gott, der sich nicht aufdrängt. Doch dieses Gerücht von Gottes unentrinnbarer Nähe wird oft auch in der Kirche als eine erledigte Mär von gestern behandelt. Gott wirkt dann bestenfalls als ein sicherer Besitz, den die Kirche wie in einem Behälter durch die Zeit trägt. Dabei vergisst sie: Es geht nicht um das Überleben der Kirche, sondern um Sein Leben, sein Dasein-für alle Welt, um das Bezeugen der Osterbotschaft. Die Auferstehung Jesu ist der Nucleus des Glaubens und das unvorstellbar schön-schwere Ereignis, ohne welches ich nicht Priester geworden wäre. Liege ich falsch mit der Wahrnehmung, dass viele diese Tat Gottes als ein Märchen weltfremder Apostel und Theologen betrachten? Oder als ein Symbol und Impulsgeber fürs Weitertragen der blassen „Sache Jesu“? Und würde die Kirche noch weiterwurschteln, wenn ER im Grab liegen geblieben wäre? Ohne Christus und seine gnadenhafte Präsenz wäre der Priester ein moderner Kirchenmanager, der alles daran setzen müsste, eigenmächtig den Kirchenbetrieb auf Teufel komm heraus irgendwie am Laufen zu halten. Doch – ein solcher Priester wäre eine tragische Figur, ein Ritter von der traurigen Gestalt.
Der Zahn der Zeit nagt nach 35 Jahren an jedem und jeder von uns. Immer mehr gerate ich auch an die Grenze des Schaffbaren. Oft war ich in den 35 Jahren nicht sonderlich kreativ und bin Ihnen Wichtiges schuldig geblieben, habe mich verheddert in hektische und kurzatmige Problemlösungsaktivitäten, geriet in selbstverschuldeten Stress, nahm eine versteckte Machtlust an mir wahr, getarnt als demütige Nächstenliebe; ich wurde zuweilen zum Moralapostel, verbreitete Resignation und erging mich in Rückzugsphantasien, wurde gelähmt vom Zuviel an Erwartungen und dem Ärger an der Starrheit und Unbeweglichkeit mancher Entscheidungsprozesse.
Hoffentlich lerne ich mehr als bisher die Kunst des Lassens, der Selbstbegrenzung, des Sich-Zurücknehmens, den Mut zur Lücke, die Fähigkeit zum Raum Schaffen für andere, den Service des schlichten Wege Bereitens, des Unruhig-Machens und Mitsuchens nach dem Gott, der fehlt und im Unscheinbaren entdeckt werden will. Als Priester möchte ich mich nicht als Mittelpunkt oder allzuständigen Dreh- und Angelpunkt gemeindlichen Lebens halten. Kirche wird auch nach mir und ohne mich weitergehen. Ich hoffe, mich nicht ungebührlich in den Vordergrund zu schieben und dabei vergessen zu machen, dass ich bestenfalls wie der Täufer Johannes nur Zeigefinger bin auf den, der da oben und zwischen uns thront. Ich möchte es mir leisten dürfen, auch ratlos, sprachlos und hilflos zu sein.
Und hoffentlich werden wir uns das Staunen bewahren über das Unfassbare, das auf uns zukommt und zeichenhaft unter uns aufblitzt! Hoffentlich wahrt die Kirche sich den Respekt vor den religiös Uninteressierten, denen, die da draußen sind, arm an Glaubens und Sicherheiten, den von kirchlichen Amtsträgern Verwundeten, den Erschütterten und den stillen Beter-innen, die in unserem kirchlichen Planen kaum noch vorkommen. Dankbar bin ich für so viele, die immer noch, gerade jetzt in dieser oft ziemlich unansehnlichen Kirche ehrenamtlich dabei bleiben. Das ist der Reiz dieser unübersichtlichen Zeit: Ich darf Priester sein in einer Kirche des Übergangs, des Wandels, auch der Abschiede und Abbrüche, des Verlustes von ehedem unhinterfragtem Selbstverständlichen und der noch ungeahnten neuen Entdeckungen …
Vieles im priesterlichen Dienst ist sehr vorläufig und zeitlich begrenzt. Wo ist und bleibt dann noch der bescheidene und doch unverzichtbare Ort des Priesters, wenn alles darauf ankommt, dass Christus die Mitte ist, wenn auch der Priester nur als Ministrant und Assistenzfigur zur Seite treten darf, damit ER zum Vorschein kommt? Vergessen wir nicht: Christus war kein Priester! Im Himmel wird es den Priester, den Bischof und Papst nicht mehr geben …! Im himmlischen Jerusalem braucht uns niemand mehr. Doch hier auf Erden werden wir ‚gebraucht‘, weil wir alle Pilger sind, angewiesen auf Weggefährten, Wegkundige, Geheimnisträger, Mystagogen, die den Proviant der Liebe Gottes miteinander teilen und sich von Ihm anstrahlen lassen. Wichtiger als die Priesterweihe ist darum die Taufe, die uns alle zu Tempeln Gottes (vgl. 1 Kor 3,16f) erbaut und uns die Befähigung zutraut, uns im Gebet mit Christus zu vernetzen.
Als mir der Bischof vor 35 Jahren die Hand auflegte, wollte er mir und den Kollegen das Mehr Gottes deutlich machen. Darin sagte er uns: Du bist bejaht durch Gott und die Kirche, trotz der Beschränktheit deines Könnens. Versuche also das, was in dir ist, fruchtbar zu machen für die Menschen, damit wir alle in eine Christusbeziehung hineinwachsen und uns gegenseitig aufmerksam machen auf Christi Geist in uns und zwischen uns. Dieser priesterliche Dienst gelingt manchmal etwas langweilig, etwas komisch und ungeschickt. Denn es ist ein Abenteuer, mit Gott hausieren zu gehen und ihn riskant dort zur Sprache bringen, wo er stört, auch an den Orten, wo nach ihm nicht mehr gefragt wird.
Zuweilen scheint es, als seien wir Priester Narren, Clowns, höchst merkwürdige Gestalten, über die immer mehr Zeitgenossen mit dem Kopf schütteln, die irgendwie linkisch im Evangelium herumstochern. Wenn uns das gelänge, einander Lust zu machen auf den Unersetzbaren, auf das Faszinierteste, was es im Christentum gibt: den auferweckten, lebendigen Christus, dann lohnte sich weiterhin diese vor 35 Jahren begonnene Dienstreise … Und dann darf auch der Seelsorger einfach nur dastehen, horchen, staunen und leise andeuten: Gott ist da! „Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweiget“ (GL 387). Ein Priester ‚macht‘ Gottes Nähe nicht, er wartet auf Sein Entgegenkommen …. Mehr nicht.
Wir sind Arbeiter, keiner Baumeister.
Wir sind Diener, keine Erlöser.
Wir sind Propheten einer Zukunft,
die nicht uns allein gehört. (Oscar A. Romero)
Mit guten Segenswünschen für die vorösterliche Zeit der Vorfreude auf das Fest der Auferstehung Jesu
Ihr
Kurt Josef Wecker
beim anklicken wird das Bild ganz dargestellt
Heruntergekommen in die heruntergekommene Welt:
Die Geburt Jesu in Ruinen
Weihnachtsbetrachtung von Kurt Josef Wecker zur
‚Anbetung in Ruinen‘ aus
Heimbach
Die Ruine als Mahnmal
Messdienerinnen und Messdiener aus Nideggen haben sich in diesem Jahr entschieden, die Geburt Jesu in einer Ruine zu lokalisieren. Der Heiligen Familie wird in der Johannes-Kirche ein ziemlich lädiertes Dach über dem Kopf geboten. Ruiniert war die Johanneskirche auch durch die Folgen des 2. Weltkrieges. Eine größere Restaurierung steht an und wird sich bis Ende 2024 hinziehen.Seit den Ereignissen des 11. September 2001 und nun erneut angesichts der zerstörten Städte in Syrien und der Ukraine hat der Blick auf „Ruinen“ eine erschreckende Aktualität gewonnen: eine Welt inTrümmern. Zerstörte Stadtlandschaften, unbewohnbare Straßenzüge, apokalyptisch
zerpflügte Landschaften, Ereignisse, in denen Menschen in einstürzenden Bauwerken ihr Leben verloren. „Ruine“ ist kein schönes Wort. Wer will sich schon an die
Vergänglichkeit aller menschlichen ‚Machwerke‘ erinnern lassen? Ruinen
halten uns einen Spiegel hin. Alles hat ein Ende. Manche denken an
Bauruinen, die sinnlos in der Landschaft stehen, weil etwas in der Planung
schiefgelaufen ist oder an architektonisches Chaos. Ruine - damit verbinden
wir unbrauchbare Gebäude, Einsturz, unaufhaltsamen Verfall, Niedergang,
Zerstörung, Verlust, Spuren des Verlorenen, die Verwüstungen der Zeit. Das
lateinische „ruere“ bedeutet: Zusammenstürzen, sinken, einstürzen. Wir
sehen an archäologischen Stätten zerstreute Trümmer, oft als Ergebnis eines
katastrophalen Vorgangs, von Krieg, Brand, Naturkatastrophen. Der Zahn der
Zeit nagte an den Gebäuden. Vor Jahren war ich in den Ruinen des syrischen
Palmyra, einer Weltkulturstätte; diese ist nun von den „heiligen Kriegern“ des
‚Islamischen Staates‘ und syrischen Soldaten im Krieg fast zerstört worden.
Zerstörte Ruinen. So gehen Erinnerungsorte unwiederbringlich verloren. Es
klaffen Leerstellen und Narben in der Landschaft und im Stadtbild. Soviel
„Unorte“, soviel Schutt und Staub, so viele Bruchstücke und Trümmerreste,
irgendwann überwuchert oder abgetragen. Wir denken auch an die ‚schönen
Ruinen‘, majestätisch aufragende Trümmer, wie in Ägypten oder Rom,
archäologische und nostalgische Erinnerungsstätten, quasi Grabdenkmäler
einer vergangenen Epoche, die als Fragmente Ruhe und Erhabenheit
ausstrahlen und das elegische Gefühl von Wehmut und einem traurigen
Frieden wecken. Sie erzählen vom himmelstürmenden Triumphalismus
vergangener Größe. Ihre andächtige Betrachtung wird zum Bildungserlebnis.
Um solche kolossale Trümmer rankt sich eine Ruinenromantik, ein Ruinenkult.
„Warum ist es am Rhein so schön?“ Auch wegen der Burgruinen! Stumme
Zeugnisse der Hochentwicklung früherer Architektur haben ihre Zeit gehabt.
Sie wurden Geschichte und erzählen wortlos von menschlicher Hinfälligkeit
und verlorener Größe, vom irreversiblen Zusammenbruch ganzer Kulturen
und Imperien, von vergangenen Religionen und ausgestorbenen
Adelsfamilien. Irdische Pracht und selbst menschliche Gottes- und
Götterverehrung tragen ein Verfallsdatum. Zurück bleiben verwaiste Tempel
sterblicher Religionen. Es scheint, als haben irgendwann die alten Götter diese
Stätten verlassen. Manche Tempel (wie das römische Pantheon) wurden zu
christlichen Kirchen ‚umgewidmet‘ und damit gerettet. Die Kultstätten des
Gestern haben ihre Zeit gehabt. Das Leben, auch das Gebetsleben ist aus
ihnen geschieden. So offensichtlich zerbröselt die Macht dieser Welt. Einige
Bauwerke verwandeln sich zum Mahnmal wie St. Kolumba in Köln mit der
„Maria in den Trümmern“. Andere Ruinen werden recycelt, man schlachtet sie
aus; sie werden billige Lieferanten von Baumaterial und Kalk. Sie werden
‚niedergelegt‘ und besiegt von den Stürmen der Zeit und dem Bauhunger. Eine
eigenartige Schönheit geht von diesen Resten aus, auch weil sie uns die
Wahrheit über den Zerfall aller irdischen Macht und Herrlichkeit, aller stolzen
Selbstüberheblichkeit und Prunksucht drastisch vor Augen führen. Die Ruinen
faszinieren als Gleichnis dieser Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit des
stolzen Bemühens, mit Menschenenergie etwas ‚für die Ewigkeit‘ zu schaffen.
Irgendwann werden sie formlos, gewinnt die wuchernde Natur die Oberhand.
Stall, Höhle oder Ruine?
„Auferstanden aus Ruinen“, so begann der von Johannes R. Becher
stammende der Text der DDR-Nationalhymne. Seit den 70er Jahren wurde der
Text nicht mehr gesungen und die Hymne nur noch instrumental aufgeführt.
„Geboren in Ruinen“ – gilt das für den Weltenretter Christus? Die
Geburtsstätte Jesu in Bethlehem - wie sah sie aus? Welche Eingangshalle war
für das Kommen des Messias vorgesehen? Besaß Jesus ein schützendes Dach
über dem Kopf, als er das Licht der Welt erblickte? Kam er in einem zugigen
Stall oder unter einem offenen, überdachten Durchgang zwischen zwei
Häusern zur Welt, in einem ruinösen Palast oder doch eher draußen vor den
Toren der Davidsstadt, in einer Grotte, einem Erdloch, eine Höhle, also in
einem Zufluchtsort, der den Nomaden als „Stall“ zur vorübergehenden
Unterbringung ihrer Herden gedient haben mag? Egal, ob Stall, Höhle oder
Ruine – dieser Ort war sehr provisorisch und ‚luftig‘, ungeschützt der Kälte
und dem Regen preisgegeben. Christus liegt unter freiem Himmel, ausgesetzt,
obdachlos.
ER in der zerfallenden Hütte des Hauses David – in Heimbach: das älteste
Weihnachtsbild der GdG
„An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere
ihre Risse aus, ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder hier wie in
den Tagen der Vorzeit“, so heißt es im Buch des Propheten Amos (9,11). Jesus
- aus dem Geschlecht des Königs David - wird geboren in der zerfallenen Hütte
des Hauses David. Das Prophetenwort und Jesu ‚Stammbaum‘ gaben den
Anstoß, sich die Geburt des Davididen Jesus im ruinierten Palast des David in
Bethlehem vorzustellen. Ich werfe in diesem Jahr den Blick auf das wohl
älteste Weihnachtsbild in unserem Pfarrverband; es befindet sich auf dem in
der Heiligen Nacht wieder aufgeklappten Schnitzaltar in der Salvatorkirche
in Heimbach, auf einem der Flügel des über 500 Jahre alten Retabels. Die
Antwerpener Malergilde hat sich auch für eine ruinöse Arkadenarchitektur
entschieden, zerborstene Gewölbe mit Rundbögen, ornamentierten Säulen
und einem ruinösen Backsteinmauerwerk, den Mauern einer Palastruine.
Maria betet in diesem hinfälligen Ambiente, das die Pracht des Davidpalastes
nur ahnen lässt, den vor ihr abgelegten winzigen Neugeborenen, den „Spross
aus dem Hause Davids“, an; Christus liegt nackt und bloß, umgeben von
Engeln und Hirten, auf einem kalten Steinblock. Josef im Hintergrund trägt
eine Kerze. Visionen der hl. Birgitta von Schweden wirkten inspirierend. Die
alte Welt ist vergangen; Neues bricht an. Gott richtet im Kommen Jesu „die
zerfallene Hütte Davids“ wieder auf. Plakativ versinnbildlicht das Bildmotiv
den nicht unproblematischen Gedanken der Überlegenheit des Christentums.
Der Neue Bund überbietet den Alten Bund. Es geschah die Ablösung des
„alten Volkes Gottes“, des Judentums, durch „das neue Volk Gottes“, die
christliche Kirche. Mit diesem Bildmotiv wird suggeriert: Jesu Kommen in diese
alt gewordene Welt überstrahlt das zusammenstürzende Heidentum und das
‚überholte‘ Judentum. Folgerichtig baute die frühe römische Kirche aus den
Resten (den „Spolien“) der alten Tempel und Basiliken ihre Kirchen, recycelte
die pagane Antike mit dem Gestus der Überlegenheit, aber auch des
Respektes.
Etwa seit der Zeit um 1500 - in Renaissance und Barock- wächst das
ästhetische Interesse und beinahe die Ehrfurcht vor Ruinen und damit das
Bestreben, auch die Geburt Jesu und Jesu Anbetung durch die Hirten und die
drei Könige auf solch einer desolaten Bildbühne darzustellen. Das Bild auf
Heimbachs Antwerpener Schnitzaltar ist dafür ein gutes Beispiel. Die heilige
Familie - umgeben von massivem, burgartig anmutendem Mauerwerk und
fragilem Steingemäuer, von antiken oder romanischen Bauelementen,
Bruchstücken und Überresten. Man stellte Jesu Geburt dar in verfallenen
römischen Tempeln oder inmitten von Palastruinen. Es sind Palastformen und
Ruinenlandschaften, wie man sie in Neapel, Rom oder Palermo kennt. Für die
Maler war es eine Herausforderung, diese Raumszenerie geschickt
darzustellen und die Raumperspektive zu wahren. Oft wird ein fast idyllisch
wirkender Architekturraum gewählt, mit Bögen und Säulen, in südländischer
Landschaft ohne eine Anspielung auf winterliche Kälte. Und wenn noch
exotische Pflanzen aus den Mauerresten wuchern, dann deutet diese zuweilen
paradiesische Vegetation hin auf den Anbruch der Neuen Zeit, das Kommen
des neuen Menschen. Der neue Adam erblickt in einem hinfälligen
‚Machwerk‘ des alten Adam das Licht der Welt.
Bei aller Idealisierung inmitten klassischer Ruinen – die arg lädierte
Ruinenarchitektur als Kreißsaal ist eine Provokation. Der nackte Christus liegt
schutzlos in der Trümmerhaftigkeit dieser Welt an einem dachlosen Ort, wo
sich die heilige Familie zugleich innen wie außen befindet; denn da, wo
Mauern, Dächer und Türen fehlen, wird der Unterschied zwischen Außen und
Innen aufgehoben. Eine solche Geburtsstätte ist nicht weltenthoben. In sehr
irdischer und unwirtlicher Umgebung wird Jesus in eine erschöpfte Welt
hineingeboren. In eine heile und unversehrte Welt hätte er nicht kommen
müssen. Sein Kommen ist „Zeitenwende“. Die alte Welt befindet sich im
Zustand der Auflösung. In ihr kann man sich nicht häuslich einrichten. Nur für
eine gewisse Zeit bietet selbst die Ruine dem Gotteskind einen bewahrenden,
beschützenden Lebensraum. In den Ruinen der fragil gewordenen Welt findet
er seinen Platz. Welches Paradox: Das unvergängliche Heil inmitten dieser
vergänglichen Trümmerwelt. Christus ist nicht Restaurator, sondern Salvator
dieser zerbrechlichen Welt. Der neugeborene Christus feiert Erscheinung „wie
der Phönix aus der Asche“. Das Neue nistet sich ein in den Bruchstellen und
Rissen des Alten und findet darin Unterschlupf. Triumphierendes liegt also in
dieser Darstellung des neuen Menschen, des nackten Gottesbabys, des
königlichen Davididen inmitten einer ruinierten Szenerie. Die Triumphzeichen
des Imperiums, die Tempel und Paläste des Kaisers Augustus zerfielen zu
Ruinen. Doch ER, „Gottes Zelt“ (vgl. Joh 1.14) unter den Menschen, ist da. Der
Sohn Davids in Ruinen – das weckt die Sehnsucht nach dem, der heute wirkt
und Himmel und Erde erneuert. Die so von Hass und Krieg zerrissene Welt
schreit nach Rettung und Erneuerung.
Ruinöse und sterbende Kirchen sind Sein Lebensraum?
Mich bewegt das Ruinenschicksal. Ich frage mich, ob solche aufgegebenen
Gebäude das Schicksal auch der gegenwärtigen Kirche abbilden? Die Steine
schreien! (vgl. Lk 19,40 und 1 Makk 4,46) Trotz aller arkadisch schönen
Ausmalung durch die Natur und mancher Maler gilt: Ruinen sind nur ein
unwirtlicher, nutzloser, zweckloser Unort, ein Transitort für den, der bis heute
unterwegs ist zu uns, der heimatlose Nazarener, der bei dir und mir ein Dach
über dem Kopf sucht - in meinem ruinösen Innenleben, in meiner
fragmentarischen Existenz und auch im löchrigen Gemäuer unserer Kirche;
einer Institution, die ihre eigene Fragwürdigkeit und Hinfälligkeit am eigenen
Kirchenleib erfährt und durchleidet. Nicht nur der Zahn der Zeit nagt an ihr.
Die Macht des Verfalls kann nicht nur Dinge und Gebäude erfassen, sondern
auch die innere Glaubenswelt. Verlassene Kirchen und Klöster wirken wie
versunkene, verwunschene Orte, heute ausgestorben und ehedem belebt. Das
schmerzt. Wie konnte es so weit kommen? Ich denke an die Klosterruine
Heisterbach, von der nur die Chorruine erhalten ist. Nun ist sie vom Himmel
überdacht, ehedem war das Gotteshaus ein vom Chorgesang erfüllter
Hallraum; und nun zernagen Wind und Wetter die Mauern. Was für ein
Spannungsbogen! Kirchen, in denen das Ewige und Unvergängliche gefeiert
wurde, stehen nun als verlassene, einsturzgefährdete und menschenleere
„Bruch-Buden“ in der Landschaft. Die Institution Kirche zeigt massive
Schwachstellen und Risse. Der massenhaft in ihr betriebene Missbrauch wirkt
selbstzerstörerisch. Der Rückgang an praktizierter Kirchlichkeit bedrückt. Die
Gefahr ihrer „Selbstsäkularisierung“ (so der evangelische Bischof Wolfgang
Huber) macht sie überflüssig. Die Austrittszahlen explodieren. Befinden wir
uns in der Kirche Deutschlands und in vielen westlichen Ländern im
Countdown ihrer unaufhaltsamen Alterung, ihres Abbaus und Zerfalls, ihrer
schleichenden Zersetzung, ihres Ruins und ihrer unausweichlichen Auflösung
und Musealisierung? Ist dieser Prozess des Zerfalls und Zusammenbruchs
vieler liebgewordener Strukturen noch zu unterbrechen? Wird die Kirche zur
„Antiquität“, und werden unsere christliche Traditionen, Symbole und Feste
zunehmend unlesbar? Bleibt uns nur die Trauerarbeit und die passive
Hinnahme eines unaufhaltsamen Verfalls kirchlicher Macht und
(Selbst)Herrlichkeit? Wollen wir tatenlos oder mit beschönigender
Selbstberuhigung diesem Zusammenbruch zusehen? Es gibt so viel
schuldhafte und desaströse Verhaltensweisen, die den Kirchenbau zerstören
und den Kirchenleib vergiften. So viel Selbstzerstörerisches geschah: das Holz
des Kirchen-Dachstuhls fault, die Balken des Kirchenbaus biegen sich,
bestimmte Konstruktionselemente tragen nicht mehr, der Frost des Zeitalters
hinterlässt Spuren in dem Gebäude und zersetzt Fundamente und Mauerwerk.
Das ehedem so selbstsicher und selbstherrlich dastehende Haus der Kirche,von dem es einmal hieß, es sei das Haus voll Glorie, das weit in alle Land
schaut (Gotteslob 478), wirkt auf manche Zeitgenossen wie ein Trümmerfeld,
ein stummes Grab, eine dunkle Gruft. Mir stellt sich eine mich bedrängende
Frage: Ist es Gott selbst, der es zulässt, dass sich Bauten, die unsere Vorfahren
zu seiner Ehre errichtet hatten, leeren? Warum? Erinnern wir uns: Nicht die
Kirche, sondern Gott ist die unzerstörbare und uneinnehmbare „Felsenburg“
(2 Sam 22,2; Ps 31,3f). Bedarf er der Kirche noch? Braucht der moderne
Mensch noch eine vermittelnde Institution zwischen Himmel und Erde?
Verkörpert die Kirche noch ein sinnstiftendes Ganzes? Oder wird sie von der
Gesellschaft ausrangiert? Weckt sie irgendwann bloß noch nostalgische
Erinnerungen und ein antiquarisches Interesse, ein Gefühl der Melancholie?
Bleiben unsere Kirchen also irgendwann wie zwecklose, versteinerte und
sinnentleerte Erinnerungsorte zurück? Was passiert mit Gotteshäusern, die
irgendwann verlassen und nicht mehr unterhalten werden? Einmal waren sie
heilige Orte wie die antiken Tempel. Bleiben sie als Überbleibsel einer
verflossenen Glaubensepoche zurück, die quasi dem natürlichen Zerfall und
den Kräften der Witterung und des Regens preisgegeben werden? Viele
Zeitgenossen fragen: Ist die Kirche Ruine, eine Erscheinung von ‚gestern‘, oder
eine Baustelle, auf der Gott arbeitet und Neues schafft? Von der idealisierten
Gegenwelt einer vollkommenden Gesellschaft Jesu (einer „societas perfecta“)
träumte man im 19. Jahrhundert bis weit hinein in die 50er Jahre des 20.
Jahrhunderts. Wollen wir das nun sein: Baustelle Gottes? Im Umbruch kann
Neues wachsen – wie die Pflanzen aus Ruinen. Ich danke für so viele
„Pflanzen“ des ehrenamtlichen Engagements in unseren Gemeinden! Die
Kirche wird lernen müssen, ihre eigene Zerbrechlichkeit und Hinfälligkeit zu
durchleiden, um so ehrlich als gottesbedürftiger Ort den Menschen Halt und
Zuflucht zu geben.
Er – heruntergekommen in meine heruntergekommene Welt
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eintrittst unter mein (zerfallenes, ruinöses)
Dach...“ Ich bin ein brüchiges Gebäude und zugleich Tempel des Heiligen
Geistes. Wenn das Weihnachtswunder geschieht und er heute in mich
hinabsteigt und in mir seine zweite Heimat sucht, dann ist das eine
Abenteuerreise; denn er könnte stolpern und stürzen, sich wehtun an meinem
scharfkantigen Leben. Stehen wir dazu, ruinöse Existenzen, angeschlagene
Gefäße (2 Kor 4,7) zu sein. Nur dann kann Er durch die Risse meiner Existenz
einen Durchlass finden und heute in mir neu geboren werden. Ich bin nicht
Ruine, sondern Fragment, an dem Er ununterbrochen arbeitet - er, der mich
vollendet oder mich als Fragment, als Bruchstück liebhat. Der seltsame
Kreißsaal der Ruine passt eher zum nackten Christuskind, dem Gekreuzigten,
dem gebrochenen Brot der Eucharistie als ein stolzer Tempel, der sich
hermetisch abschottet vor den Zumutungen Gottes. In die Lücken, Risse und
Leerstellen passt Er hinein. Nein, die Kirche ist ein noch unfertiges Haus, also
eine Baustelle, in der Christus das Fundament legt (2 Kor 3,8ff). Hoffentlich
wird sie keine Ruine, die keine Zukunft hat. Nicht allein der Zahn der Zeit,
sondern die Hand Gottes arbeitet an uns. Die ruinöse und gebrechliche und
auf Vergebung und Heilung angewiesene Kirche und der Tempel meines
Leibes wollen der Ort göttlicher Anwesenheit sein. Ohne Gott wäre diese
Kirche ein unvollkommenes und überflüssiges Phänomen. IHM wollen wir
einen Krippenplatz freihalten in dieser Welt, in uns und zwischen uns.
Ihnen und Euch wünsche ich im Namen des Pastoralteams ein gesegnetes
Weihnachtsfest.
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf das Bild zum Osterbrief hier nicht veröffentlicht werden. Sie finden es aber auf dem Pfarrbriefmantel in unserer Kirche
Ostern 2022 - Das große Wunder, buchstäblich verborgen im Buchstaben E
Gedanken zu einer mittelalterlichen Miniatur und zum Auferstehungsgeheimnis
von Kurt Josef Wecker, Pfarrer Nideggen/ Heimbach
Ob’s denn wahr ist, das große Versprechen von Ostern? Oder nehmen wir den Mund zu voll und verbreiten ein gänzlich unwahrscheinliches Gerücht? Die Skepsis gegenüber dem Auferstehungsglauben nagt an der Christenheit, an dir und mir. Doch nichts braucht diese Welt mehr als die Aussicht auf diesen rettenden Ausweg, auf Auferstehung. Was würde uns fehlen, wenn es dieses Fest nicht gäbe – und die Perspektiven, die es schenkt? Unsere Zukunft hängt an der Wahrheit dieses Festes, am winzigen Nadelöhr dieses Tages, den der Herr gemacht hat. Mein Leben steht auf dem Spiel. Alles oder nichts! Ist da einer, der mich auf ewig ansieht – oder nicht? Wir klammern uns an das Rettungsseil, das Gott uns zuwerfen wird, an diesen „Ersten der Entschlafenen“ (1 Kor 15,20).
Oft wird in diesen Wochen eine ‚Zeitenwende‘ beschworen, das Heraufziehen einer Epoche, in der kein Stein der alten Ordnung auf dem anderen bleibt - weil sich in einem Krieg in Europa zu wiederholen scheint, was überwunden schien. Sind die Mächtigen unbelehrbar angesichts der Gräuel des vorigen Jahrhunderts? Manche sagen im Blick auf die bedrückende Weltlage: Komm mir nicht mit Ostern! Komm mir nicht mit all den vollmundigen Worten von Lebensfülle, Überfluss, Leichtigkeit … Uns erfüllen in diesem Jahr wie schon in den beiden Corona-Ostern zuvor eher dunkle Ostergefühle. Das Leben geriet aus der Balance, die Auferstehungssehnsucht ist vertrocknet. Nicht allein die Kirche stagniert am Nullpunkt. Die Welt in ihrer Ausweglosigkeit tut weh, schreckstarre Blicke richten sich auf das zuvor Unausdenkbare des blutigen Angriffskriegs in Europa. Wir müssen ohnmächtig der nackten Gewalt in der Ukraine, in Syrien, in Mali, im Jemen aus der Ferne zusehen. Unerträglich brutale Bilder verstören, und wir kommen schwer ins Grübeln, was uns der Osterglaube in diesem Dunkel noch sagen kann. Muss ich mir eingestehen, wie ‚auferstehungsvergessen‘ ich lebe? Wir treten auf die ‚Lichtung im Kirchenjahr‘. Ostern dürfen wir große Worte machen und beinahe trotzig triumphale Lieder singen. Suchend und fragend bewegen wir uns am heißen Kern des Glaubens und geben betend die Verlustanzeige auf: Du fehlst uns, Herr! Was würde aus uns und dieser zum Frieden unfähigen Welt, wenn Du nicht lebst und Leben schenkst und wenn niemand mehr an dich, den Allerlebendigsten, glauben würde?
Vor Augen stehen uns Gegenbilder apokalyptischer Verwüstung. Sie sind nicht zum Mit-Ansehen, und doch müssen wir sie ertragen. Mehr denn je braucht die verwüstete Welt Gegenbilder der Hoffnung. Wir brauchen den Herrn, der bleibt, wenn alle irdischen Herren, Despoten und Oligarchen gehen und vergehen. Und die blass gewordene Kirche braucht uralte Hoffnungsbilder, die heilsam von uns und dem ganzen Kirchenkram ablenken. Das diesjährige Osterbild erzählt buchstäblich vom winzigen Jesus. Er ist als Schmuckelement verborgen in einer Initiale, in der oberen Hälfte des Buchstabens E. Das Fest, das unser Fassungsvermögen sprengt, verdichtet sich in einer Miniatur etwa aus dem Jahre 1140, geschaffen von Salzburger Meistern/ Illuminatoren für die Benediktinerinnenabtei St Erentrud auf dem Nonnberg zu Salzburg, bestimmt für ein Perikopenbuch, für den festlichen ersten Buchstaben E aus dem Bibelwort „Expurate vetus fermentum“ - „Fegt aus den alten Sauerteig“ (1 Kor 5,7f), das Pauluswort, das im 10. -12. Jahrhundert in der Ostermesse verlesen wurde. Christus verbirgt sich und ist buchstabenklein im Bilde.
Der im Perikopenbuch bezeugte Christus tritt uns Betrachterinnen und Betrachtern frontal gegenüber. Wir dürfen Ihm begegnen, uns wie die frommen Salzburger Ordensfrauen des Hochmittelalters in Ihn versenken, zu Ihm, dem österlichen Sieger, aufschauen. Das Antlitz Jesu erinnert an das traditionelle Christusporträt dieser Zeit: das Mandylion von Edessa. Spüren wir den Osterwind, der in die rote Kreuzfahne fährt? Jesu Rechte hält nicht das Kreuz, sondern den Kreuzstab mit dem Kreuz als Siegeszeichen. Das Grab ist (noch nicht) leer, aber der Held ist erwacht! ER noch drinnen im Sarkophag. Er allein im offenen Grabkasten, er im Ostergarten, woran die floralen Motive, die grünen Blätter im Gold erinnern. Solus Christus! Allein ER! Er ohne Begleitfiguren: Ohne Engel und Jünglinge in weißen Gewändern, ohne Salbfrauen, ohne Maria Magdalena, ohne Apostel, ohne Grabwächter. Für Ostern braucht es keine menschlichen Regisseure, Gestalter, Täter. Es ist der Tag, den Gott gemacht hat! Ein Fest als reine Gabe Gottes. Er steht so ganz ruhig da, als Halbfigur, im Zentrum, ohne große Aktionen und heftige Bewegungen. Er - ohne Spuren der Gewalt, so unversehrt, dass man ihm die Brutalität der Kreuzigung nicht ansieht. Hat Er so schnell die Kreuzigung hinter sich gelassen? Er - vornehm, aber nicht spektakulär gekleidet, so dass man den nackten Jesus am Kreuz vergessen könnte. Kann das der Hingerichtete sein, der am Karfreitag seinen brutalen Aggressoren ausgesetzt war? Heilen Wunden so rasch? Hat Er sich ‚so gut gehalten‘? Allein der Kreuznimbus erinnert an den Schmerzensmann.
Wenn in der Salzburger Osterliturgie die Worte aus dem Paulusbrief verlesen wurden, blieb das Auge der Vortragenden für einen Augenblick auf dieser Miniatur hängen. Sie sahen - Ihn allein in diesem Kasten, der an den irdischen Nullpunkt, das Grab erinnert. Die Schönheit und Souveränität des Auferweckten anzuschauen, das war dem romanischen Hochmittelalter wichtig. Der Anblick des Auferweckten löst kein Erschrecken aus, eher einen gewissen scheuen Respekt vor dieser fremden, fernnahen Gestalt, die uns Betrachtende nicht anblickt. Jesus zeigt uns nicht seinen tödlich verletzten Körper und die Verwüstungen des Karfreitags. Er zeigt sich uns auch nicht im Modus des Verschwindens. Er erscheint im Goldkranz, im Jenseits aller Todeswelt. Ihn muss keine irdische Hand mehr salben. Ihn kann niemand aus dem Grab heraushelfen. Und die Frage, wer ihm wohl den Stein weg wälzt, stellt sich hier nicht. Nein, wir Menschen sind keine „Steinewegwälzer“, zumindest nicht von Gräbern. Wir können den Toten nicht aus den Gräbern helfen. Kein starker Mann, keine mutige Frau, keine eifrige fromme Kirche kann so etwas. Nein, wir sind nicht die Macher von Ostern. Wir feiern den dritten Tag, den Gott allein gemacht hat. Wir betrachten Christi Erscheinung, Ihn, der sich plötzlich und unerwartet, ungefragt und unverhofft den Frauen, den Jüngern und uns Betrachtern dieses Bildes zu sehen gibt.
Einfach so ist Er da und bietet sich wehrlos unseren Blicken an. Inmitten dieses gegenwärtigen Kirchenbetriebs ist Er ein Fremdling. Er gerät nicht in hektische Betriebsamkeit, wird nicht zum Moralapostel oder zum rastlosen Wundertäter. Von dieser Darstellung geht Stille aus. Reine Gegenwart des Auferstandenen. Es ist eher ein kleines Andachtsbild voller Lyrik, das die Dramatik der Großtat Gottes am Ostermorgen kaum ahnen lässt. Wollen wir ihn so leibhaft sehen? Ihn, der nicht zu fassen ist? Ihn, den nicht meine fromme Erinnerung, sondern allein Gott von den Toten auferweckt hat (1 Kor 6,14; Röm 6,4)? Ihn, der sagt: „Ich war tot, und da! Ich bin lebend im All der Weltzeiten“ (Offb 1,18)? Will ich mich mit den Blicken des Glaubens an Ihn herantasten? Möchte ich von Ihm gesehen werden? Jesus hält etwas mit seiner Linken hoch, lässt uns einen Gegenstand aus der Dingwelt der Passion wahrnehmen. Diese Geste, mit der er ein Textil präsentiert, ist merkwürdig. Er berührt das Schweißtuch oder die Leinentücher, den Zipfel des Leichentuchs (Joh 20,6f; Lk 24,12). Dieses ‚alte‘ Textil wird er zurücklassen im Grab, so wie Er zu Ostern den ‚alte Sauerteig‘ ausfegen will aus meinem Innenleben. Dieser ‚neue Adam‘ kleidet uns neu ein, umhüllt uns mit dem Gewand des Auferstehungslebens. Das Grab, dieser „Un-Ort“ des Todes, ist erfüllt mit Leben, mit dem Lebendigen. Er zeigt sich uns einfach so und bittet leise um unsere Aufmerksamkeit.
Die Salzburger Künstler geben uns kühn etwas zu sehen, was uns die Evangelisten vorenthalten. Den Augenblick ‚nach‘ der Auferstehung, also das Unsagbare, diese unvorstellbare ‚Lichtsekunde‘. Eigentlich bekommen wir ja zu hören: Was sucht ihr Ihn hier im Grab? Macht euch davon! Er ist nicht hier! Die Kunst jedoch schenkt uns eine Vision. Einen Augenblick lang dürfen wir ihm gegenüberstehen, darf ich mich im Blick auf ihn geradezu selbst vergessen. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man malen. Niemand von uns kann voraussehen, wann und wie es zu einer solchen Begegnung mit Ihm kommt. Keine noch so große Frömmigkeit kann sie herbeiführen, keine kirchliche Anstrengung kann sie herbeizwingen; doch sie steht uns allen bevor!
Unsere Kirche in der Krise redet ja über alles Mögliche. Sie moralisiert, appelliert zu mehr Anstrengung und Aktivitäten, ist immens diesseitsorientiert und schmiedet fleißig Diesseitspläne, entwirft Strukturprogramme, will ihre ‚Handlungsfähigkeit‘ steigern. Sie plant atemlos, angestrengt, schweißtriefend und mit dem Mut der Verzweiflung Selbsterhaltungs- und Überlebensstrategien und müsste sich ehrlich eingestehen, dass sie immer mehr an ‚Relevanz‘ verliert. Die Kirche darf sich angesichts der Wucht des Ostermorgens eingestehen, immer hinter ihren Möglichkeiten zurückzubleiben. Sie gerät nicht erst am Grab Jesu an die Grenze des Beantwortbaren und ringt vor den wirklich existentiellen Herausforderungen nach Worten. Wenn sie Ihn nicht bezeugt, dann ließe sie viele Zeitgenossen trostlos und ratlos zurück. Gott sei Dank gehört die Botschaft von Ostern nicht zu den Themen, die die Kirche erfinden muss oder die sie dem Mainstream nachplappern kann. An diesem heutigen Tag kann die Kirche nicht das nachbeten, was die Welt ohnehin schon sagt oder ebenso gut oder sogar besser weiß. Die österliche Neuigkeit überschreitet das Menschenmögliche, auch das, was der Kirche bei aller ‚frommen Geschäftigkeit‘ möglich ist. Zu Ostern ist die Kirche Gott sei Dank nicht Herrin des Verfahrens. Sie ist passiv und ratlos; und diese Ratlosigkeit und Ehr-Furcht vor dem Unfassbaren steht ihr gut zu Gesicht. Wir können Ostern nicht auf die Tagesordnung unserer Agenda setzen; diese festliche Gabe wird uns quasi wie ein Ei ins Osternest gelegt. Ostern erinnert mich daran, dass wir von Gottes Macht sprechen dürfen; und diese Macht ist gut und todüberwindend. Eine aktivistisch rotierende und sich permanent reformierende Kirche? Schön und gut! Unverzichtbar ist eine auf Ihn schauende, Ihn suchende, Ihn hörende, Ihn aus dem Stimmengewirr der Zeit heraus-hörende Kirche. Eine Kirche, die sich sein Gegenüber gefallen lässt und sich von Ihm anschauen lässt. Eine Kirche, die es nur gibt, weil Er ihr erscheint und auf Augen hofft, die ihn suchen. Die österliche Erscheinung Jesu ist anstößig für eine Institution, die viel Vertrauen verloren hat und der es immer noch um Selbstdarstellung geht. Es wäre traurig, wenn sie Christus in das „geistliche Wort“ vor Sitzungsbeginn verbannt, Ihn zwischen ihren Tagesordnungspunkten beinahe zum Verschwinden bringt und Seinen Aktionsradius eingeengt wie in einen winzigen Buchstaben. Zukunft und rettende Auswege für uns gibt es nur, weil es den Auferstandenen gibt und die ansteckende Energie, die von Ihm ausgeht, wenn Er verborgen zwischen den Zeilen meines Lebensbuches anwesend ist. Gott sei Dank geht er nicht nur in kitschigen Geschichten vom „herzensguten Menschen aus Nazareth“ auf, ist er unendlich mehr als ein irgendwie exemplarischer Mensch von gestern. Seit Ostern hat die Kirche der Welt wahrhaft Neues zu sagen. Sie bezeugt die Realpräsenz des Auferstandenen hier und heute! Sie traut Ihm zu, zum Handelnden, zum Salvator des kranken Kirchenleibes zu werden. Ohne seine österliche Anwesenheit wäre alles nichts. Starren wir also nicht auf unsere Defizite und Mangelerscheinungen. Wir dürfen auf Ihn blicken, Ihn einfach Herrn und Lebensspender „sein lassen“.
Die große und unvergleichliche Auferstehung hat kleine Schwestern und Brüder. Auferstehung kann in unscheinbaren Spuren - wie auf dieser Miniatur – „buchstabenklein“ ahnbar werden in unserem Leben. Wenn sie uns widerfahren, dann sind sie die kleinen Funken des großen Osterfeuers.
Ihnen und Euch in dieser schweren Weltzeit und der unübersichtlichen Krisenzeit der Kirche wünsche ich seinen leisen Friedensgruß: „Meinen Frieden gebe ich euch!“ Ostern tue uns gut!
Ihr/Euer
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Wenn der Himmel in unsre Nacht fällt …
Bildbetrachtung von Kurt Josef Wecker, Pfr., Nideggen/ Heimbach
Mehr Licht!
So soll Goethe kurz vor seinem Tod ausgerufen haben! „Mehr Licht“ am Ende des Tunnels - das fehlt uns allen. „Epiphanie“ heißt das weihnachtliche Ereignis, das dem Geschehen der Geburt Jesu einen besonderen, lichtvollen Akzent gibt. Gott ist ‚am Aufglänzen‘. Weihnachten ist nichts Virtuelles. Das Kommen Gottes ist eine ‚Präsenzveranstaltung‘. Gott tritt in Erscheinung, er kommt ‚im Fleisch‘ zum Vorschein und geht nicht auf „soziale Distanz“. Und doch bleibt es eine sehr verborgene Epiphanie. Dieses Ereignis denkbar größter göttlicher Annäherung kann keine Kirche inszenieren, veranstalten oder verhindern, denn die Feste der Kirche sind gottlob kein Privatbesitz der Kirchen oder der ‚Frommen‘; denn es kommt – der Heiden Heiland! So etwas Schönes und, ja: Schrilles kann sich nur Gott ausdenken! Der zu uns herunter gekommene Gott ist kein Katholikengott, kein Kirchengott, kein Sippengott; er kommt für alle Welt zur Welt, gerade auch für unerwartete und fernstehende Gäste, für „Seltengeher“ ohne ‚Bonitätsprüfung‘, für stolpernde Gottsucherinnen und -sucher. Für sie gilt: Ihr seid willkommen! Dabeisein ist alles! Ihr dürft in der ersten Reihe sitzen! Weihnachten ist die Zeitenwende, der Tag der offenen Tür - auch wenn die Pandemie erneut die Schwellen zu unseren Kirchen hoch und die Türen in die Gottesdienste eher eng macht; auch wenn - gefühlt - Corona unsere Zeit in eine Epoche vor und seit/nach Covid -19 trennt. Das Wunder göttlicher Herablassung zeigt sich nicht nur jüdischen Hirten im Nahbereich, sondern weitgereisten heidnischen Männern, die plötzlich und unerwartet vor Ihn - wie vor eine gewaltige Energiequelle - geraten. Am Ende einer langen Reise durch die Finsternis dieser Welt, einem über Bethlehem verglühten Stern hinterher, feiert in diesen Besuchern meine schillernd-heidnische Welt Ankunft beim Kind. Für diese Weitgereisten war nicht entscheidend, ‚sich zu finden‘ und ‚zu sich zu kommen‘. Nein, sie werden über sich hinaus hinauswachsen, auf Neues stoßen, außer sich geraten. Diese Männer im grellen Gegenlicht werden am Ende eines Suchspiels zu glücklichen Findern eines Schatzes, den sie so gar nicht gesucht haben. Und das muss uns alle Jahre neu erzählt werden, uns, die wir mit abgespeckter Hoffnung fragen: „Kommt noch etwas in meinem Leben?“ Weihnachten sagt mir: Hier und heute und nicht erst am Ziel meiner Lebensreise wartet Schöneres auf mich; mir kommt ein Licht entgegen, das ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ersehnt habe. Das Beste kommt erst noch …!
Annäherung an ein ‚Haus aus Licht‘
Die Schweizer, die Züricher Künstlerin Maya Armbruster-Wartmann (1913-1999), die auch viele abstrakte Werke schuf, hat sich in der zweiten Hälfte ihres Künstlerinnenlebens auch religiösen Motiven zugewandt. In manchen Deutschschweizer Kirchen finden sich Spuren ihres Schaffens. Ihr Bild „Die Könige an der Krippe“ deutet die Annäherung an „ein Haus aus Licht“ (E.M. Kaschnitz) nur an. Die Künstlerin schafft ein strenges Bild. Wir vermissen Vertrautes. Der armselige Stall, die Krippe mit Ochs und Esel, die Engel und die Heilige Familie, der Anblick der Armseligkeit des Gottesbabys – all das fehlt. Die Heilige Nacht der Magier wird verfremdet ins Bild gebracht. Weihnachten muss alle Jahre neu als eine andere Geschichte einleuchten, darf nie allzu vertraut und heimelig werden, sollte gegen den Strich gelesen werden. Die namenlosen Gäste, die wir auf unserem Bild nur als Rückenfiguren wahrnehmen, werden angelockt von einem überirdischen Glanz. Diese Sucher sind mehr als Besucher; sie werden zu Pilgern verwandelt. Kein Königsportal, sondern eine Öffnung in einer Mauer wird für sie zum Tor ins Paradies. Nazareth-Pilger kennen ähnliche höhlenartige Häuser; sie sind noch erkennbar in der Verkündigungskirche von Nazareth, als das Arme-Leute Haus der Maria. Ein grob gemauerter Raum wird zum Gnadenort, zur Gnadenkapelle. Oh ja! Gottes Wort blitzt auf an einem seltsamen Ort. Die Ankömmlinge draußen vor dieser Tür wirken, als scharen sie sich zu später Stunde um ein überirdisches Licht in irgendeiner glanzlosen Hütte Bethlehems. „Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt“ (Jes 60,1-2), so bringt uns der Prophet im Advent auf den Geschmack der Weihnacht. Grelles, doch nicht künstliches Gegenlicht blendet und strahlt die Drei, die wenig heimelige Umgebung und uns Betrachter an. Es bricht aus der Öffnung. Gott ist Licht. Gott verbirgt sich, ist unfassbar ‚heißer‘ als der Sonnenball. Gott ist Feuer, so erfuhr es Blaise Pascal in seiner Berufungsstunde. Das Licht ist Ausdruck des Gott-nicht-sehen-Könnens. Die Lichtsymbolik ist nicht zufällig von der Künstlerin gewählt: Weihnachten ersetzte im vierten Jahrhundert in Rom nach dem Tag der Wintersonnenwende das Sonnengottfest, den Tag des ‚Sol invictus‘, der unbesiegbaren Sonne. Alle Jahre wieder erleidet die Sonne im Winter der Nordhalbkugel eine Niederlage, erhebt sich trotzdem mühsam und langsam und gewinnt erneut am Himmel an Boden. Weihnachten in diesem Weltdunkel ersetzt diesen Lichtkult, ist ein öffentliches, ein „kündlich großes Geheimnis“ (1Tim 3,16). Die Öffnung zum Mysterium tut sich zwar weit auf - aber können wir uns in einen solchen Glanz hineinwagen? Wo geraten wir da hin? Wir sehen nicht die Blicke, das Mienenspiel der Ankömmlinge; wir können nur ahnen, was und wen diese Ankommenden blinzelnd wahrnehmen. Immerhin, wir erkennen die schwarze Gesichtsfarbe des stehenden Königs. Es sind Männer mit prachtvollen, wallenden roten und blauen Gewändern, gekrönte Häupter. Auf ihren uns abgewandten Gesichtern spiegelt sich der Abglanz dessen wider, der – wie es in den fremden Worten des Credos heißt - ‚Licht vom Licht‘ ist. Goldgelbes Licht, das an die göttliche Natur des Neugeborenen erinnert. Uns muss die Weih-Nacht geschenkt werden, damit uns das unverbrauchbare Licht aus der Fülle Gottes aufgeht - eine „Herrlichkeit“, die den drei Mächtigen dieser Welt einleuchtet. Das Licht, das wir hier sehen, kann man allein glauben. Manche Menschen, die an der Grenze zum Tod standen, berichten von ihren Nahtoderfahrungen: sie erzählen, dass sie in dieser Grenzerfahrung einem unfassbaren Licht entgegengehen, das auf sie wartet und sie anzieht und sie in Empfang nehmen möchte.
Schwellenfiguren
Nein, nicht die Könige sind blendende Gestalten und strahlende Erscheinungen; sie werden im fremden Licht des Göttlichen zu lichtvollen Menschen verwandelt. Danach werden sie wieder in die Dunkelheit eintauchen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden; in ihrer Erinnerung werden sie bleiben, auch wenn sie gehen. Weihnachten – das ist das Verlangen nach Nähe; doch diese Drei werden nicht näher herantreten; sie bleiben draußen, wagen nur sanfte Annäherungsversuche. Sie üben sich in sozialer, nein: ehrfürchtiger Distanz. Sie bleiben an der Schwelle zum Heiligtum, sind also Schwellenfiguren. So wie Moses vor dem brennenden, nicht verbrennenden Dornbusch scheu die Theophanie Jahwes erlebt, so werden diese Drei von dem überwältigenden Geschehen überrascht und wählen die Gebärde der Anbetung. Sie kommen nicht mit leeren Händen, sie haben goldene, exotische, duftende Gaben in den Händen, die sie nun nicht mehr festhalten müssen. Der matthäischen Erzählung nach sind sie Wissende, königliche Sterngucker, die gewohnt sind, nach oben zu schauen; doch hier und heute blicken sie auf den herab, der unseren Augen verborgen bleibt, auf den auf unsere Erde gefallenen Stern, auf das in unsere Untiefen gekommene „Kindlin“ (so übersetzt Martin Luther Mt 2,11). Diese neugierige Rückenfiguren verwehren mir den Blick ins Innere. Sie wagen sich nicht tiefer hinein, versperren mir noch die schöne Aussicht auf das Geheimnis. Sie beäugen ein Kind und begreifen in einem Augenblick: Wir sind am Ziel und einfach nur da - „in ungläubigem Staunen“ (Navid Kermani). So angestrahlt sind sie, dass man ihnen eigentlich eine Schutzbrille reichen möchte, damit der gleißende Lichtglanz sie nicht blendet. Wir wissen nicht, was sie sehen. „Aufklärung‘ wird uns von der Künstlerin nicht geboten. Gott verbirgt sich im Licht. Um mehr zu erfahren, müssen wir bei Matthäus nachschlagen und lesen, was sie sehen. Das verschwenderisch ausgegossene Licht, das von einem Kleinen ausgeht. „Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein helles Licht gesehen“ (Jes 9,1). Eigentlich war Jesus nur ein kleines Licht, das in das Dunkel dieser Welt gehalten wird, nur eine senfkornkleine Pünktchen-Existenz. Und doch ist er der Dreh- und Angelpunkt der Welt. Die heiligen Vorläufer laden uns ein, dahinter zu bleiben, geduldig zu warten, bis sie mir den Weg frei machen und mich in der ersten Reihe stehen oder knien lassen. Wie in einer Warteschlange stehen wir an, um danach vor den fernnahen Gott zu geraten und durch den Liebesblick dieses Einen ‚geimpft‘ zu werden.
Lieben ist Warten
„Lieben ist Warten“, sagt Simone Weil, kein Zupacken, kein Sich-Vordrängeln und Besitzen-Wollen. Noch haben wir Zeit, um uns hinter dem Rücken dieser Drei Gedanken zu machen, was wir erwarten, wenn wir nur mit unseren Augen diese Öffnung durchschreiten. Auch wenn wir sprachlos und mit leeren Händen präsent wären - wir sind willkommen! Vielleicht geht uns auf, dass die ‚Sonne der Gerechtigkeit‘ (Mal 3,20) buchstäblich ‚unter uns‘ aufgetaucht ist, das Licht der Welt, das heute das Licht der Welt erblickt. „Und Christus?“. Kafka neigte den Kopf. „Das ist ein lichterfüllter Abgrund. Man muss die Augen schließen, um nicht abzustürzen“, so der Jude Franz Kafka im Gespräch mit Gustav Janouch. Allein in den Augen des Glaubens und in der Fantasie vieler Maler-innen geht von diesem Neugeborenen der Glanz des Himmels aus. Der Evangelist Matthäus spricht nicht von einer Erdhöhle und einem Krippentrog; er erwähnt beiläufig ein ‚normales‘ Haus in Bethlehem (Mt 2,11); und die drei Könige sahen nichts Weltbewegendes: nur das Kind bei Maria, seiner Mutter. Mehr nicht! Dieses Wenige musste ihnen und muss uns reichen. „Selig, die nicht sehen und doch glauben“, dass uns im Unscheinbaren Gott entgegenleuchtet. Das moderne Bild zieht den Vorhang weg von dem gewöhnlich anmutenden Kleinkind, deutet eine kaum wahrnehmbare Gottesspur an.
Weihnachten – die „allerneuende Klarheit“ Gottes kommt
Lichtbedarf haben wir alle, weil die scheinbar nicht enden wollende Corona-Situation und der Zustand des Planeten Erde viele hoffnungslos macht. Wir sehnen uns nach Orientierung. Wir wollen es wieder hören, dieses Wort vom ersten Schöpfungstag (Gen 1,2f): „Es werde Licht!“ Viele Kirchenlieder (z.B. GL 220,5; GL 84; GL 252,4) artikulieren unseren Lichtbedarf. Wir ‚brauchen‘ Weihnachten. Wer 2021 Weihnachten feiert, tritt mit ‚gemischten Gefühlen‘, scheu und sprachlos, in die Nähe dieses unausschöpflichen Glanzes. „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.“ (1 Joh 1,5). In diesem Licht sehen wir auch unser eigenes zerbrechliches und versehrtes Leben. Vielleicht bleiben auch wir „Schwellengestalten“ und wagen nicht den letzten Schritt hinein ins Geheimnis. Was würde mich hindern, näher zu treten und mich Ihm zu stellen? „Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere größte Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht“, sagte Nelson Mandela. Darum sind wir angewiesen auf das fremde Licht, das sich auf uns legt (2 Kor 4, 6) und die Angst nimmt. Weil so vieles in dieser Welt und auch in der Kirche seinen Glanz verliert, brauchen wir das andere Licht der Weihnacht. Das Kind bittet leise: Glaubt an mich, dieses Rest-Licht, das seit 2000 Jahren in der Welt ist und das wir in dieser uns ratlos machenden Zeit womöglich nur mit den ‚Nachtsichtgeräten‘ des Glaubens wahrnehmen. Das Kind bettelt um das Weihnachtsgeschenk meiner liebenden Aufmerksamkeit: Glaubt an mein leises Erscheinen unter euch - trotz allem Dunkel, das wir einander bereiten, das uns zugemutet wird und uns in den Gewalten der Natur und des Mikrokosmos zu schaffen macht. Dieses Licht muss reichen für die vor uns liegende Zeit. Das Christusereignis in stiller heiliger Nacht ist kein vorübergehender Lichtblitz. Nein, es ist nicht alles Gott, was in dieser Welt glänzt; und Jesus ist keiner dieser Götter und Halbgötter, die nur auf der Durchreise sind. ER ist ein Besucher, der bleibt. Friedrich Hölderlin dichtete 1802 in seiner ’Friedensfeier‘: „Denn manches mag ein Weiser oder/Der Treuanblickenden Freunde einer erhellen, wenn aber/ Ein Gott erscheint, / auf Himmel und Erd und Meer/ kömmt allerneuende Klarheit.“
Das wünsche ich Euch und Ihnen zur Weihnacht: Eine Lichtspur von der „allerneuenden Klarheit“ Gottes möge sich auf unseren Gesichtern und in unseren „aufgescheuchten Seelen“ widerspiegeln.
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Wollt auch ihr weggehen?“ (Joh 6,67)
Gedanken zu einer bitteren Erfahrung und Gottes größeren Möglichkeiten
Liebe Mitchristen,
wollt nicht auch Ihr weggehen? Und wenn nicht, warum bleibt ihr? Mit dieser Frage überfällt Jesus die Jünger und uns. Denn der große Rückzug und Auszug aus der Synagoge von Kapharnaum hat begonnen. Leute gehen kopfschüttelnd von ihm weg, die er eben noch mit Brot sattgemacht und dann mit seiner langen Brotpredigt irritiert und vielleicht gelangweilt hat. Wer kann sich den anhören, der ein solches Gleichheitszeichen setzt: Ich = Brot des Lebens?! War Jesus traurig, als so viele die Abstimmung mit den Füßen machten und sich von ihm (nicht etwa von der Kirche!) entfernten (Joh 6,66)? Jesus und nicht sein ‚Bodenpersonal‘ war das große Ärgernis! Hätte er all die, die auf Abstand gingen von Ihm, nicht mit Engelszungen wiedergewinnen müssen und die ‚Preise‘ - wie früher im ‚Sommerschlussverkauf‘ - senken sollen? Hätte er sie nicht mit leichterer Kost befriedigen müssen?
Im August wurden die letzten Erstkommunionfeiern 2021 (und teilweise noch 2020) ‚nachgeholt‘. - Wird es für die Kinder, die oft hochmotiviert und begeistert Erstkommunion begangen haben, das Fest der Zweitkommunion geben? Werden sie die Lust am Glauben und den Geschmack an der eucharistischen Spei-se behalten und Woche für Woche das Verlangen haben, „zu seinem Gedächtnis“ zusammenzukommen? Werden sie jemals ‚Goldkommunion‘ feiern? Solche bangen Fragen machen Seelsorgerinnen und Seelsorger zu schaffen. Auch die Katechetinnen, viele Eltern und Großeltern von Kommunionkindern oder Gefirmten fragen sich traurig oder hilflos: Was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir noch mehr anbieten müssen?
Wie werden die, die sich zukünftig nur als „Seltengänger“ (wie der Dichter Robert Gernhardt sie im Unterschied zu den „Ständiggeher“ nannte) verstehen, glauben? Woran werden sie in Zeiten zukünftiger Krisen, Katastrophen und der Erfahrung persönlichen Scheiterns Halt finden? Was, wenn uns Selbstzweifel und Selbstvorwürfe überkommen? Dann ist es wichtig, sich an die Worte des vom Judentum zum Katholizismus konvertierten früheren Erzbischofs von Paris, Kardinal Jean Marie Lustiger, zu erinnern.
Wenn euer Kind die religiöse Praxis aufgibt, heißt das nicht, dass er Gott verloren hätte, und schon gar nicht, dass Gott euer Kind verloren hätte. Im Grunde wisst ihr nicht, was im Inneren eures Kindes vor sich geht. Vor allem dürft ihr euch nicht schuldig fühlen. Der Glaube hat seine ‚Jahreszeiten‘ und folgt geheimnisvollen Wegen. Doch wenn ihr den guten Samen des Evangeliums gesät habt, dann dürft ihr darauf vertrauen, auch wenn gerade Winter ist und alles wie tot erscheint, dass der Same aufkeimt: Es wird auch wieder Frühling! Der Prophet Jesaja versichert, dass die Dinge Gottes nicht zu ihm zurückkehren, ohne Frucht gebracht zu haben; denn die Kraft liegt nicht im Sämann, sondern im Samen, nicht im Prediger, sondern in der verkündigten Frohen Botschaft. Nicht die Tüchtigkeit der Eltern ist maßgeblich, sondern die innere, gute und unüberwindliche Kraft dessen, was sie ihren Kindern weitergegeben haben: Die Kraft liegt im guten Samen, nicht im guten Sämann.“
Eine herbstliche und vielleicht winterliche Kirche muss sich diesen Vorsprung der Gnade und das Bekenntnis zu den größeren Möglichkeiten Gottes sagen lassen; nicht etwa als Vertröstung und Ausrede zum Nichtstun, sondern als Impfung gegen das Virus der Selbstüberforderung und als Arznei gegen die tödliche Gefahr für den Glauben, sich zu viel und Gott zu wenig zuzutrauen. Wir dürfen bei vielen „Seltengehern“ und auch bei den Kindern, die sich leider nach dem großen Fest der Erstkommunion - und auch infolge der Corona-Pandemie und er Phasen desgeistlichen „Lockdowns - rar machen“ in unseren Gemeindegottesdiensten, darauf vertrauen, dass der Glaube in ihnen wie ein Samenkorn verborgen liegt.
Im Urlaub war ich wie so oft schon in Montegrotto Terme in Venetien. Dieses größte Kurzentrum Europas lebt von Quellwasser, das in den Südalpen viele Kilometer entfernt ins Grundwasser sickert, wie ein unsichtbarer Fluss verschwindet, sich seinen verborgenen Weg durchs Gestein bahnt und dann zig Kilometer entfernt ebenso urplötzlich wieder vor den Euganeischen Hügeln auftaucht –angereichert, als heißes und mineralstoffreiches Heilwasser. Der Glaube rinnt zuweilen wie ein unmerklicher Bach durch die verborgenen Schichten unseres Innenlebens. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Same des Evangeliums auch in den Zeitgenossen unter uns unmerklich heranreift, die augenblicklich den Zugang zum regelmäßig praktizierten Christentum verloren haben. Und wir, denen der regelmäßige Kirchgang und das Engagement in unsere Kirche ‚trotz allem‘ wichtig bleibt, sollen den ‚Kirchenfernen‘ Patin und Pate, Fürbitter und geistliche Eltern bleiben, unser Christsein bezeugen, mit den dem kirchlichen Glauben Entfremdeten im Gespräch bleiben und auch in den ‚Randsiedlern‘ der Kirche Gottes Kinder sehen; denn in allen dürfen wir Gottes Kraft und sein Werben und Bitten wahrnehmen.
Ihnen und Euch einen schönen Spätsommer
Kurt Josef Wecker, Pfr.
In einem Stau, der sich langsam auflöst
Betrachtung zu dieser sommerlichen Übergangszeit von Kurt Josef Wecker
„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, so lautet tiefsinnig der Titel eines Romans von Joachim Meyerhoff. Wann geht es endlich so weiter, wie es vorher war - nach dem Ausnahmezustand der Pandemiekrise? Sind wir bereits im ‚Danach‘? Wir haben Gott sei Dank schöne Erstkommunionen, Tauffeiern und Hochzeiten feiern können, konnten die Wallfahrtsoktav in Heimbach wagen, dürfen wieder im Gottesdienst singen, sehen uns wieder leibhaftig von Angesicht zu Angesicht in unseren Gremien und nach den Gottesdiensten, gestalten auch in den kleineren Gotteshäusern wieder Liturgien. Den Ideen und Hilfestellungen vieler Ehrenamtlicher – den Ordnungsdiensten, Kirchenvorständen und Pfarreiräten, den unzähligen Einzelinitiativen und Nachbarschaftshilfen – ist es zu verdanken, was trotz allem möglich war. Und doch lassen uns steigende Inzidenzzahlen und die Folgen einer gewissen Impfmüdigkeit und Lässigkeit vorsichtig bleiben.
Die Sehnsucht nach Normalisierung ist eine verständliche, wenn auch bescheidene Regung; eine rückwärtsgewandte Hoffnung, ausgerichtet auf den Zustand, wie er „vorher“ war. Gebe ich mich zufrieden mit der Hoffnung auf die Rückkehr zu einer (neuen) Normalität? Oder strecke ich mich aus nach dem „Neuen“, in dem noch niemand war und dessen Ankunft wir nur ahnen? Das Neue! Manche befürchten es, einige hoffen darauf. Und wie sich ‚das Neue‘ konkret in unserem zukünftigen Gemeindealltag zeigen wird, das steht noch dahin…
Pünktlich zur Urlaubszeit gibt es 2021 garantiert wieder etwas Normales zu vermelden: der Stau auf Deutschlands Straßen. In der Phase des ersten strikten Lockdowns gab es kaum Staus auf den Autobahnen, die Warteschlangen einer mobilen Gesellschaft. In der verstörenden Zeit im Frühling 2020 stieß ich in der Wochenzeitung DIE ZEIT auf einen Essay über Julio Cortázar (1914-1984) und seine Erzählung „Südliche Autobahn“ (1966). Die Erzählung wurde für mich zum Gleichnis dieser Zeit; sie legt offen, wie es uns in der Unterbrechung der für selbstverständlich gehaltenen Fließbewegung des Lebens ergeht und wie es womöglich ‚danach‘ weitergeht. Der argentinische Wahlfranzose, ein Meister der phantastischen, surrealistischen Literatur (und welche Literatur passt besser zu solchen ‚verrückten‘ und ‚unheimlichen‘ Zeiten als die des Surrealismus…?!), beschreibt darin etwas zunächst Alltägliches. Er erzählt die Geschichte vom jähen Ende der Mobilität: Auf der Autobahn Richtung Paris entwickelt sich im Wochenendverkehr an einem heißen Augusttag ein Stau. Der Verkehrsfluss bleibt stehen – und irgendwie auch die Zeit. Wir kennen diesen Zwischenfall nicht nur aus den Litaneien des Verkehrsfunks: die tägliche kleine Apokalypse des ‚Nichts-geht-mehr‘, die leere, entleerte Wartezeit im erzwungenen Lockdown, die meist kurzzeitige Unterbrechung des kontinuierlichen Verkehrsstrom. Der moderne Nomade, wir pilgernd bewegte Menschen, aber auch der zielbewusste Macher erleiden die Erfahrung mit dem, was nicht in unserer Macht steht. Wir gelangen an die Grenze des Planbaren. Auf uns zurückgeworfen, erleiden wir einen spürbaren Verlust an Lebenszeit – oder nutzen diese Wartezeit zum Nachdenken. Ein unerwartetes Ereignis, Unverfügbares und der Zustand unabsehbarer Dauer versetzen mich in den Zustand der Passivität und Nervosität. Die Ursache für den Halt auf der Autobahn in Cortázars Kurzerzählung bleibt verborgen. Aber irgendetwas ist dazwischengetreten und wurde zum gewaltigen Stoppschild. Noch ahnt niemand das Undenkbare: dass dieser Stau sich nicht auflöst, sondern monatelang dauern und das Leben aller Verkehrsteilnehmer in der folgenden Zeit prägen wird. Man kann nicht einmal ‚auf Sicht fahren‘. Es herrscht ein permanenter Krisenzustand. Die in einer Schicksalsgemeinschaft Gefangenen sitzen in der Falle: Das Ende aller Freiheit und Mobilität. Allen ergeht es gleich. Niemand kann sich davonmachen; alle sind unbehaust, abhängig und angewiesen. Das Grundrauschen des Lebens auf der Autobahn fehlt in dieser Stille, die wehtut; ein Kontrollverlust, wie ein böser Traum. Eine unfreiwillige Solidargemeinschaft ist zum Warten verurteilt. Doch in diesem Ausnahmezustand erweist sich schnell, was im Menschen steckt und wie er sich in Grenzsituationen entwickeln kann. Erzählt wird, wie ‚Verkehrssteilnehmer‘ in dieser Grenzerfahrung über sich hinauswachsen und das Menschliche in sich entdecken. Da offenbaren sich die wahren Charaktere: ein Panoptikum: genervte und frustrierte Zeitgenossen, von denen einige angesichts der Erfahrung unbefristeter Wartezeit zunehmend aggressiv reagieren. Andere entwickeln im „Zeitstau“ ein starkes Gemeinschaftsgefühl; es werden kollektive Hilfsaktionen organisiert; mit der Zeit entwickeln sich feste Rituale; doch manche der Gestrandeten entpuppen sich als „Ichlinge“ und „Krisengewinner“. Es kommt zu kleinen Verteilungskämpfen. Da sind Biedermänner und Großmäuler, Wortführer mit Organisationstalent, Führungsstärke und Überlebenswillen. Feinfühlige zeigen in dieser einförmigen Monotonie Nächstenliebe und Empathie. Kinder werden während des monatelangen Stillstands gezeugt. Menschen sterben, und deren Autos werden von anderen Verkehrsteilnehmern pietätvoll mitgeschoben, wenn sich die Stauschlange mal ein wenig bewegt. Die Menschen tragen keine Namen, sie werden nach ihrer Automarke bezeichnet: „Der Porsche“, „der DKW“, „der 2 CV“, „der Taunus“ … Man schläft in den Autos und geht am Straßenrand auf Proviantsuche. Es kommt zum Kampf um den knappen Proviant. Alle warten nur auf das Ungewisse: auf das eine erlösende Ereignis - wie auf einen Messias! Wann endlich löst sich der Stau auf, damit es endlich weitergeht…? Eines Tages – man hat schon gar nicht mehr darauf zu hoffen gewagt – löst sich der Stau wie aus heiterem Himmel tatsächlich auf. Jeder schaut, wie er so schnell wie möglich wegkommt. Die zeitlich begrenzte Solidargemeinschaft findet abrupt ein Ende; man verliert sich aus den Augen; der Drang zur „Rückkehr in die Normalität“ ist stärker und erweist das Folgenlose der widerfahrenen Unterbrechung. Die geisterhafte Straße wird wieder zum Transitraum. Eben noch war man aufeinander angewiesen. Doch nun fährt man, auf Nimmerwiedersehen, aneinander vorbei - Paris entgegen, als wäre nichts geschehen, als hätten alle im Stau Gefangenen die Monate des Wartens und des gemeinsamen Duldens vergessen. Die von allen erlittene Stauerfahrung bewirkte keine Reinigung und innere Umkehr. Das Erschrecken über das Einfrieren der Bewegung, die Erfahrung von Begrenzung und Immobilität – all diese Zumutungen blieben an der Oberfläche; der Schock darüber, wie zerbrechlich Lebenspläne sind und wie wenig selbstverständlich das heile Erreichen eines Tagesziels ist, ist rasch überwunden. Die Krise blieb nur eine vorübergehende Zäsur. Man schaltet in die davor gewohnte Beschleunigung zurück und lässt diese kleine Endzeiterfahrung hinter sich, als sei sie unwirklich gewesen. War da etwas Existenzerschütterndes? Ist diese Zäsur ein Stück meiner Lebenszeit gewesen? Dieses Verhalten ist Ausdruck einer „Kultur des Vergessens“. Der Riss wird sehr bald völlig aus dem kollektiven Gedächtnis der Betroffenen verschwunden sein. Wer ist ‚danach‘ auf der Überholspur, auf der allein der Imperativ gilt: schneller, weiter, mehr…?
„…. und mit achtzig Stundenkilometern fuhr man den Lichtern zu, die allmählich größer wurden, ohne dass man genau wusste, wozu diese Eile, warum dieses Rennen in der Nacht zwischen fremden Autos, in denen keiner etwas vom anderen wusste und jeder nur geradeaus starrte, nur geradeaus“, so Cortázar. Man muss kein Prophet sein, um für die Nachpandemiezeit vorauszusagen: Das Planen und Rennen ‚danach‘ wird wieder losgehen. Wieder der ‚alte Trott‘, das Leben auf Hochtouren? Und was ist mit denen, die wir in dieser schweren Zeit verloren haben und für die es kein irdisches ‚Danach‘ gibt? Wie werde ich aus dieser Störung meiner Lebensabläufe hervorgehen? Es steht noch dahin, ob mich diese Krise zu einem „besseren“ oder nachdenklicheren Menschen verwandelt hat … Wir alle standen im Stau und fragen uns, was eigentlich – auch in unserem kirchlichen Leben - in diesem Shutdown an sein Ende gekommen ist. Wird es also so sein, dass wir bald vergessen und durchstarten? Wird es so sein, dass wir, die wir davongekommen sind, uns verwundert die Augen reiben über eine seltsame Episode, die uns überrollt hat und uns plötzlich und unerwartet zum Stillstand zwang? Es kann sein, dass wir schnell vergessen - so wie sehr rasch in den „Goldenen Zwanzigern“ der Erinnerungsfaden an die spanische Grippe von 1918/19 riss.
Es ist menschlich verständlich, dass viele von uns zurückkehren möchten zum Status quo und verlässlichen Haltepunkten auch in unseren gemeindlichen Abläufen. Denn wir lebten gerade im einsamen Stillstand aus der Erinnerung an Glücksmomente im ‚Davor‘: Hoffentlich werden wir diesen erlösenden Augenblick feiern, uns also „irgendwann“ gelöst in den Armen liegen, singen und feiern und uns ohne Abstand anlachen, dicht besuchte Gottesdienste erleben, Messdienerfreizeiten, Chorgesang, Gruppenstunden in der Kommunionvorbereitung, Altenheimgottesdienste, Pilgerprozessionen… Werden wir uns dann in aller Gelöstheit das Gespür dafür bewahren, wie fragil das Geschenk der Gesundheit ist, wie zerbrechlich diese Welt oder wie kostbar die Leihgabe eines geliebten Menschen? Noch steht dahin, was die kollektive Erfahrung des Stillstands aus uns machen wird und wie lange wir in unserem Lebensstil die Folgen der Pandemie spüren.
Die Rückkehr zur Normalität ist im Alltag oft eine Wohltat und Stütze. Sie ist uns zutiefst zu wünschen, auch die Auszeit des Urlaubs. Für uns Christen wäre der bloße Rückweg in eine altbewährte Normalität zu bescheiden und fad. Wer an die Grenze gestoßen und dem Verborgenen begegnet ist, wird sehr nachdenklich und aus alten Bahnen herausgerissen. Gerade jetzt, wo ‚es‘ womöglich wieder losgeht, brauchen wir Orte, wo wir wahrhaft ‚ins Freie‘ gehen, Geheimnisse feiern, die alle Normalität sprengen und Wartesäle der stillen Nachdenklichkeit und der Hoffnung, wo wir gemeinsam neugierig und angespannt auf die Ankunft eines ganz Anderen, auf den erlösenden Salvator, warten.
Ihnen und Euch einen hoffentlich stau-freien und erholsamen Sommer und viel Zuversicht für die Zeit danach…
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Gebet zur Hochwasserkatastrophe
„Mit lauter Stimme schrei ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not. (Psalm 142, 2-3)
In der Hoffnung, dass Gott das Leid und die Not der Menschen sieht, Klagen und Bitten hört und erhört, denken wir an all jene die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind und beten für sie:
„Herr, stehe ihnen bei.“
Gütiger Gott, wir trauern mit denen, die einen Menschen
in den Wasser-/ Geröll- und Schlammfluten verloren haben.
Wir trauern mit denen, die einen Angehörigen vermissen
und auf ein Lebenszeichen hoffen.
Wir trauern mit denen, die unter der Last der Ungewissheit wie das Leben für sie nun weitergehen kann zu zerbrechen drohen.
Barmherziger Gott, wir klagen mit denen die Hab und Gut verloren haben und jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.
Wir klagen mit denen, die ihre gefährdeten Häuser und Wohnungen verlassen mussten.
Wir klagen mit denen, die an die Grenzen ihrer Kräfte in den Herausforderungen der Katastrophe gelangt sind.
Wir klagen mit denen, die weiterhin auf Rettung warten.
Wir klagen mit denen, die körperliche und seelische Schäden
erlitten haben.
Wir klagen mit denen, die in Sorge und Angst vor weiteren Überschwemmungen und damit verbunden Zerstörung leben müssen.
Gott des Lebens, wir danken für den großen Einsatz der Männer und Frauen der Feuerwehren, Sanitäter, DLRG, THW, Bundeswehr und
viele weitere ehrenamtliche und hauptberufliche Einsatzkräfte und Rettungsdienste.
Wir danken für die zahlreichen Helfer und Helferinnen die spontan
und tatkräftig die Not der Betroffen lindern.
Wir danken für die Spenden und Hilfsgüter so vieler im ganzen Land.
Treuer und barmherziger Gott, gib, dass die Menschen in ihrer Not und Verzweiflung deine helfende Nähe spüren und Trost finden bei Dir. - Amen.
(Gemeindereferentin Susanne Jansen)
Die Hoffnung auf einen großen Sommer
Geistliche Gedanken zur Urlaubszeit und dieser besonderen Jahreszeit
Kurt Josef Wecker
Liebe Mitchristen,
das Votum auf die Frage: Sind Sie für oder gegen die Sommerzeit, die Reaktion auf die zweimalige Zeitumstellung im Jahr spaltet die Gesellschaft. Ich persönlich bin für die Beibehaltung der ‚Sommerzeit‘. Aber da kann man aus guten Gründen auch anderer Meinung sein… Vielleicht können nicht alle von Ihnen meine Liebeserklärung an diese Jahreszeit nachvollziehen - und mein Eingeständnis, dass ich mir das ewige Leben wie einen nie aufhörenden Sommer vorstelle. Ja, ich weiß, es gibt vermutlich mehr Frühlingsmenschen als Sommer-Fans. Und mir ist klar: Gott hat Sommer und Winter gemacht (Gen 8,22 und Ps 74,17, Ps 104), und dazu noch zwei weitere Jahreszeiten. Alles hat seine Zeit (Koh 3,11f.17), und der Schöpfer liebt die bunte Gnade, die Abwechslung und die Vielfalt. Doch ich muss nicht alle Schöpfungsgaben und Zeiträume Gottes gleich liebhaben und halte früh Ausschau nach Vorboten des Sommers (vgl. Mt 24,32). Ein Supersommer würde mir nie auf die Nerven gehen. Ich werde besonders im Sommer Schöpfungstheologe und besinge die Schönheit dieser Zeit. Soviel Blühen und Reifen war nie! Das Leben ist schön – dieser Satz geht mir besonders in dieser Zeit oft durchs Gemüt und über die Lippen.
Was predigt mir der Sommer? Vielleicht ist das übertrieben, und diese Jahreszeit wird von mir überschätzt … Vieles geht irgendwie leichter als sonst, auch das Aufstehen; vielleicht auch deshalb, weil der Sommer die bevorzugte Urlaubszeit ist. „Geh aus, mein Herz und suche Freud“ (evangelisches Gesangbuch 503), so lautet Paul Gerhards wunderbares Sommerlied, eines der beliebtesten Kirchenlieder der evangelischen Frömmigkeit. Ich, der ich eher Stubenhocker bin, halte mich dann gerne draußen auf, mit zunehmendem Alter eher im Schatten als in der prallen Sonne, laufe am Strand oder lasse mich auf einer schattigen Parkbank nieder, vielleicht auf den Boden gestreckt in einem verwunschenen oder paradiesischen Garten, auf Balkonien oder im Außenbereich der Gartenlokale. Ja, im Sommer werde ich außenorientiert und zugleich langsamer. Ist es das politische Sommerloch, das uns trotz der Wahlkampfzeit eine Weile von den schweren Themen des Tages ablenkt? Ist es 2021 die Hoffnung auf ein Abflauen der Pandemie, auf einen Sieg über den Ausnahmezustand? Nicht für alle ist der Sommer ein Vergnügen. „Ich hasse den Sommer, der mich vernichtet“, dichtet der Rimbaud. Und Gottfried Benn dichtet 1936 „Einsamer nie als im August.“. Bei diesem Dichter kommt der Sommer auch darum schlecht weg, weil Benn ihn mit einer „Erfüllungsstunde“ vergleicht, mit einer erhofften Zeit, die nun einfach ‚da‘ ist. Wenn sich etwas am Gipfel oder Ziel erfüllt, kann man schwermütig werden, weil der Höhepunkt nun erreicht ist, das Licht ab dem 21. Juni schwächelt und der Herbst droht. Fans anderer Jahreszeiten singen eher ein Loblied auf den sehnlichst herbeigewünschten Frühling oder werden nachdenklich wegen des Herbstes mitsamt den dramatischen Veränderungen in der Natur, die er mit sich bringt. Oder sie gewinnen als Skisportler dem grimmigen Winter freundliche Züge ab. Mit Sommer assoziieren einige allererst Wespen, Sonnenbrand und Schwitzen, Extremwetter, Dürre und Waldbrände, verregnete langweilige Ferientage, Hitzeperioden und ersehnte Abkühlung, schlechten Schlaf wegen der warmen Nächte und wenn die schwüle Luft ‚steht‘, auch die die frühen und melancholisch stimmenden Vorboten des Herbstes im Blick auf abgeerntete staubige Felder. Auch die Bibel weiß um die Gefahren und Mühen des Sommers, die unerbittliche Hitze und das Lechzen nach Kühlung. Nehmen wier die Bibel als Sommerlektüre und lesen wir mal nach, z.B. in Jes 25,4 und Sir 34,19! Bereits die Bibel empfiehlt wie ein Augenoptiker Augenschutz vor der gleißenden Sonne (Sir 38,29 und 43,3) und preist den wohltuend kühlenden Morgentau im Hochsommer (Sir 18,16); sie gibt der Sehnsucht nach Schatten Ausdruck (Jes 49,10) und stöhnt: Wer hält es aus in dieser Bullenhitze! (vgl. Sir 43,2f). Sie weiß um die tödliche Kraft der Hitze (Offb 16,9; Sir 14,27) und den Durst an einem Sommermittag, den Jesus spürt (Joh 8,12). Wir stellen uns Jesus vor, wie er im „galiläischen Frühling“ durch seine Heimat zieht und im Sommer die Gleichnisse von Saat und Ernte malt (vgl. Mt 6,25-34) und uns einen Bauern zum Vorbild gibt, der sich nichts tuend hinlegt und in aller Seelenruhe Gott einen guten Schöpfer sein lässt. Doch den biblischen Menschen, wie überhaupt der Antike, war die Sehnsucht nach einem kühlenden Bad im Meer, nach einem Sonnenbad am Strand und dem Besteigen sonnenumglänzter Gipfel fremd. Für mich ist die dritte Jahreszeit eine wunderbare Gabe des Schöpfers; und ich kann Gottfried Keller verstehen, der dichtet: „Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt.“. Es ist buchstäblich Zeit, sich zu betrinken am Überfluss der Farben und Gerüche, am Glanz des Sonnenlichtes, an der Farbe der Erdbeeren und Kirschen, der Bläue des Himmels und des Meeres, an den Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden freien Zeit. Jetzt wo das Jahr wie im Gleichgewicht ist -“die große Waage ruht“ liegt (Gotteslob 465,1), die Zeit stillsteht und auch in Mendelssohns‘ Musik Sommernachtsträume wahr werden, da wird der Hunger nach Wärme und Licht gestillt, der uns allen im Blut liegt. Könnten wir doch -anders als Rilke – in der Gegenwartsform sagen: Herr, dieser Sommer ist groß! Der zum Protestantismus konvertierte Jude Heinrich Heine wagt einen augenzwinkernden Konfessionsvergleich und sagte es unnachahmlich (im 3. Teil seiner ‚Reise von München nach Genua‘) nach einem sommerlichen Dombesuch in Trient: „Man mag sagen, was man will, der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es lässt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man träumt dort die kühle Andacht, ein heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend in ihren Nischen, weiblich gesinnt verzeihen sie sogar, wenn man ihre eigenen holden Züge in den sündigen Gedanken verflochten hat, und zum Überfluss steht noch in jeder Ecke ein brauner Notstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.“
Ein Kardinal meinte jüngst, die Kirche befände sich „am toten Punkt“…. So schwarz möchte ich nicht blicken. Vielleicht ist sie am Nullpunkt und muss sich ganz neu ausrichten, jedoch nicht in schweißtreibender Reformhast. Würde man den Zustand der Gegenwartskirche mit einer Jahreszeit vergleichen, dann wohl am ehesten mit dem Winter (sprichwörtlich ist Karl Rahners Wort von der „winterlichen Kirche“) oder dem Spätherbst. Frühling und Sommer fallen uns dazu weniger ein. Oder befindet sich die Kirche doch eher in einer „Übergangsjahreszeit“? Übergang – wohin?
In Gottesdiensten im Sommer feiere ich ein Dankeschön für geschenkte Zeit. Vielstimmig predigt der Sommer zu mir. Ich entdecke im Sommer eine Facette meines Gottesbildes die ich in den ‚Übergangsjahreszeiten‘ und in der Kälte des Winters vergesse: Gott geizt nicht. Er mutet uns Vieles zu, die Hitze des Alltags, Dürrezeiten, „Durst und Staub der langen Reise“, das Geblendet-Werden von der brennenden Nähe des ‚Dornbusch-Gottes‘ und auch das Suchen und Fragen nach Ihm angesichts seiner tiefen Verborgenheit, die „ozeanischen Gefühle“ vor dem unermesslichen Meer und die Ahnung einer dahinterstehenden Schöpferkraft. Ja, Er gönnt uns Großes: Licht, Leben, Früchte, Reife, Wärme. Verschwendung, Geiz und Ausschweifung haben nicht immer den Geruch der (Tod)Sünde. Und vielleicht bin ich deshalb – trotz vieler Sympathien für die protestantische Frömmigkeit, Theologie und Musik – so gerne ein katholischer Christ, weil uns Katholiken der quasi barocke Überschwang eher im Blut liegt, -ein Glücksgefühl, das nur der Sommer bereithält, eine zeitweise sinnliche, überbordender Lebensfreude, meine Liebe zu Italien, die Lust am Genuss, überwältigt vom Füllhorn und der Großzügigkeit des Schöpfers. Und so lade ich uns ein, wie die Kinder zu singen: „Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da…“
Ihnen und Euch eine erholsame Ferienzeit, kleine Sommerwunder, ein zuversichtliches Aufatmen!
Kurt Josef Wecker, Pfr (Nideggen/Heimbach)
Der Gottesdienst aus der Salvatorkirche Heimbach am 06.06.2021 mit Bischof Helmut Dieser.
https://www.youtube.com/watch?v=WEYlaZ9C5V8&ab_channel=PfarreiSt.ClemensChristusSalvatorhttps://
durch anklicken des Links öffnet sich das Video.
Der Gottesdienst zum 40. Weihetag der Salvatorkirche in Heimbach am 24.05.2021
Durch anklicken des Links öffnet sich das Video
https://www.youtube.com/channel/UCQlCRAHKecPKk-QH7QNE8aA/videoshttps://
Die Predigt zum Gottesdienst zum 40. Weihetag der Salvatorkirche.
PREDIGTGEDANKEN
zum 40. Weihetag der Salvatorkirche in Heimbach am 24.Mai 2021
Offb 21, 9-26 und Joh 4,19-24
Pfingsten ist ein Fest des `überfließenden Gottes. Er fließt hinein – hoffentlich in eine Kirche, die ‚nicht ganz dicht ist‘. Ohne den Bauzustand unserer bereits nach 40 Jahren renovierungsbedürftigen Kirche und des undichten Daches der Salvatorkirche schönzureden, gilt: Gott sucht eine Kirche, die buchstäblich porös ist, nicht ganz dicht, die sich nicht hermetisch abschließt vor dem überfließenden Himmel. die (wie in machen Kirchen Bayerns) ein „Heiliggeistloch“ hat. Der Pfingstmontag, an dem wir heute den Geburtstag dieses Gotteshauses begehen, ist – strenggenommen -ein überflüssiger Anhang im Kirchenjahr, eine Zu-Gabe zu diesem Fest des Überflusses, das wir Pfingsten nennen. Am 51 Tag gedenken wir des 551. Geburtstages des Gnadenbildes und des 40 Geburtstags dieses Schatzhauses für das Bild. Wir feiern Geburtstag, den bemerkenswert jungen Geburtstag einer Kirche mit uraltem Patrozinium. Nicht nur von Steinen und Zement und Glas, sondern von den kleinen Geburtstagen und Atempausen, für die diese Kirche so vielen Beterinnen und Pilgern eine vorbereitete Umgebung bot und bietet. Wie schön, dass es dich gibt, du Haus des göttlichen Gastes. Wie schön, dass Menschen vor mehr als 40 Jahren so etwas gewagt haben, ins Werk zu setzen. War damals angesichts schon vor 40 Jahren zurückgehender Gottesdienstbesucher und Pilgerzahlen ein zweiter Kirchenraum in Heimbach nötig? Ist dieser Bau – im Rückblick betrachtet– 'überflüssig'? 'Hätte es die Clemenskirche ‚auch getan‘? Überflüssigkeit' ist, geistlich verstanden, trotz aller Zweckbestimmung des Kirchenraumes Ausdruck der Zweckfreiheit, der Unentgeltlichkeit der Gottesverehrung, Zeugnis des Heilig-Unbrauchbaren und des von Gott her Überfließenden. Es ist schön, dass es auch neue Orte gibt, an denen Menschen Gott Raum und sich selbst Frei-Raum einräumen in dieser Welt. Fehlt uns das Verständnis für diese Form von 'Überflüssigkeit'? Diese Kirche war und ist ‚mehr als notwendig‘. Sie erinnert uns daran, dass sich nicht alles rechnen muss in dieser Welt und Kirche.
Doch bei aller Überflüssigkeit- wir brauchen Kirchen. Wir! Nicht Gott! Unseren Seelen haben diese eigenartigen Räume nötig, in denen Gott mit uns Verstecken spielt (und wir mit ihm…), diese Wartesäle unsere Hoffnung. Hier passiert nicht die langersehnte Rückkehr zur neuen Normalität, sondern der völlige Abbruch des normalen Betriebs, die Unterbrechung unserer Gottesdienstveranstaltungen. Vor 40 Jahren wurde hier eine Stätte geweiht, an der Neues geschieht, vielleicht auch die Leere und die Stille ausgehalten werden müssen; eine Lautlosigkeit, die uns überfällt und auffällt, wenn wir hier alleine sind und eintauchen in die Stille und nur unseren Atem hören, wenn wir das Zwiegespräch mit dem Bild der Gnade wagen. Die Kirche hier wurde für viele ein Ort, an wir vielleicht besser beten können als draußen, als zu Hause… Wer weiß…! Die Salvatorkirche ist eine der Orte, an denen wir verwandelt werden - von Wanderern zu Pilgern, von Spaziergängern zu Wallfahrern, von Leuten, denen Maria vielleicht wenig bedeutet zu Marien Verehrerinnen auf Zeit, denen dieses Bild etwas sagt…
Damals vor 1981 hatte Heimbach ein Raumproblem: Wie bekommen wir die Gäste Gottes unter, die hierhin pilgern (bereits am Nachmittag des Weihetages kamen 800 Stollberger als Fußpilger zur Andacht und der Bischof schmunzelte, dass selbst diese größere Kirche für solch ein Wallfahrtsfest zu klein ist), dieses Schmuckstück mitsamt dem heiligen Bild und die Pilger, die sich jahrzehntelang schwitzend und müde drängelten in der Clemenskirche und im jetzigen Kommunikationsraum. Man schuf ein 'Haus des Gastes', des fremd-nahen Gastes Christus und der hin- und wegpilgernden Gäste, die sich von Ihm bewirten und heiligen lassen. Die alte Pilgerkirche, so heißt es, sei den Pilgerströmen nicht mehr gewachsen gewesen. Das kostbare Gnadenbild war also auf Herbergssuche und brauchte einen angemessenen Schutz- und Schauraum. Inzwischen ist der Neubau, gerade weil er sich nicht aufdrängt, aus dem Ortsbild nicht mehr wegzudenken; er hat sich harmonisch eingefügt in das Stadtbild. Errichtet wurde eine Kirche, die Menschen sammelt, damit wir einen Ort haben, um uns vor der Schmerzhaften Maria von Heimbach loszulassen, abzuladen. Unsichtbare Zettelhaufen und Steinhaufen haben sich aufgetürmt hier, wo Menschen ihrre Lebenslast loswurden vor Maria. Die Kirche, ja, als Schuttabladeplatz, als Ort, wo wir auch Steine fallen lassen dürfen.
Der aus Süd-Korea kommende Berliner Philosoph Byung-Chul Han sagt: „Pilger und Touristen gehören in Wirklichkeit zwei ganz verschiedenen Ordnungen an. Touristen durchreisen sinnentleerte Nicht-Orte, während die Pilger an Orte gebunden sind, die Menschen versammeln und verbinden.“ Dem 2. Teil des Satzes kann ich zustimmen, doch der Gegensatz im ersten Satzteil und der latente Dualismus gehen mir zu weit. Ja, diese Kirche sammelt Menschen, die eben noch in Bewegung waren. Und mehr denn je spüren wir in dieser Coronazeit, wo sich viele geistlich obdachlos und orientierungslos erfuhren: . Wir brauchen verlässliche Orte, die mich ansprechen, zeitgenössische Orte, die mich beheimaten (ohne eine Art gemütliches Wohnzimmer‘ zu sein); Kirchräume, die wie diese Zeltkirche für die Stabilität und Mobilität des Glaubens stehen. Hier wollen wir Gott begegnen und uns der Schmerzhaften Mutter anvertrauen. Hier sind wir willkommen mit unserem Gebet und auch willkommen, wenn wir nicht beten können - weil wir vor Maria nicht beten müssen. Eben waren wir Wanderer und Fremdlinge; nun erleben wir uns in diesem Halbrund als „Circumstantes“, also als Umstehende. Eben waren wir noch das 'wandernde Volk Gottes', nun sind wir das 'wartende Volk Gottes', leben im Dazwischen, angewiesen auf Gastlichkeit. Jeder darf sich hier setzen, wo er und sie will, jeder und jede darf Nähe und Distanz zum Heiligen selbst bestimmen
Wenn wir Kirchen bauen, dann gönnen wir uns etwas Gutes. Nicht Gott leidet unter Wohnungsmangel (es sei denn, wir verweigern ihm in uns den Einlass); der Salvator braucht keine Salvatorkirchen. „Gott Wort braucht keine Dome“ (predigte nach der Wende Präses Beier von Düren/ Jülich im Deutschen Dom Berlin vor der versammelten Staatsspitze).
Und Pfingsten ist ein durchaus kirchbaukritisches Fest, denn der Geist des Auferstandenen sprengt Häuser aus Stein, er sucht das Weite, das Offene, er sucht auch die Ritzen und Zwischenräume, die Leerräume. Er, der Unerwartete, braucht Kirchen, die nicht ganz dicht sind. Und Menschen, die einen ‚Knacks‘ haben. Das Evangelium zu Kirchweih sagt es uns: Jesus will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, nicht auf dem Berg Garizim oder im Tempel oder in diesem Haus aus Stein und Glas. Wir sind der Tempel Gottes. Er sucht in uns eine 'zweite Heimat', er ist in uns auf Herbergssuche; er ist nicht festgelegt und eingebaut und gefangen in Räumen aus Glas und Stein, er ist so frei, er will allüberall angebetet und verherrlicht werden. Noch einmal: Nicht der Salvator, sondern wir geistlich Obdachlose 'brauchen' Zufluchtsorte, Fluchtpunkte unserer Wege. Und das Gnadenbild, Zeugnis der Materialisierung der Glaubensfrömmigkeit, ursprünglich in einen Häuschen im Wald verehrt, suchte ein schützendes Dach.
Nicht Gott brauchte diese Kirche, aber der goldene Schrank von Antwerpen/ Heimbach, dieses Kunstwerk und ein Gnadenbild suchten einen Schutzraum, ein Schatzhaus. Vor 35 Jahren, im Juni 1986, kehrte der Schnitzaltar nach Jahren der Restaurierung im Rheinischen Amt für Denkmalpflege in Bonn nach Heimbach zurück und fand seinen Standort in dieser Kirche.
Die 'Bauhütte' (der Bildhauer Professor Elmar Hillebrand, der auch mit dem Sakramentshaus, dem Vierungsaltar, der IX. Kreuzwegstation,dem Osterleuchter und der Gedenktafel für den Besuch Papst Johannes Pauls II. im Kölner Dom gewirkt hat; Prof Theo Heiermann; Prof Karl-Heinz Thomé, Ortspfarrer Josef Olivier, Prof. Albert Gerhards) musste Rücksicht nehmen auf geographische Vorgaben, auf den Turm als das verbindende 'Und' zwischen der alten Kirche und der räumlich zurücktretenden neuen Kirche im Westen, auf liturgische Abläufe... . Die beiden Kirchen in Heimbach gehen nahtlos ineinander über, sie spiegeln Pluralität wider. Hier wurde kein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen und doch ein Schritt gewagt, der an der Zeit war: Heimbach wollte dem Kirchenbewusstsein des II. Vaticanums einen Stein gewordenen Ausdruck geben. Der Bau wird geschickt platziert, ohne auftrumpfend den Hang zu dominieren. Die Entscheidung zu diesem kühnen Werk feiern wir heute. Heimbach musste einem Schatz einen klimatisch günstigen Schutzraum bieten und zugleich der „Schaufrömmigkeit“ (ein eigentlich mittelalterlicher Frömmigkeitsakzent) des Pilgers entgegenkommen und tat es in diesem schönen Communio-Saal.
Der Raum wird den unruhig umherschweifenden Blick fokussieren auf den einen Dreh- und Angelpunkt, das Gnadenbild. Der Blick geht also nicht ins Leere. Doch das Licht kommt von Ostern und Pfingsten her.
Die Fenster geben diesem Raum das gewisse Etwas. Für Juden gilt, dass der Gebetes raum eine Öffnung haben soll:
„Ferner sagte Rabbi Chija bar Abba im Namen Rabbi Jochananns: Man betet nur in einem Raum, in dem Fenster vorhanden sind
Das Licht des Georg-Meistermann- Fensters überschreitet Grenzen, indem es gebrochen, gedämpft und verwandelt durch die Fenster (120 Quadratmeter) dringt. Die Pfingstflammen sollen überspringen auf uns. Baumaterial Tageslicht. Das 'Draußen darf ein-leuchten. Das Licht ist Liturge. 1
Mystisches Dämmerlicht stellt sich ein; durch die Lichtfläche der vollverglasten Südwand dringt gebremstes, gefiltertes, sanft abgefangenes Licht, zumal die oft dämmrigen Lichtverhältnisse in diesem Raum schwierig sind; ein lichtgeprägter, ein lichtdurchfluteter Raum, der zugleich mystisch-dämmrige Wirkungen zeitigt. Der Ort ist auch darin 'Übergangsraum'. Die quasi Glas-Haut der Fenster und die je nach Tageszeit wechselnde Lichtwirkung bauen mit an meinem inneren Erleben, die Fenster vermitteln zwischen Außen und Innen Dem Glaskünstler ging es darum, den Auferstandenen ins rechte Licht zu rücken. „Der Leib ist klar, klar wie Kristall“, singen wir zu Ostern mit Friedrich von Spee. Fenster sind keine Türen, keine unmittelbaren Öffnungen – auch wenn sich die untere Zone der Heimbacher Fenster in Hoch-Zeiten der Wallfahrt nach außen öffnen lassen und so die Transparenz der Kirche unterstreichen. Die 75 Glasfenster stehen für Dynamik, Lebendigkeit, die wir uns wünschen, aber nicht eigenmächtig produzieren können. Christus, der Verherrlichte, der Auferweckt-Gekreuzigte ist der – zuweilen von hinten, wie ein Dieb still und leise und völlig unerwartet - Eintretende (1 Kor 15,42 und Phil 3,20f). Licht und Glas gestalten den Hinaufgang, die Anabasis Christi und zugleich seine machtvolle Parusie. Der, der machtlos und tot in den Armen der Gottesmutter liegt, ist zugleich der machtvoll Erweckte und Herr seiner Gemeinde. Und wir sind Gäste des erhöhten Gastgebers. Ohne sein Kommen durch die Verschlossenheit des Obergemachs (Joh 20,19.26) und ohne den Adventus Domini in seine Salvatorkirche wäre unsere festlich gestimmte Versammlung ein vielleicht frommer Zirkel. Allein durch ihn und mit ihm und in ihm wird die Versammlung zur Kirche des Salvators, zu der dem Herrn gehörenden Gemeinde. Er ist der lautlos und schonend 'von drüben' Hinzutretende. Er ist der wie Licht 'Hereinbrechende'.
Ich weiß nicht, ob jedes Heimbacher Gemeindeglied diese Kirche spontan liebgewonnen hat oder ob sie ihm fremd war und fremd blieb. Warum auch nicht! Eine gewisse Hermetik tut jeder Kirche gut. Es spricht für einen Kirchenbau, wenn er „die große Fremdsprache im Meer der Geläufigkeiten“ (Steffensky) ist. Sie befindet sich in der Salvatorkirche in einem Gegenüber zum Spätmittelalterlichen, im Spannungsfeld mit dem spätgotischen heiligen Schrank und Gnadenbild. Die Salvatorkirche ist nicht spontan anheimelnd, sie darf eine fremde Heimat bleiben, vertraut und fremd zugleich. „Die Fremdheit ist ein köstliches Gut“ (Steffensky), freilich eine Fremdheit, die uns nicht bannt und abschreckt, aber Respekt einflößt vor dem Ungewöhnlichen, dem Unerwarteten; eine Fremdheit. Sie darf mir auch eine ‘gute Scheu' einflössen.
Wir sind 'dazwischen’. Das ist unser Standort. Er will dazwischen passen. Aus ihm fallen wir nicht heraus. Unser Zwischen-Sein wird zeichenhaft deutlich: wir im Schöpfungslicht, wir im Blickfeld des Auferstandenen.
Sprechen wir es an: Der Salvatorkirche fehlt, was die Clemenskirche bietet und was manche Gottesdienstbesucher schmerzlich vermissen. In der neuen Kirche brennt kein ewiges Licht, hier fehlt der Tabernakel, das Weihwasserbecken, der Taufstein, der Beichtstuhl, Apostelleuchter, die Opferkerzen und Auslagetische; selbst das Gnadenbild ist unberührbar in unerreichbar-erhabener Distanz zentriert aufgerichtet. Hier wird das Geschehen der Eucharistie gefeiert und Blickkontakt mit einem Bild gesucht.
Jede Wallfahrt ist ein Weg zum Christus-Salvator. Wege verenden nicht im Weglosen. Sie münden ein in Vororte des Himmels. Diese Kirche ist ein Schnittpunkt. Hier werde ich erwartet. Maria steht am Ziel des Pilgerweges und weist uns ein in das Geheimnis ihres Sohnes; sie leitet uns weiter; sie bleibt im Hintergrund. Sie fesselt uns nicht an den Karsamstag, sondern demonstriert uns in der Pietà den Fronleichnam, den lebendig österlichen Herrenleib. Auch wenn die Salvatorkirche an einem 24.Mai, dem ‚kleinen’ Gedenktag „Maria Helferin der Christen“ von Bischof Klaus Hemmerle konsekriert wurde, so weist die Helferin Maria auf die erlösende Hilfe des Auferweckten. Sie hält uns in Heimbach im Vesperbild 'den ‚Tempel seines Leibes' hin; die Schmerzensmutter Maria verzichtet darauf, eigens im Kirchennamen genannt zu werden. Demütig übernimmt sie die tragende 'Nebenrolle'. Und der Salvator verdrängt nicht seine Heiligen, ja: er tritt zurück, wie die neue Kirche der alten einen Vorsprung lässt und diese nicht ersetzt oder überflüssig macht.
Wallfahrt braucht einen Raum der Güte und des Willkommenseins; denn Wallfahrt ist eine „heilende Seelsorge‘ für Leib und Seele der Menschen, die sich auch mit ihrem Körper hierhin schleppen; für Heilsbedürftige, deren Lebenszelt (2 Kor 5,1) brüchig und löchrig geworden ist. Von einer Salvatorkirche erhoffen wir eine 'therapeutische' Wirkung, eine heilsame und tröstende Ausstrahlungskraft, die Heilung der Augen und des Herzens. In eine Wallfahrtskirche einkehren dürfen Menschen, die nicht nur auf Kirchgängen und ausdrücklichen Pilgerwegen sind, sondern 'Vorübergehende', Menschen auf Umwegen und Abwegen, Menschen, die 'harren auf der Schwelle' (F. Kafka) und hoffen auf niedrige, nicht unüberwindliche Schwellen. Die Salvatorkirche ist nicht nur für die nahe Wohnenden offen, sondern für die, die innerlich und räumlich von weit herkommen. 17 Jahre habe ich nahe am Gnadenbild gewohnt. Auch räumlich dem Heiligen und der Heiligen Nahe erleben, wie fern sie manchmal dem nahen Gott geworden sind....
Darum ist der Raum - ein Biotop der Seelen im Nationalpark Eifel nicht einengend, sondern einladend. Er biedert sich nicht an, er will erkundet, 'erbetet' werden. Die Salvatorkirche ist nicht nur Treffpunkt der Jungen, Schönen, Starken, Gesunden und Frommen, sondern Wartezimmer und heiliges Erste-Hilfe-Zelt für ‚Patienten Christi’, deren Leben, auch deren Glaubensleben, verletzt und beschädigt ist. In dieser Kirche ergeht der Heilandsruf, „die große Einladung“ (Kierkegaard) an alle, die mühselig und beladen sind. Der Ort ‚sancti salvatoris’ will Schwankenden Halt gewähren und Raum geben für Klagen und Fragen, für stellvertretendes Mittragen und tröstende Gesten. Er, der Salvator, steht nicht hinter uns als unsere Vergangenheit, sondern steht uns bevor als unsere Rettung und ist uns näher, als wir uns selbst jemals nahe sein können.
Wir hoffen, dass dieser Kirche mit junger Vergangenheit eine gute Zukunft bevorsteht.
Klaus Hemmerle sagte 1981 bei der Einweihung am 24.Mai, am Gedenktag Maria Helferin der Christen.:
Kirche der Nähe
und Kirche der Ferne
Kirche der Gemeinde
und Kirche der Pilger
Kirche zum Verweilen
und Kirche zum Umkehren
Kirche zum Eintreten,
wenn wir in Hast sind,
und Kirche, in der wir zum Aufbrechen kommen,
wenn wir umkehren wollen.
(Quelle: Kölner Rundschau vom 25.Mai 1981).
Kurt Josef Wecker
1.
Der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt am 13.05.2021 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Der Gottesdienst zu Weißen Sonntag am 11.04.2021 aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Nideggen.
Osterpredigt 2021
Nichts für schwache Nerven
(Predigten in Nideggen und Heimbach von Pfr. Kurt Josef Wecker)
Als im 14. Jahrhundert in Europa die Pest wütete, da schrieb der italienische Schriftsteller Giovanni Boccaccio seine Novellensammlung: „Das Dekameron“. Zehn junge reiche Leute flohen vor der Seuche in ein Landhaus bei Florenz und vertrieben sich die Zeit, indem sie einander Geschichten erzählten. Sie erzählten gegen die Pest an; dabei waren auch pikante und erotische Geschichten, man machte Party auf diese Weise und unterhielt sich zur Zerstreuung – mit Geschichten gegen den Tod. Wir Christen müssen um Gottes willen zusammenkommen, um in dieser Pandemiezeit Geschichten des Neubeginns und der Liebe zu hören, Geschichten, die uns nicht zerstreuen, sondern sammeln, die uns ins Leben führen. Kirche ist eine Gemeinschaft des Erzählens: Alle Jahre neu. „Wir aber hatten gehofft“, so werden es zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus sagen, die mit dem Tod Jesu ihre eigene Hoffnung begruben, gerade weil sie auf ihn alles gesetzt hatten. Auch wir hatten gehofft – dass es Ostern 2021 endlich vorbei sei, dass Ostern 2020 ein dunkler Ausrutscher war und wir wieder alles im Griff hätten und dass die Wege aus der Krise kürzer seien. In dieser Nacht wird uns kein Emmaus-Spaziergang, sondern eine seltsame Geschichte zugemutet. Und daraus lernen wir: Ostern ist nichts für schwache Nerven. Ostern für die ersten Jüngerinnen ein Schock, eine entsetzliche Nachricht, die beinahe im Sande verläuft: „…und hinaus gingen sie, flohen vom Grab. Noch zitterten sie und waren außer sich. Und mit niemand sprachen sie etwas – voll Furcht wie sie waren“ (Mk 16.8). So übersetzt der verstorbene Tübinger Theologe Fridolin Stier sprachmächtig den letzten Satz aus dem ursprünglichen Markusevangelium, den uns das Lektionar vorenthält, den wuchtigen Schlussakkord, mit dem das Evangelium des Markus schrill ausklingt. Ich muss diesen Satz ergänzen; er steht nicht in den offiziellen Lesungsbüchern, wohl aber bei Markus! Warum zensiert die Kirche? Will sie uns schonen? Klar, ein tröstlicherer Schluss, ein wahres Happy End, das in das Osterhalleluja überleitet, wäre uns lieber. Es scheint, als will uns die Kirche mit der Kürzung von Gottes Wort die Osterfreude nicht verderben. Sie schneidet den harten Schlusssatz eines Evangeliums einfach weg. Was bleibt, ist eine Ostersinfonie ohne dissonanten Schlussakkord. Ohne diesen Satz aber hängt das Osterevangelium in der Luft: der Reißaus der Frauen – das muss laut werden. Diese Reaktion ist vielleicht die angemessenste Weise, Ostern zu begehen: die Flucht als Reaktion auf ein unheimliches Geheimnis. Ostern ist nichts für schwache Nerven! Die Frauen waren so tapfer Sie gingen buchstäblich ans Licht, der aufgehenden Sonne entgegen. Sie brachen auf in der Nacht, wo alle Katzen grau sind: „Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?“ (Jes 21,11). In diesen Frühlingstagen nehmen wir sie wahr, die Vögel, die noch im Dunkeln singen und ich erinnere an das große Wort von Tagore: „Der Glaube ist wie ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist.“. Und so, mitten in der Nacht aufgebrochen, werden traurige Frauen als allererste mit dem leeren Grab wie einem großen Fragezeichen und der Zumutung des Engels konfrontiert. Den Trauernden ist zumute, als treibe eine unsichtbare Macht mit ihnen Schabernack, als steige auf dem Friedhof eine Horror-Gruselshow. „Gottesschrecken“, ein Schockerlebnis? Ostern – wie ein später geschmackloser Aprilscherz, der aufgescheuchte Seelen zum Narren hält und deren Gutgläubigkeit testet? Ein Mann in weißen Gewändern, der mit der Trauer mutiger Salbfrauen spielt und sie mit einem Leerraum konfrontiert? Denn das Grab ist ‚unbewohnt‘. Die Frauen greifen ins Leere und haben den Verlust des toten Jesus zu beklagen. Zum zweiten Mal verlieren sie Jesus: am Karfreitag und nun - als Leichnam - erneut.
Ihn selbst sehen wir nicht
Der Friedhof ist ‚eigentlich‘ ein verlässlicher Ort: da regiert der Tod. Wer hier liegt, der bleibt. Würde mir ein Engel auf dem Friedhof begegnen, der das Gegenteil behauptet – auch ich nähme Reißaus. Merkwürdige frohe Botschaft: Wir sehen Fliehenden nach. Was für eine Kirche, die entsetzt und ungläubig auf der stummen Flucht ist vor dem Geheimnis! Eine Kirche, die den Verlust Jesu zu verkraften hat! Denn Jesus ist ja abwesend. Auch hier und jetzt in diesem festlichen Gottesdienst ist seine Anwesenheit nur zu glauben! Wir sehen ihn nicht. Das flackernde Osterfeuer und das unruhige Licht auf der Osterkerze, das lange Hören auf uralte Worte, das verfliegende Wort des Evangeliums – ja, das erleben wir. Ihn selbst aber sahen sie und sehen wir - nicht! Er ist anwesend und abwesend zugleich. Er lässt sich nicht blicken. Er ist nicht zu ‚haben‘. Er bleibt der verborgene Hauptdarsteller. Er löst das Rätsel dieser Nacht nicht auf. ‚Eigentlich‘ ist heute der Glückstag der Kirche und der Welt; eigentlich müsste uns allen heute der Mund vor Staunen sperrangelweit offenstehen. Wir haben doch alle Ostern so nötig! Eigentlich müssten wir uns die Augen reiben und fragen: Ist das Wunder möglich? Meint Gott es wirklich ernst damit, dass Er aufgerichtet ist in unserer Mitte, dass Er nicht tot ist, sondern frei herumläuft und längst unter uns ist? Die ersten aber, die die froheste aller Botschaften erfuhren, sind nicht hingerissen; sie sind panikartig auf dem Rückzug. Das Herz der Frauen ‚brennt‘ nicht (wie später die der beiden Emmausjünger). Ihnen geht es wie manchen von uns. Wir kapieren Ostern nicht! Der, der uns dieses Fest schenkt, entzieht sich auch meinem Verstehen. Auch wenn die Kirche ab heute österliche Festzeit befiehlt, stellt sich die Freude nicht automatisch ein. Die Osterfreude muss sich mühsam aus meiner zweifelnden Seele hervorarbeiten - wie der Tag aus der Nacht, wie die Sonne aus dem Morgennebel. Ja, ich kann den Gottesschrecken dieser Frauen nachvollziehen. Das Wunder des Lebens macht demütig. Haben Sie schon einmal zu Ostern gezittert angesichts des Unverhofften und Abgründigen, dass über uns kommt? Kennt mein Glaube noch den seligen Schock, dass es auf einmal hell wird, dass wir ans Licht kommen, dass uns der Unfassbare nahekommt? Dass wir endlich raus kommen aus dem gesellschaftlichen und vielleicht auch geistlichen Lockdown? Diese Frauen helfen mir, Ostern nicht so cool und abgebrührt und routiniert zu feiern. Auch ich müsste erschrecken – dass ich lebend da bin, dass mein Herz schlägt, auch wenn ich einschlafen werde und morgen früh wieder die kleine Auferstehung feiern darf. Dass diese Welt, in der alles unsicher geworden ist, von ihm gehalten ist. Dass diese Kirche bei all ihren inneren Fragwürdigkeit und Sünden nicht an sich selbst glauben muss, sondern an Ihn? Diese Erschütterung, dass ich jetzt hier sein darf und in jeder Lebenssekunde am seidenen Faden des göttlichen Atems hänge! Der selige Morgenschrecken beim Aufwachen, dass es mich noch gibt - das wäre eine schöne Einübung in die Osterfreude. Dieser seltsame ‚Frauengottesdienst‘ also ist die zutiefst angemessen Weise, Gottes Auferweckungstat zu feiern. Der kopfschüttelnde Blick in die leere Grabhöhle, das antwortlose Spekulieren darüber, was sich da wohl in aller ‚Herrgottsfrühe‘ zugetragen hat, der sperrangelweit offene Mund mit seinem Ah! und Oh! – das gehört zu Ostern genauso wie das spätere jubelnde Halleluja. Alles hat seine Zeit!Mit Ostern werden wir nie fertig! Darum ist der erste Sonntagmorgen der Kirchengeschichte kein Aufbruch zu neuen Ufern, kein wortreiches Erzählen, keine Verfolgungsjagd ihm hinterher, keine sehnsüchtige Rückkehr zum See Genezareth… - eher ein zielloses Gerenne. Gut, dass es diese treue Freundinnen Jesu gibt, die es in aller Herrgottsfrühe als erste zu hören bekommen und denen Hören und Sehen vergeht. Osterzeuginnen, die nicht ‚gut drauf‘ sind und die nicht unbedacht einstimmen in den Chor der Halleluja-Sänger: Frauen, die das Unsagbare erleben und eben (noch) nicht vor Freude außer Rand und Band geraten wie Kinder bei der Weihnachtsbescherung; Frauen, die sich keinen flotten Reim machen auf das Rätsel des leeren Grabes und denen die Kurzpredigt des Engels zu hoch ist. Es verschlägt ihnen angesichts der Grabesleere und der Engels-Kurzpredigt die Sprache; und darum können sie diese Osterpredigt nicht weitergeben. Überlassen sie uns diese Aufgabe? Gerade das Atemlose des Abschlusses des Markusevangeliums, das bestürzende Ende, ist vielleicht die einzig stimmige Reaktion auf den heißen Kern des Glaubens. Diese wunderbaren Frauen am Grab stehen dafür, dass Ostern schön anstrengend ist, schön mühsam, schön furchterregend – und vielleicht erst später beglückend und erleuchtend. Die nackte Wahrheit des ‚Er ist nicht hier!‘, das Gerücht, dass dieser Tote lebt, ist eben nicht leicht zu verkraften. Ostern lös in der Kirche eine tiefe Unruhe aus! Dieses Beben vor dem großen Gott und seiner Initiative - und Jesus, der immer einen Vorsprung hat vor uns – all das Unsagbare sollte die Kirche bis heute durchzittern. Etwas von dieser Sprachlosigkeit und diesem ‚seligen Schrecken‘ darf diesen schönsten Gottesdienst im Jahr zwischen Nacht und Tag prägen - auch wenn unsere Osterlieder beredsamer, jubelnder, optimistischer sind. Ostern ist und bleibt die unglaublichste Geschichte von der Welt. Immer wieder neu müssen wir sie uns sagen lassen!
Flucht in Seine Arme
Vermutlich sind wir beunruhigt durch ganz andere Schrecken, die schwere Krise dieser sterblichen Welt, die uns seit mehr als 14 Monaten unter permanenter Anspannung hält. Ja, wir mussten lernen, mit diesem Unvorhersehbaren, dem Unsäglichen umgehen zu lernen. Manche hielten den Kirchen vor, sie haben angesichts der Pandemie-Krise zu sehr geschwiegen - vielleicht auch, weil sich auch dieses Geschehen unserem Verstehen entzog…? Oh ja, es gibt Ereignisse zwischen Himmel und Erde, die verschlagen mir die Sprache und zwingen mich, eine neue Sprache zu lernen! Der Weg in die Osterfreude, ins Osterlachen ist weit! Jesus, den Auferstanden, können wir nicht herbeizwingen. Wenn er kommt, dann stellt er sich aus freien Stücken ein, dann werden wir, die wir vor Angst beinahe vergehen und vor ihm fliehen, erst recht in seine Arme laufen! Dann werden wir nicht leer ausgehen, dann löst er mir die Zunge, dann gibt es gleich unter dem zerbrechlichen Zeichen des eucharistischen Osterbrotes mit ihm ein unverhofftes Wiedersehen. Uns wird heute mehr und Schöneres gesagt, als wir momentan verkraften können. Er kommt uns näher, als wir ahnen - der unerwartete Gast dieser Nacht, dieses Morgens. Ich lade uns nun ein, vielleicht leise und stockend Halleluja zu singen, womöglich atemlos, wie auf der Flucht. Erich Fried sagt es so: „Die Wahrheit/ vor der wir flohen/ mit trippelnden Schritten/ holt uns ein/ mit einem einzigen Tritt.“ Viral verbreitet sich als WhatsApp in diesen Tagen ein Foto. Es zeigt ein Grab nahe der Stadtmauer von Jerusalem, es steht offen, der Rollstein kam ins Rollen: Augenzwinkernd wird das Foto so kommentiert: „Das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert“. Er ist frei, er darf die für uns wichtigen Abstandsregeln verletzen, er darf uns berühren und anatmen in dieser Stunde. Er allein. Indem wir von Ostern überwältigt werden und wie die Frauen vom Grab wegfliehen, laufen wir Ihm direkt in seine Arme. Amen
Kurt Josef Wecker
Aufzeichnung der Osternachtfeier am 03.04.2021 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Durch anklicken des Links kann das Bild geöffnet werden. ( 7. Bild, obere Reihe)
Auferstehung „nach hinten“ Gottes leise Nähe feiern in einer Welt, die auf Abstand geht
Geistliche Betrachtung zum Osterbild von Meister Francke (nach 1424, Hamburg)
von Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Das leere Grab, die leeren Kirchen
Ostern ist anders. Jesus hinterlässt eine spürbare Leere. Die Erfahrung der Leere gehört zum Glauben. Auch das Allerheiligste im Tempel in Jerusalem war ein Leerraum. Die Juden haben diese Leere ausgehalten und der Hohepriester hat sich einmal im Jahr dieser Leere gestellt. Die Erfahrung der Leere haben auch wir gemacht: leere Kirchen, leer gewordene Terminkalender, leere Straßen und Geschäfte, auch bei vielen unter uns: leere, ausgebrannte Herzen. Vor allem aber: Leere Plätze unersetzbarer Menschen, die uns durch den Tod genommen wurden. Und die Frage: Wohin ist - ER? Hinterlässt er, indem er aus dem Grab steigt, ein Vakuum? Hat er diese Welt sich selbst überlassen? Geht er auf Distanz, auf ‚Mindestabstand‘ zu uns? Meidet er die Begegnung? Ja, wir vermissen das Volle, nicht nur die vollen Kirchen. Wir vermissen, wie es ‚vorher‘ war: die Fülle des Lebens, echte leibhaftige ‚Präsenz’, unbefangene Nähe zum anderen. Und Er? Verschwindet Er einfach und lässt uns mit unsichtbaren Mächten allein, die der ganzen Welt gefährlich werden? Wie Ostern feiern, ein weiteres Jahr in schwerer Zeit? Ostern macht es uns nicht leicht; wir feiern angefochten, mit Ungewissheit – mit Furcht und Zittern. Entsetzen und ‚ungläubiges Staunen‘ – das sind die ersten ‚klassischen‘ Reaktionen auf das Unfassbare. Geben wir es zu: Wir werden vom Osterwunder jäh erschreckt. Doch nur, wenn es mir unter die Haut geht, kommt es an. Zum Schrecken der Pandemie gesellt sich der Schrecken über das Schönste, was Jesus je widerfuhr und was auch uns bevorsteht. Die Furcht der Wächter im Matthäusevangelium und die Furcht der Frauen im Markusevangelium - so ‚natürlich‘ reagieren Menschen auf Gottes verborgenes Handeln. Nach Hallelujajubel ist den Friedhofsbesucherinnen in der ‚Herrgottsfrühe‘ des Ostermorgens nicht zumute – und das nicht etwa, weil ihnen das Jubilieren untersagt wäre und sie singend bedenkliche Aerosolwolken ausstoßen könnten.... Wer so erschrocken und bekümmert ist wie die Salbfrauen am Ostermorgen oder wer bitterlich weint wie Maria Magdalena, der kann einfach nicht singen. Das Grab Jesu, so leer es auch ist - es tröstet nicht. Das leere Grab allein ist ein dunkler Leerraum, eine Botschaft der Trostlosigkeit. Es ruft nach mehr, nach Aufklärung, nach einer Fortsetzungsgeschichte!
Das müssen wir aushalten: Zunächst lässt uns Ostern ratlos zurück, denn Jesus verschwindet. Und dieser Abgang Christi kommt ins Bild. Das diesjährige Osterbild ist ein schönes norddeutsches Beispiel, wie man vor 1430 das Unmögliche wagte und das uns entzogene Ereignis der Auferstehung Christi ins Bild setzte. Jedes Osterbild ist nur ein Versuch, nahe am Scheitern. Wie kann man auch die Lichtsekunde von Ostern in ein Gemälde bannen? Das Gemälde von diesem unfassbar großen Geschehen ist eher klein: nur 99 x 89 cm. Und auch das darauf dargestellte Geschehen entfaltet sich auf engem Raum. Das, was uns alle Evangelien vorenthalten, wird ins Bild gebracht; die Vorstellungskraft des Künstlers füllt eine biblische Leerstelle. Die Scheu des frühen Mittelalters vor der Darstellung des ‚unvorstellbaren‘ Auferstehungsaugenblicks ist abgelegt. Verborgen bleibt der, der uns das Geschenk dieser Bildpredigt machte. Wer ist der Künstler, der will, dass wir „im Bilde’ sind – dicht dabei in der furchterregenden „Ostersekunde“ –, bevor der Auferstandene „das Weite sucht“? Dieses kühne Osterbild schuf derselbe Meister, der uns auch bereits in der Weihnachtsbildbetrachtung 2020 begegnet ist: Meister Francke, geboren um 1380 in Hamburg, tätig bis nach 1430, schuf das Bild wohl 1425/26 als Teil des „Englandfahrer“-Flügelaltars („Thomas-Altar“). Bestimmt war es für die Dominikanerkirche St. Johannis in Hamburg. Dort war es in der Kapelle der Englandfahrer aufgestellt und wurde im 18. Jahrhundert entfernt. Seit 1898 findet sich der Wandelaltar in seinen erhaltenen Teilen in der Hamburger Kunsthalle. Das Leben von Meister Francke bleibt im Dunkeln. Stammen seine Vorfahren aus Geldern? War Francke ein Ordensmann (Frater = Bruder), ein Weltkleriker? Hat er in Köln oder Paris studiert? Manche glauben, er sei als Frater Franco Zutphanicus, als „schwarzer Mönch“, in das Hamburger Dominikanerkloster St. Johannis eingetreten und dort als Maler tätig gewesen. Dann wäre er die deutsche Entsprechung zu Fra Angelico, dem seliggesprochenen florentinischen Dominikaner.
Das müssen wir aushalten: Zunächst lässt uns Ostern ratlos zurück, denn Jesus verschwindet. Und dieser Abgang Christi kommt ins Bild. Das diesjährige Osterbild ist ein schönes norddeutsches Beispiel, wie man vor 1430 das Unmögliche wagte und das uns entzogene Ereignis der Auferstehung Christi ins Bild setzte. Jedes Osterbild ist nur ein Versuch, nahe am Scheitern. Wie kann man auch die Lichtsekunde von Ostern in ein Gemälde bannen? Das Gemälde von diesem unfassbar großen Geschehen ist eher klein: nur 99 x 89 cm. Und auch das darauf dargestellte Geschehen entfaltet sich auf engem Raum. Das, was uns alle Evangelien vorenthalten, wird ins Bild gebracht; die Vorstellungskraft des Künstlers füllt eine biblische Leerstelle. Die Scheu des frühen Mittelalters vor der Darstellung des ‚unvorstellbaren‘ Auferstehungsaugenblicks ist abgelegt. Verborgen bleibt der, der uns das Geschenk dieser Bildpredigt machte. Wer ist der Künstler, der will, dass wir „im Bilde’ sind – dicht dabei in der furchterregenden „Ostersekunde“ –, bevor der Auferstandene „das Weite sucht“? Dieses kühne Osterbild schuf derselbe Meister, der uns auch bereits in der Weihnachtsbildbetrachtung 2020 begegnet ist: Meister Francke, geboren um 1380 in Hamburg, tätig bis nach 1430, schuf das Bild wohl 1425/26 als Teil des „Englandfahrer“-Flügelaltars („Thomas-Altar“). Bestimmt war es für die Dominikanerkirche St. Johannis in Hamburg. Dort war es in der Kapelle der Englandfahrer aufgestellt und wurde im 18. Jahrhundert entfernt. Seit 1898 findet sich der Wandelaltar in seinen erhaltenen Teilen in der Hamburger Kunsthalle. Das Leben von Meister Francke bleibt im Dunkeln. Stammen seine Vorfahren aus Geldern? War Francke ein Ordensmann (Frater = Bruder), ein Weltkleriker? Hat er in Köln oder Paris studiert? Manche glauben, er sei als Frater Franco Zutphanicus, als „schwarzer Mönch“, in das Hamburger Dominikanerkloster St. Johannis eingetreten und dort als Maler tätig gewesen. Dann wäre er die deutsche Entsprechung zu Fra Angelico, dem seliggesprochenen florentinischen Dominikaner.
Christus-eine Entzugserscheinung?
Die Fantasie Meister Franckes setzt ein seltsames Osterbild ins Werk. Wir malen uns den Ostermorgen wohl anders aus. Meister Francke ist so frei, das Auferstehungsereignis in ein ungewohntes Licht zu rücken. Er zeigt uns kein Grabmonument, keine Felsenhöhle; ein Sarkophag (deutsch: ein „Fleischfresser“), ein Kastengrab ist geöffnet. Wir blicken wie in ein dunkles Loch. Was ist hier passiert? Wer hat an diesem ver-rückten Fest, das wir „Ostern“ nennen, den Deckel so „ordentlich“ verrückt und wirkungsvoll quer auf den Unterbau des Sarkophags gelegt? Ein Engel? Wir sehen keinen Engel. Wo bleiben die Engel des Ostermorgens? Kein Engel ist zur Stelle, der uns aufklärt und unmittelbar Mut macht. Hat der Auferstandene den Deckel selbst so hingelegt? Die Platte ist rechtwinklig verschoben. Zugleich bildet die Platte zusammen mit dem schräg gestellten Sarkophag ein T-förmiges Kreuz. Ein Stück Leichentuch liegt auf dem Sargdeckel. Im Hintergrund erkennen wir eine felsige, menschenleere Landschaft – ein Kontrast zum geheimnisvollen Goldgrund, der die hügelige Weite umfängt. Von Engeln oder den ‚Salbfrauen‘, die sich (nach Mk 16,1 und Mt 28,1) dem Geschehen nähern, gibt es keine Spur. Und das leere Grab liegt mächtig zwischen uns und Ihm.
Wir sehen eine Momentaufnahme. Christus ist gleichsam eine „Entzugs-Erscheinung“. Er tritt aus Grab und Bild. Er geht weg - so, als wolle er auch von uns nicht gesehen werden. Und die Pointe ist: Wir Betrachter sind die einzigen, die das Geschehen mitbekommen. Denn die, die im Bild sind und eigentlich an diesem „Tatort“ wachen müssten, schlafen oder nehmen nichts wahr. Jesus steigt heimlich nach hinten aus dem Grab, fast so, als wolle er von der wenig bewachten Seite aus fliehen und sich aus dem Bild stehlen – „wie ein Dieb in der Nacht“ (Mt 24,43: Lk 12,39; 1 Thess 5,2.4; Offb 3,3 und 16,15). So deutet 1932 der Kunstwissenschaftler Hubert Schrade und schlägt eine Brücke vom sich heimlich entfernenden Auferstandenen zum wiederkehrenden Weltenrichter Christus, der diese Welt und mich wie ein Dieb in der Nacht überraschen wird. Es scheint, als wolle Jesus nicht gesehen werden. Er geht in ein ‚Jenseits‘ und kommt, wenn niemand es für möglich hält. Christus bewegt sich nicht mühelos; er entschwebt nicht mit einem leichten Geistleib nach oben. Er überschreitet die Schwelle des Todes: Erdenschwere, Körperlichkeit, Kraftanstrengung; keine Spur von der „Agilitas“, von der Leichtigkeit, die Theologen dem Auferstandenen zuschreiben. Diesem Leib Christi ist nicht anzusehen, dass sie kraft der Auferweckung eine Verwandlung und Verklärung erfuhr. Wir haben die späteren, vor allem italienischen Bilder vor Augen, auf denen Christus als Ostersieger über dem Grab souverän schwebt und sich frontal und segnend den Blicken der Betrachter darbietet. Nichts von diesen triumphalen Gebärden hier! Meister Francke verzichtet in drastischer Realistik auf alles Übernatürliche. Der Sieger über den Tod ist kein Athlet, kein Apoll, kein messianischer Sieger, sondern der schwache, beinahe noch leidende Jesus. Der Mensch Gewordene hat einen zerbrechlichen Leib wie du und ich; er ist ohne sinnliche Schönheit. Aus eigener Kraft verlässt er in mühevoller Kletteraktion die Todeszone. Das rechte Bein ist noch im Grab. Noch ist er nicht ganz aus dem schwarzen Vakuum. Er „schwebt nicht über den Dingen“. Der Mantel ist um seine Hüften geschlagen. Rücken und Arme sind unbedeckt. So, als sei er eben aus dem Todesschlaf erwacht, klettert er gebückt heraus; still und heimlich, als wolle er die Grabwächter überlisten. Der Auferstandene steigt über die hohe Rückwand des Sarkophags und stützt sich dabei mit einer seltsamen Drehbewegung des rechten Arms mit der Hand auf der Kante ab. Er blickt dabei niemanden an. Er zeigt sich uns nicht. Die Wunden Jesu kann man wegen der Körperdrehung nicht erkennen. Wir sehen kaum das teilbedeckte Gesicht des Herrn, der unspektakulär „nach hinten“ aufersteht.
Das Wunder des Ostermorgens wird von Meister Francke (angeregt von Mt 27, 64-66; 28,4) gemalt als Überlistung der Grabwächter, ja, als Überlistung der Welt, der das Mysterium von Ostern verborgen bleibt und die Ihn nicht festhalten kann. Wir Betrachter, denen Jesu „Ausbruch“ nicht entgeht, wollen den Herrn vielleicht frontal sehen, doch wir nehmen ihn kaum im Profil wahr und kommen nicht in den Genuss seines Augen-Blicks, seines Segens. Seitlich entkommt er dem Grab, ohne große Gebärde. Gleich ist er weg, hineingetaucht in den Goldhintergrund, in das Gold des Himmels, den „Raum“ des verborgenen Vaters, der den Sohn auferweckt. – So sieht – trotz des goldenen Scheibennimbus mit der Inschrift „Resurrectio Domini“ und der himmelwärts gerichteten Fahnenstange in der Linken – kein Ostersieger aus. Die Aufwärtsbewegung ist nur angedeutet. Das Grab wird leer, doch kein Held erwacht. Würden wir nur diese gar nicht überirdische Jesusgestalt sehen und alles andere abdecken, dann wirkt dieses Auferstehungsbild beinahe wie die letzte Sequenz der Passion Christi. Der Schmerzensmann, der das Opfer vollbracht hat, entkommt der Todeswelt. Ostern ist ein Kraftakt. So gar nicht wundervoll wendet der Auferweckt-Gekreuzigte auch uns seinen Rücken zu. Das Göttliche des Ostermorgens ist in diesem Bild vermenschlicht. Und doch ist Jesus für uns Betrachter die Zentralfigur, unübersehbar gegenwärtig, alle überragend, die Weltmächte überlistend. Immerhin - die an die Passion und den Erlösertod des Herrn gemahnende leuchtende Königsfarbe Rot des blaugefütterten Mantels mit den fliegenden Mantelenden und die im Osterwind flatternde Siegesfahne, das Stabkreuz mit den beiden Wimpeln, verleihen dem Gemälde Bewegung. Wir ahnen den Geisteswind, der von Ostern her durch die Welt weht.
Er sucht das Weite – Er sucht meine Nähe
Meister Franckes Deutung ist kein triumphalistisches Osterbild. Es passt zu dieser Weltzeit, zu unserem Empfinden, das irgendwie einen „Knacks“ bekommen hat. Allein wir Betrachter sind Zeugen dieses Ereignisses. Wir sehen zu, wie Er „sang und klanglos“, ohne Segensgestus und Zuwendung in diese „andere Welt“ seiner Himmelfahrt hineingeht. Oder soll Er gehen und uns in Ruhe lassen? Er entschwindet in den Hintergrund. Nehme ich Gott wie ein „Hintergrundgeräusch“ meines Lebens wahr? Jesus erfüllt nicht mein Schaubedürfnis, meine fromme Neugier. Er entzieht sich meinem Zugriff und ist doch real und nicht nur virtuell und digital präsent. Er imponiert nicht durch effektvolle Selbstdarstellung. Ein fremdes Ostern damals wie heute! Wir sehnen uns nach spürbarer Zuwendung, dem heilsamen Blickkontakt. Doch ER ist nicht immer der Entgegenkommende, er wirft Fragen auf, mutet uns die Rätsel unserer Endlichkeit zu. Ostern ist bei aller Halleluja-Freude auch der Tag, an dem der Auferweckt-Gekreuzigte auf dem Rückweg zum Vater ist und sich dem Zugriff der Welt und der Kirche entwindet. Ja, am ersten Sonntag der Kirchengeschichte steht der Blick in ein schwarzes Loch. Leidet Kirche unter dieser Entzugserscheinung? Wünschen wir uns eine Osterscheinung? Vermissen wir den, der uns mit Leben anhaucht, der uns heilsam ‚ansteckt‘ mit der Gabe des ewigen Lebens? Ostern ist ein sehr leises Geschehen. Die Überwindung des Todes ist kein Zauberkunststück Gottes, sondern Seine mühevolle „Sonntagsarbeit“, Sein unvorstellbarer Kraft- und Liebesakt. Hoffentlich ist die Kirche mehr als Wächterin der „Gruft eines toten Gottes“ (Friedrich Nietzsche)! Du, fremder Jesus bist - ‚mein Schatz‘! Heute will er entdeckt werden. Er kennt keinen Sicherheitsabstand. Auf leisen Sohlen tritt er lautlos – vielleicht „von hinten“ -, so wie es den Emmausjüngern erging, in unsere Nähe.
Ein gesegnetes Osterfest Euch und Ihnen!
Kurt Josef Wecker, Pfr. /Nideggen-Heimbach
Die Karfreitagsliturgie aus der St. Johannes Baptistkirche in Nideggen am 02.04.2021.
Hl. Messe zu Palmsonntag am 28.03.2021 aus der Salvatorkirche Heimbach. Durch anklicken des Links, können sie die hl. Messe mitfeiern.
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1dJPAhTVI&ab_channel=PfarreiSt.ClemensChristusSalvatorhttps://
Der Gottesdienst zum 5. Fastensonntag vom 21.03.2021 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Hl. Messe zum Josefstag aus der Pfarrkirche St.Dionysius Vlatten mit Pfarrer Kurt Josef Wecker.
Impuls zum fünften Fastensonntag 2021, dem „Passionssonntag“, dem Sonntag „Judika“
Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr 5,7-9)
Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden.
Jesu Verzicht auf die Geste der Coolness
Es ist seit dem 20. März 2021 Frühling geworden, mitten in der Passionszeit. Zeit der Tag- und Nachgleiche, das Jahr kippt zugunsten des Lichts. Es ist die Zeit des wachsenden Lichts. Das Helle nimmt nun Überhand. Ein Hoffnungstag. Und zugleich ist heute Passionssonntag. Ist das Frühlingserwachen ein guter Auftakt für die Schlussetappe der Fastenzeit? Da prallen zwei Empfindungen aufeinander. Der 5. Fastensonntag ist in vielen Gemeinden Zeit der Kreuzverhüllung. Wir verbergen das, was schwer zum Mit-Ansehen ist. Wir decken das zentrale Zeichen des Glaubens, das Kreuz, ab und üben uns in Augenaskese, damit uns das vermisste Zeichen als Heilssymbol am Karfreitag wieder neu ins Auge fällt. Denn mit diesen beiden Wochen, die nun folgen – der Passions- und der Karwoche – nimmt im Gedenken des Kirchenjahres ein blutiges Geschehen seinen unerbittlichen Verlauf. Mit den Zeilen aus dem Hebräerbrief werden wir quasi in den Garten Gethsemane geführt, in das Tal der Tränen, in eine Landschaft aus Schreien - und sehen den weinenden Jesus. Das müssen wir aushalten: Jesus „ist nicht gut drauf“. Dieser Eine ist meilenweit entfernt vom strahlenden Göttertyp Apollo oder dem lächelnden Buddha; kein hilfreicher Engel rettet und trocknet seine Tränen, kein himmlisches Rettungskommando, keine mitfühlende Kirche. verhindern den Karfreitag. Eigentlich ist Jesus ein Antiheld, der die Fassung verliert, der auch seine Angst, seine Todesangst nicht beherrschen kann. Ein seltsamer Salvator: berührbar, seine Lebensnot herausschreiend, tödlich verletzbar. Gibt es nicht ein Tränenverbot für ‚harte Männer‘? „Keep-smiling!“. Reiß dich zusammen! Früher wurden Jungen dazu erzogen, Härte zu zeigen, sich die Tränen zu verkneifen, vielleicht sich einen Panzer der Unberührbarkeit und Unbesiegbarkeit anzulegen, Überlegenheit zu demonstrieren, sich nichts gefallen zu lassen, möglichst immer ganz oben sein, auf der Siegerstraße. Coolness ist angesagt - die Kunst, Schmerzgefühle nicht zu zeigen, und Emotionen lässig zu überspielen. Coolness, das ist die Lebenskunst, nicht zu zeigen, was in einem los ist, eine gleichgültige Unberührbarkeit vorzugeben und damit auch eine gewisse Kälte der Überlegenheit, Distanz und Selbstbeherrschung auszustrahlen. Von Cäsar, dessen Ermordung an den Iden des Märzes (dem 15.3.44 v. Chr.) geschah, hieß es: „Er kam, sah und siegte.“ Von Jesus könnte es heißen: „Er kam, lernte und litt. Und am Ende verstummte er nicht, sondern betete. Sehen so die Siegertypen aus, die sich Kirche und Welt ersehnen? Jesus ist ein uncooler Typ. Er ist ‚überwältigt‘. Er widerspricht den Anforderungsprofilen an Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Politik (und Kirche?). Da lautet das Dogma: Sei immer gut drauf! Zeige nie dein Innenleben. Bleibe Fassade, lass alles abprallen an deiner Oberfläche, die nichts preisgibt. Und wenn dir zum Weinen zumute ist, dann heule dich gefälligst zu Hause aus, verdirb uns mit deiner Schwäche nicht die Laune und trage in der Öffentlichkeit eine coole reflektierende Sonnenbrille, mit der du das verhüllst, was wirklich in dir ‚los‘ ist. Denn auch der medizinische Mund-Nasen-Schutz gibt den Blick auf verweinte Augen preis… Und nun stehen wir in diesen Wochen der Passionszeit auf der Seite des Verlierers. Wir müssen dem Anblick eines weinenden Mannes standhalten. Ist Er uns peinlich? Wir sehen die Tränen Jesu, ahnen die tiefe Sympathie, das Mitleid dieses verletzlichen Hohepriesters. Nie rückt uns Gott so nahe als da, wo er uns im weinenden und mitleidenden Christus sein Innenleben freilegt. Diesem tränenreichen Jesus folgen wir stolpernd auf seinem dornenreichen Kreuzweg. Und es wird Gottes Entscheidung sein, dass er den Gescheiterten zum Sieger, den schreienden und weinenden Jesus zum Christus erklärt und in der Auferweckung von den Toten bestätigt. Es wird Zeit, dass dieser Welt, die so cool wirken will und zugleich so verletzlich ist, das leidensfähige Herz Jesu entgegengehalten wird, damit wir von der eiskalten Coolness geheilt werden. Viele fragen in dieser Krise: Sind wir noch ‚Herr‘ der Lage. Viele stöhnen, schreien oder leiden ganz still und einsam. Die Illusion einer schönen neuen Welt der permanenten Unterhaltung und des Sich-zu-Tode-Amüsierens ist zerstoben. Nicht erst die Passionszeit 2021 zerstört diese Illusion, dass wir in einer Hochglanz-Welt leben. Der überwältigte Jesus, der an die Grenze geratene Gottessohn, sein uncooler Weg zum Kreuz, sind ein Protest gegen das Weinverbot, gegen die Versuchung, mit lauten Aktionen, Methoden und Techniken das Leiden zu verdrängen oder in den Griff zu bekommen Die Frühlingssonne taue eine kalte Welt auf. Weinender Jesus, bewahre uns davor, unberührbar und kalt zu werden, unerreichbar für fremde Not!
Kurt Josef Wecker, Pfr Nideggen/Heimbach
Impuls zum 4. Fastensonntag 2021
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus:
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
so muss der Menschensohn erhöht werden,
damit jeder, der glaubt,
in ihm ewiges Leben hat.
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern ewiges Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet;
wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,
weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes
geglaubt hat.
Denn darin besteht das Gericht:
Das Licht kam in die Welt,
doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht;
denn ihre Taten waren böse.
Jeder, der Böses tut,
hasst das Licht
und kommt nicht zum Licht,
damit seine Taten nicht aufgedeckt werden.
Wer aber die Wahrheit tut,
kommt zum Licht,
damit offenbar wird,
dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
In diesen Tagen beschäftigt mich der Tod. Das Leid. Das Warum.
Warum so viel Leid? Warum sterben (zu) junge Menschen, wo sie für uns einen so wichtigen Platz im Leben einnahmen und wir nicht verstehen, dass sie jetzt nicht mehr da sind? Warum sterben alte Menschen in völliger Einsamkeit, sei es pandemiebedingt oder manchmal auch durch eigene Entscheidung? Warum lässt ein liebender Gott dies zu?
Im Evangelium ist von dieser Zusage die Rede: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab“. Dass Er uns liebt, steht nicht zur Diskussion. Dann aber die Spannung. Wer nicht an diese Zusage glaubt, ist schon gerichtet. Ist Er doch ein richtender Gott, der von uns eine Entscheidung verlangt? Liebe unter Bedingungen, also?
In meiner Heimat-Gemeinde starb vor kurzem der leitende Pfarrer. Er war nicht alt, sein Tod kam unerwartet! An Gottes Botschaft von Liebe und Licht hat er natürlich geglaubt. Auch er hat die Frage nach dem Leid und dem Tod gestellt. Eine klare Antwort gibt die Bibel nicht. Tod und Leid gehören zum irdischen Leben dazu. Sie sind oft mit Schuld behaftet; auch die Schuld, die am Anfang der Schöpfung steht. Ein schwieriges Thema, welches noch mehr Fragen aufwirft. Vielmehr sollten wir fragen nach dem Wie. Wie will ich leben? Was kann ich der Liebe Gottes entgegenbringen? Da nimmt dieser Pfarrer die Worte des jüdischen Schriftstellers Elie Wiesel in den Mund: „Wenn ihr nicht wisst, ob euer Tun richtig ist, dann fragt euch, ob ihr dadurch den Menschen näher kommt. Ist das nicht der Fall, dann wechselt schleunigst die Richtung; denn was euch den Menschen nicht näher bringt, entfernt euch von Gott“.
Diese Worte enthalten der ganze Zuspruch Gottes. Er liebt uns bedingungslos, aber nicht ohne unsere Freiheit, eine Richtung zu wählen. Der Diakon in meiner Heimatgemeinde – der auch unser Firmpate ist - sprach über den Tod dieses geliebten Menschen: „Ich weiß, dass ein Mensch nie tiefer fallen kann als in der Hand Gottes“. Auf Gottes Liebe ist Verlass, auf Ihn dürfen wir vertrauen! Diesen hoffnungsvollen Ausblick auf Ostern wünsche ich ihnen und euch allen.
Für das Pastoralteam: Gemeindereferentin, Janny Broekhuizen
Hl. Messe zum 3.Fastensonntag am 07.03.2020 aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist aus Nideggen mit Pfarrer Kurt Josef Wecker.
Textimpulse zum 3. Fastensonntag
Das Gespräch am Jakobsbrunnen (Joh. 4,5ff)
So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief; woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen!
Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her! Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. … Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. … Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und kehrte in ihre Stadt zurück. … Viele Samariter kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.
Liebe Besucher*innen,
Typisches Missverständnis könnte ich bei dieser Begegnung sagen. Die Frau am Jakobsbrunnen will oder sie kann am Anfang ihres Gespräches Jesus nicht recht verstehen. Ein Jude vermied damals den Kontakt zu Samaritern. Umso erstaunlicher ist die Bitte Jesu. Erfrischendes, kühles Wasser aus einem Brunnen zu trinken, das ist auch heute an heißen Tagen wie lebendiges Wasser. Das vordergründige Verständnis liegt erst einmal nah. Warum dann wie ein Prophet in die Tiefe schauen? Oberflächlichkeit, kaum Differenzierung in Denken und Handeln, all das führt immer wieder zu Missverständnissen, wie sie uns hier in der Geschichte am Jakobsbrunnen begegnen.
Die Frau aber lässt sich auf den Fremden ein und sie weicht ihrer eigenen Lebensgeschichte nicht aus. Sie ist offen und steht zu ihrem Leben. So wird aus einem Missverständnis tiefes Verstehen und letztlich Erkennen. Jesus eröffnet ihr eine Wirklichkeit, die über ihr Leben hinausweist. Ihre Hoffnung auf das Kommen des Messias erfüllt sich, so dass sie anderen von ihrer Begegnung, die ihr Leben verändert, berichtet.
Dabei hatte das alleinige Zeugnis einer Frau zur damaligen Zeit keinen Wert. Dennoch vertraut Jesus in den biblischen Erzählungen seine Botschaft immer wieder Frauen an, selbst am höchsten Festtag unseres Kirchenjahres: Ostern; im damaligen Umfeld ein „No go
Jesus schenkt der Frau und auch uns heute einen neuen Blick.
Ich wünsche Ihnen, den Perspektivwechsel in Ihrem Alltag zu wagen,
über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken, das Fremde, Unvertraute, sogar die Krise als Chance zu begreifen, sich immer wieder neu auszurichten. Ihnen allen eine besinnliche Woche
Werner Conen, Pastoralreferent
Die Hl. Messe zum 2. Fastensonntag am 28.02.2021 aus der Salvatorkirche in Heimbach zum mitfeiern erfolgt durch anklicken dieses Links:
https://youtu.be/ILguiNRuorwhttps://
Textimpulse zum 2. Fastensonntag
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus ( Mk 9, 2 - 10)
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein.Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß,so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elija und mit ihm Mose,und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen,eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte;denn sie waren vor Furcht ganz benommen .Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie,und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.Als sie dann um sich blickten,sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus.Während sie den Berg hinabstiegen,verbot er ihnen, irgend jemand zu erzählen, was sie gesehen hatten,bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei.Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei:von den Toten auferstehen.
Gottesdienst zum ersten Fastensonntag am 21.02.2021 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen mit Pfarrer Kurt Josef Wecker.
Erster Fastensonntag„
In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt.Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach:
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ (Mk 1, 12-15)
Ja, getrieben sind auch wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie-getrieben in die Wüste der Einsamkeit, der Begrenzungen und des Verzichts.
Ja, da ist die Versuchungnicht der Vernunft zu folgen und ständig Rücksicht zu nehmen auf den Nächsten. Ja, ausgeliefert fühlen wir uns in diesen Wochen des Lockdowns –ausgeliefert den Weisungen und Regeln.
Dann diese Worte: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.“Geben wir seinen Worteneine Chance–auch in dieser Zeit!
(Susanne Jansen)
Die Wüste (aus: Fastenkalender 2020, Paul Weismantel)
Wüste, Ort der Einsamkeit, des bitteren Ausgeliefert sein,der völligen Preisgegebenheit.
Wüste, Ort der Versuchung, der teuflischen Heimtücke,der hinterlistigen Täuschung.
Wüste, Ort der Auseinandersetzung, der klaren Abgrenzung,der inneren Bekehrung.
Wüste, Ort der Abwehr, der biblischen Widerlegung,der betenden Hingabe.Wüste,Ort der Erprobung, der krassen Gegensätze,der Gottesoffenbarung.
Wüste, Ort der Klärung, der geistlichen Unterscheidung,der persönlichen Entscheidung.
Hoffentlich (aus: Fastenkalender 2020, Paul Weismantel)
Hoffentlich
bin ich so gefestigt, mich klar und deutlich zu entscheiden, was ich jetzt zu tun oder besser zu lassen habe.
Hoffentlich
bin ich so aufgeschlossen,mich mit neuen Ideen undGedanken auseinanderzu setzen, die weiterführen.
Hoffentlich
bin ich so konsequent,mich nicht von Tagesmeinungen leiten zu lassen, sondern bei meiner Überzeugung zu bleiben.
Hoffentlich
bin ich so empfänglich,auf Gottes leise Stimme zu hören und ihrer Weisung
Gottesdienst vom 14.02.2021 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker aus der Kirche St. Johannes Baptist in Nideggen.
Gottesdienst zum Sebastianusfest der Nideggener Schützenbruderschaft am 23.01.2021.
Die Hl. Messe von Sonntag, den 17.01.20221 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Das Festhochamt am Sonntag, den 10.01.2021 aus der Salvator Kirche in Heimbach
ist zu sehen und mitfeiern unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=f73sXqO5W9c&ab_channel=PfarreiSt.ClemensChristusSalvator
Die Weihnachtsmesse vom 27.12.2020 aus der St.Johannes Baptist Kirche in Nideggen
Weihnachtsgottesdienst am 26.12.2020 aus der Salvatorkirche mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Segensandacht zu Heiligabend 2020 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker in der Pfarrkirche
St. Hubertus Schmidt
Durch anklicken des Link öffnet sich das Video.
Der Gottesdienst zum 4. Advent am 20.12.2020 aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Meister Francke, Weihnacht Thomas-Altar (1425/26, Hamburg) Vulnerabel – der verletzliche nackte Gott
Geistliche Betrachtung zum Weihnachtsbild
von Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Befremdliche Weihnacht: Sieht so Gottes Allmacht aus?
„Entdecke mich!“ So werden wir im Juni 2021 nach Aachen zur Heiligtumsfahrt eingeladen. Sucht und entdeckt den in eurem Leben versteckten Gott! Entdeckt den, der sich in unser unübersichtlich und krank gewordenen Welt so tief verbirgt! Die „Windeln Jesu“ (bzw. die Hosen/ „Beinlinge“ des hl. Josef) gehören zu den großen Heiligtümern Aachens. Aber - wo sind auf diesem fast sechshundert Jahre alten Weihnachtsbild diese Windeln, die für die Hirten zum Erkennungszeichen wurden? Gottes Sohn wir uns nackt und bloß präsentiert. Warum wird der nackte Jesus nicht zumindest in das ‚Kleid Marias’ gehüllt? Wird das Kind noch lange in dieser Notlage bleiben? Maria bleibt in ‚liebevoller Distanz‘. Sie vermeidet den direkten Kontakt, jede mütterliche Berührung. Wir fragen ungeduldig: Wann endlich wärmt sie den stillgelegten Jesus, erweist ihm den Gottes-Dienst der Liebe, das Werk der Barmherzigkeit? Der heilige Martin tat dies am frierenden Bettler. Wärmt die Anbetung Marias die nackte Existenz Gottes? Bedecken betende Augen die armselige Blöße? Braucht der allmächtige Gott Windeln? Wird er ohne sie in dieser Welt sich erkälten und erfrieren?
Ein Bild gibt zu denken und will uns auf andere Gedanken bringen. Still im Hintergrund bleibt der, der uns das Geschenk dieser Bildpredigt macht. Wir brauchen solche Bilder und die uralte und zugleich immer junge Weihnachtsgeschichte als Bild-Geschichte gegen die Angst, gegen die Hoffnungslosigkeit! Wenn nicht jetzt, wann sonst?! Wer ist der Künstler, der will, dass wir ‚im Bilde’ sind, dicht dabei, wo Fleischwerdung Gottes geschieht? Meister Francke (geboren um 1380 in Hamburg, tätig bis nach 1430) hat das diesjährige Weihnachtsbild als Teil des Englandfahrer-Flügelaltars (‚Thomas-Altar’) wohl 1425/26 geschaffen. Meister Francke, gehört zu den wenigen Malern des Westens, die im Spätmittelalter mit dem Weihnachtsbild an die altchristliche und byzantinisch-östliche Bildtradition anknüpfen. Er lokalisiert Jesu Geburt in einer Erdhöhle - ein wahrhaft animalischer Ort! Das diesjährige Weihnachtsbild ist ein schönes norddeutsches Beispiel, wie man um 1400 die Geburt Christi ins Bild setzte. Und es ist das einzige Tafelbild nördlich der Alpen im 15. Jahrhundert, das die Geburt Jesu in einer Höhle stattfinden lässt.
Keine hygienisch keimfreie Weihnacht
Nein! Nicht ‚alle Jahre wieder…‘. 2020 ist spürbar anders. Die Welt liegt im Argen. Für viele ging und geht es an die Existenz. Viele warten nicht mehr ‚aufs Christkind‘. Wir warten, auf neue Rettergestalten - Epidemiologen, Virologen, Infektiologen, Immunologen -; wir warten, wann die Pandemie ein Ende haben wird und ob es irgendwann ein ‚neues normales‘ Leben ‚danach‘ geben wird. Wir feiern ein seltsames Weihnachten in einem von der Pandemie überschatteten Jahr. Mitgenommen werden wir in eine Felsenlandschaft, an den Rand einer dunklen Höhle, in der die byzantinische Kunst die Geburt Jesu geschehen lässt. Zur stillen, heiligen Nacht 2020 müssen wir uns in schlecht geheizten Kirchen oder während der Freiluftgottesdienste warm anziehen. Mancherorts begehen wir im Freien das Fest, an dem der König ‚draußen vor der Tür‘ zur Welt kommt. Keine heile Welt. Wir feiern den armen Jesus, „im Freien“, „im öffentlichen Raum“, unseren Blicken ausgesetzt, vor uns abgelegt, ohne viel Bewegungsfreiheit. Wir sehen Maria in einsamem Gebet und bedenken im Blick auf das rosige ‚Inkarnat’ des Kindes die Inkarnation, die nackte Wahrheit, dass Gott wirklich ‚Fleisch’ angenommen hat (Joh 1,14): Leib Christi, das Weizenkorn Gottes, das auf und in die Erde fällt und stirbt (Joh 12,24)!
In diesem Jahr mussten wir viele neue Wörter lernen, z.B. das Wort „vulnerabel“. Der Schutz der Vulnerablen, der Verletzlichen, der Menschen mit Vorerkrankungen und derer in hohem Alter ist ein Akt der Nächstenliebe. Gott wird ein solches vulnerables Geschöpf, nimmt einen gefährdeten Körper an und rückt uns so auf den Leib. „Er liegt dort elend, nackt und bloß“ (GL 247,2). Eine seltsame Herrlichkeit Gottes (Joh 1,14) wird uns zugemutet! So nackt wie er kamen auch wir zur Welt, doch zumeist in einem desinfizierten Kreißsaal. Vielleicht erschrecken wir im Blick auf ihn über unsere Infektionsanfälligkeit und Verletzlichkeit. Ecce homo! So ist der Mensch - und Er ist uns allen gleich, außer der Sünde. Diese Wahrheit über uns selbst und über seinen kleinen Anfang in seiner Welt wird bloßgelegt. Schauen wir dieser nackten Wahrheit ins Gesicht!
Wir spüren Heimweh nach vertrauen Verhältnissen und vermissen so vieles Gewohnte und Liebgewordene im diesjährigen Advent und an diesem Weihnachtsfest: vielstimmigen Chorgesang, die Glühweinseligkeit, opulente Festesfreude, das Gewusel auf den Adventsmärkten, die Seniorenweihnacht, das florierende Geschäft in vollen Fußgängerzonen, Tischgemeinschaft in den Restaurants… Auch auf diesem Weihnachtsbild entdecken wir Ungewohntes und vermissen gewohnte Requisiten des Weihnachtsevangeliums - nicht nur die Windeln, das Erkennungszeichen des neugeborenen Messias für die Hirten, die im rechten Hintergrund auftauchen. Uns fehlt der Stall oder andere Spuren menschlicher Behausung. Und vor allem: der heilige Josef ist nicht im Bilde; ihn übergeht der Maler.
ER kommt in keiner keimfreien Umgebung zur Welt. Die schräggestellte kastenförmige Krippe bewahrt nicht das Kind auf, sondern ist als Futtertrog Ochs und Esel überlassen, die fast in der Felskulisse verschwinden und beides zugleich können: fressen und auf das Kleinkind blicken. Das sind keine ‚großen Tiere’, sondern Lasttiere; sie sind ‚voll präsent‘ und öffnen mit ungläubigem Staunen ihre Augen. Die ganze Schöpfungswirklichkeit ist in diesen beiden Tieren dabei. Eine wahrhaft animalische Weihnacht! „Inmitten der beiden Tiere wirst du erkannt.“ (Habakuk 3,2; vgl. Jes 1,3f).
2020 war ein Desaster
Tief unten stoßen wir auf Gottes Sohn. Der „strahlende Morgenstern“ (Offb 22,16) fällt vom Himmel auf unsere Erde, wird uns zu Füßen gelegt. Nicht droben am gestirnten Himmel über uns, sondern unter uns wollen wir den Weihnachtsstern entdecken, der aufgeht im Land der Jakobssöhne (Num 24,17). Dieses Jahr war für die ganze Welt ein Desaster. In dieser Vokabel steckt das Wort „astrum“, Stern. Haben wir uns getrennt von dem guten Stern, der ganz unten - auf dem „Sternenfeld“ von Bethlehem liegt? Wir müssen ihn neu suchen! Die Bodenlage zeigt: ganz tief ist Gottes Sohn heruntergekommen, „der Sonne und dem Regen preisgegeben“ (GL 460,3), ungeschützt, unversorgt, verwundbar, in einer zerklüfteten Landschaft, auf hartem Grund, hart am Abgrund, nicht einmal auf Heu oder auf dem Schutzmantel Marias gebettet. Der Philosoph Martin Heidegger spricht von der ‚Geworfenheit’ des Menschen und trifft damit die existentielle Erfahrung vieler Menschen: Wir haben uns nicht im Griff! Ratlos und wortlos stehen wir vor der Zumutung einer unsichtbaren viralen Macht. Woher kommen wir? Wohin sind wir geraten? Wohin sind wir unterwegs? Wer gibt uns Schutz? Hineingeworfen sind wir in diese zerbrechliche Welt – als ein ‚Geworfener‘ kommt Er zu uns. Auf nacktem Golgotha-Felsen wird er einmal liegen, mit ausgebreiteten Armen, dann, wenn die Henker ihn ans Kreuz nageln. So wird in der Weihnacht vorweggenommen, was auf Ihn - uns zugute! - zukommt.
Das Kind: Licht vom Lichte
Das Kind ist so unscheinbar - gäbe es nicht die Vergegenwärtigung des herabschauenden Gottvaters am oberen Bildrand, gäbe es nicht die Goldstrahlen von oben, die wie Scheinwerferlicht in die Tiefe weisen. Christus liegt auf der Achse des Bildes; das „selbstleuchtende Christuskind“ ist der untere strahlende Pol: Licht in der Finsternis der Erdhöhle. Wer nahe herantritt an das Bild, meint, das Kind schwebe wie ein Strahlenbündel über dem Erdboden. Am anderen oberen Pol schaut Gottvater aus den Wolken und dem ‚aufgerissenen‘ goldenen Himmelsfenster auf ihn. Der Maler zieht den Schleier vom Geschehen weg und macht den verborgenen Gott sichtbar. Im Geist sind Vater und Sohn verbunden: ein weihnachtliches Dreifaltigkeitsbild! Diese dunkle Welt liegt im Augen-Blick Gottes! Sie ist Ihm nicht egal.
Meister Franckes Landschaft wirkt stilisiert. Schroffe Felsen, ein grüner Abhang als Weideland, Baumgruppen. Wir erkennen eine Zeder. Ins Auge fällt, wie sehr diese Welt durch die Einbuchtung des Horizontes zur offenen Schale wird, die sich dem Himmel hinhält, damit der Schöpfer sie erlösend erfüllt. Die Grotte wirkt so schroff und kantig; die Linien der Landschaft sind weicher, abgerundet, kurvig: die Welt als Wiege. In der Weihnacht wird diese gottleere Welt von Gott besucht und geheiligt. Das ist ein Gedanke aus der Frömmigkeit des Ostens: Die sich herabsenkende und erwartungsvoll nach oben hin gewölbte Landschaftsformation ist wie ein Geschenk der Erde. Sie gibt den Schutzraum der Höhle frei. Die Erde bringt dem Herrn des Kosmos die Höhle als Weihnachtsgeschenk dar,
Im Hintergrund, in der Tiefe des Bildes auf dem Hang unter der Baumgruppe ein gleichzeitiges Geschehen: die Welt der Hirten. Während vorne alles fast lyrisch im Stillstand verharrt, wird hinten erzählt. Ein Hirte weist mit dem Finger auf den heranfliegenden Engel; ein anderer Hirte ist mit seiner Alltagsarbeit beschäftigt und gräbt; zehn Schafe grasen. In diesen Vorgang hinein wird plötzlich Unerwartetes laut, der Friede auf Erden verkündet, den ein weiteres Spruchband bezeugt: Gloria in excelsis.
Weihnachtlicher Tiefblick ins Ungewohnte
Die Vorstellungskraft Meister Franckes wird angeregt durch Visionen der heiligen Birgitta von Schweden (1308-1373), die in ihren letzten Lebensjahren ins Heilige Land pilgerte und kurz vor ihrem Tod das niederschrieb, was ihrem inneren Auge im Frühling 1372 in Bethlehem aufging. Auch Birgitta schildert die Geburt in einer Höhle. Maria sei bei der Geburt allein gewesen, und Josef sei hinausgegangen. Während Maria bewegungslos betet, ist das Kind auf einmal da: Anbetung und Geburt fallen quasi in eins. Diese ‚revelatio’ der Birgitta übt mächtigen Einfluss auf die Weihnachtsbilder seit dem 15. Jahrhundert in Italien und Deutschland und auch auf unseren niederdeutschen Maler aus! Der ‚Höhlengeburt Christi nach der heiligen Birgitta’ folgen die Maler, die auf den vertrauten Stall oder sogar auf den hl. Josef verzichten, da er sich ihr zufolge vor der Geburt zurückzog. Wir sehen die von Birgitta wahrgenommenen Worte auf dem Spruchband, das vom Mund Marias ausgeht und nach oben flattert. Doch sind sie vertauscht bzw. variiert, dem nachösterlichen Bekenntniswort des Apostels Thomas angeglichen: „Mein Herr und mein Gott“ (Joh 20,28). „Dominus meus et Deus meus“.
Weihnachten – auf das Wesentliche verdichtet
Engel gehören in die Heilige Nacht. Drei dieser „guten Mächte“ umringen Maria und halten ihr den zuvor abgelegten blauen Mantel wie einen Vorhang, als schützten sie Maria vor dem kalten Zugwind und vor meinen allzu aufdringlichen Blicken, als würden sie für diesen kostbaren Augenblick der Anbetung einen Schutzraum improvisieren. Betern schaut man nicht gerne zu. Beten ist ein intimer Vorgang. Wer betet, um den breitet sich ein heiliger Boden. Ein blondgelockter Engel in grünem Gewand, eine Rückenfigur, bildet einen Baldachin und birgt Jesus im Schatten seiner roten Flügel. Dieser Engel ragt aus dem Bild, steht gewissermaßen bei uns Betrachtern, zieht uns in das Bild hinein und lädt mich ein, diese schützende Geste nachzuvollziehen.
Dieses Andachtsbild ist kein Geburtsbild; es bewahrt den Licht-Moment der Anbetung des Kindes. Es erzählt kein dramatisches und äußerlich bewegtes Geschehen. Der Maler ist kein Erzähler. Der Augenblick, den das Bild aufbewahrt, ist wie ein lyrischer Ruhepunkt, das Fest göttlicher Realpräsenz und menschlicher Versenkung. Meister Francke verzichtet auf alle genrehafte Ausschmückung und auf alles Laute. Darum passt dieses Bild zur Weihnacht 2020, die uns zum Verzicht auf alles Aufwändige zwingt und auf den kargen und heißen Kern des Glaubens stößt. Francke reduziert und konzentriert den Blick auf das Wesentliche, das Innenleben, auf diesen ‚zauberhaften’ Moment, in dem Maria staunend innehält und mit heiliger Scheu den Blick auf Christus ruhen lässt. Es gab für mich in diesem Jahr an manchen Coronatagen fast eine ‚Monokultur‘ der Aufmerksamkeit; ich war auf die meist negativen Nachrichten auf den ‚Corona-Live-Tickern‘ fixiert. Weihnachten lenkt meinen Blick heilsam ab. Ich folge den Augen Marias Sie laden ein, auf völlig Positives zu blicken; sie bewegen mich zur Entdeckung Jesu – so dass der wahre Retter mir einleuchtet. Die junge Maria ist allein mit ‚ihrem’ Kind; sie nimmt die linke Bildhälfte ein, sie gibt uns dieses Gottesgeschenk frei. Unbegriffen, unbegreiflich liegt das Gotteskind zu ihren und zu unseren Füssen. Die Weihnacht Marias ist ein Fest liebender Selbstvergessenheit; betend vergisst sie auch das, was ‚man’ von einer ‚guten Mutter‘ erwartet. Mit ihren betenden Händen und ihrem gebeugten Körper ist sie die Person gewordene Zuneigung, ganz Gebärdefigur, von der eine ‚große Stille’ (Hiob 4, 16) ausgeht. Sie hat nur Augen für diese winzige ‚Bezugsperson’ am Boden, auf die auch der Vater vom Himmel her voll Liebe blickt. Der Neugeborene ist ihr Kind, das jedoch nicht nur ihr gehört. Sie überlässt Ihn dem Vater und uns! Er gehört aller Welt. Wer staunt und betet, hat nichts in der Hand; die Staunenden werden vom Geheimnis umgriffen. Dem Betenden öffnet sich der Himmel. Wer betend sich selbst vergisst, wird verwandelt und strahlt Gottes Glanz aus. Wer glaubt und loslässt wie Maria, der hat Gott nicht im Griff, verzichtet auf jegliche Besserwisserei, der wahrt das ehrfürchtige Gegenüber: Distanz und Nähe.
Das unbedeckte Haupt und das offen über ihre Schultern herabfallende blonde Haar unterscheidet Maria vom Schleier der Witwen, Nonnen und der mittelalterlichen Ehefrauen, die ‚unter die Haube’ gekommen sind. Auch der hl. Birgitta fiel das blonde Haar Marias ins geistige Auge! Meister Francke zieht das von der schwedischen Mystikerin erblicke Weiß des Mariengewandes dem uns vertrauteren Blau des Marienkleides vor. Maria zeigt uns durch ihre Gebärde die verborgene Wahrheit der Weihnacht. Sie erinnert, wer der Anbetungswürdige ist: Ecce homo. Seht dieses kleinen Häuflein Mensch, und in ihm die Größe und das Elend jedes unersetzbaren Menschenkindes. Seht auf Schwester Erde den neuen Erdling, den neuen Adam! Maria tritt zur Seite, sie verstellt das Gotteskind nicht. Sie macht den Weg frei. Ihrem „langen, gewaltlosen Blick“ (Adorno) auf das Kind wollen wir Folgen und spüren: wer vor dieses Kind gerät, wird alles Laute ablegen und sich Ihm hinhalten.
Gott ist nicht der feierliche Hintergrund des Lebens; der Weihnacht-Himmel hat einen Riss, er steht offen und Gottes Licht leuchtet ein. Sein Kommen in Christus wird nicht ‚abgesagt‘; Jesu Geburtstag ist unaufschiebbar. Gott sucht das Risiko und kommt zur Welt; er ist in Christus der ‚Naheliegende’, zum Greifen nahe. Er lässt sich die Anbetung gefallen. Die ‚Geworfenheit’ Gottes feiern wir in der Christnacht. In unserer Welt-Höhle warten wir auf Licht. Entdecken wir den Herrn, der um Liebe und bergende Hände bittet. Seine Arme und Hände nehmen Kontakt auf, winken, segnen, umfangen, strecken sich Maria, dir und mir entgegen. Kommt und seht! Seid und bleibt im Bilde! Dieses Geschenk ist für alle da, für alle Welt. Das wäre unser Weihnachtsgeschenk: einander beizustehen in unserer ‚Geworfenheit’ und Verwundbarkeit. Lasst uns Gott durch unsere Anbetung und Fürsorge ‚wärmen‘ und einander unsere liebende Aufmerksamkeit zu schenken, damit die Liebe nicht erfriert in dieser kranken und zerbrechlichen Welt.
Seine hautnahe Nähe wünsche ich Euch und Ihnen!
Kurt Josef Wecker, Pfr. /Nideggen-Heimbach
Nikolaus von Myra und sein billiger Abklatsch, der Weihnachtsmann
Ansprache am Gedenktag des Bischofs und Kinderfreunds
(Kurt Josef Wecker)
1. Mehr als ein Schokoladenhohlkörper
Schöne Bescherung! Auf dem Altar begegnen sich der echte Nikolaus und dessen übermächtiger und oft eher dicklicher Konkurrent, der Weihnachtsmann. Zwei Welten begegnen sich, und darin die drohende Mutation eines Heiligen zu einer Werbefigur von Genuss und Konsum, von Weihnachten in ein Jahresendfest, von Ostern in ein „Hasenfest“. Heute am 6. 12., 2020 zeitgleich mit dem 2. Adventssonntag, schlägt Nikolaus' große Stunde! Wir erklären unsere Pfarrkirchen zur „weihnachtsmannfreien Zone“ und konfrontieren den kleinasiatischen Heiligen doch mit der eher korpulenten und gemütlichen Verkörperung des amerikanischen Traums, mit ‚Santa Claus‘ Nikolaus hat Vorfahrt! Wir feiern den 'Echten'! Den Mann mit der Mitra und nicht mit der Zipfelmütze; und der Hirtenstab darf auch nicht fehlen! Es gehört also 'Unterscheidung der Geister' dazu, den einen vom anderen zu unterscheiden. Schokoladenhändler sagen: der 'echte' Nikolaus in bischöflicher Amtstracht ist ein „Nischenprodukt“..., nur noch in Dombuchläden und den schrumpfenden katholischen Verlagen zu kriegen.
Doch ich will mich nicht ereifern; ich lasse ihn ja leben, den Weihnachtsmann; doch im Stillen denke ich: man sollte diesem Werbeträger für ein süßes schwarzes Brausegetränk, diesem Abgesandten aus Lappland an seinem Rentierschlitten sägen...
Nikolaus, der Mann aus dem Südosten, kommt nicht mit einem solchen Schlitten. Er tritt aus der Welt Gottes in unsere Mitte.
Ich frage mich: wer wird all die Millionen zellophan- oder stanniolverpackten Schokoladenosterhasen zu Nikoläusen essen? Müssen die Reste dann umgeschmolzen und umgewandelt werden – oder werden die Osterhasen zu Weihnachtsmännern umgegossen! Denn ab Mitte nächster Woche geht es den Hohlkörpern an den Kragen und es stellt sich die brennende Frage: Wohin mit all den nicht gekauften und nicht gegessenen Schokoladenhohlkörperfiguren?
Nikolaus! Wir feiern ihn heute und den, ohne den er nicht zu verstehen ist! Das unverzehrbare Geheimnis des Glaubens! Den Heiligen, der das Gegenteil eines Hohlkörpers ist
Man müsste ihn erfinden, diesen Nikolaus, wenn es ihn nicht gäbe!
Man braucht Phantasie und Gottes Geist - damit man ihn, Nikolaus „nachspielen“ kann: seine schlitzohrige Liebenswürdigkeit, seine heilige Ankunft, sein Ankommen, seine unverwechselbaren Merkmale und Handbewegungen, damit sein Auftreten nicht verwechselbar wird mit dem des russischen 'Väterchen Frost' und dem amerikanisch-unverbindlichen Weihnachtsmann. Weihnachtsmänner kann man beim Arbeitsamt anmieten (biblisch ist der Weihnachtsmann also ein „Mietling“). Man kann sie sich inzwischen quasi als „Schwarzarbeiter“ bestellen; dann haben sie ihren großen schweißtreibenden Auftritt als guter Onkel', als mahnender Zeigefinger zu mehr Nächstenliebe, als ein früher Ausrichter lieber Weihnachtsgrüße und diverser Trostbotschaften.
Nikolausdagegen kommt ja nicht von der Arbeitsagentur, nicht als marktförmiger Repräsentant einer vorweihnachtlichen Konsumwelt. Der Heilige kommt vom Himmel. Nikolaus ist Bote, Retter, Bote des guten Hirten Christus und Repräsentant der väterlichen Seiten Gottes; ein 'Heiliger der ungeteilten Christenheit', der sich vielleicht am besten als Patron Ost- und Westeuropas, sogar als Brückenfigur zwischen der Türkei und Europas eignet!
Darum sollen wir ihn uns nicht zu sehr vermummt und unkenntlich gemacht vorstellen, Furcht einflößend und mit Rauschebart (darunter eine Mund-Nase-Bedeckung?), sondern als einer, der 'Gesicht zeigt', der kenntlich ist und der für die Kenntlichkeit des Evangeliums steht.
Es lohnt sich 'dahinter zu kommen', wer er ist, nicht um ihn zu entlarven und zu demaskieren, sondern um ihm näher zu kommen und die Faszination zu verstehen, die von ihm ausgeht. Viel Wunderbares wird von ihm erzählt, beinahe zu viel für ein Menschenleben. In jedem Jahr zieht er im Adventskalender an uns vorbei. Er will nicht spurlos kommen und gehen. Es wäre schlimm, wenn er weiterginge, ohne bei uns anzukommen!
2. Ex oriente! Morgenstern in Winternacht
Wenn Nikolaus kommt, riecht es gewissermaßen nach Weihnachten. Der heilige Mann will durch sein Tun – wie Johannes der Täufer, dem er auffallend ähnlich sieht und den er gewissermaßen nachspielt - Gott die Wege bereiten in den Herzen derer, die ihm ihr Ohr und ihre Aufmerksamkeit schenken. Wenn er kommt, dann leuchtet Glanz Gottes auf, nicht das Glitzern einer kitschigen Weihnachtskugel, sondern Licht des lebendigen Gottes.
Papst Benedikt XVI. erinnerte noch als Kardinal - in einer frühen Nikolauspredigt - an das Wort eines Biographen dieses Bischofs aus Myra/Kocademre bei Kale: Nikolaus ist „der Morgenstern, der von der aufgehenden Sonne sein Licht empfängt“.
Und darum ist Nikolaus wie der Täufer Johannes eine adventliche Gestalt. Er kommt aus der Tiefe der Winternacht in unsere warmen Stuben und Kirchen und verschwindet wieder fast sang- und klanglos, ohne groß Aufhebens zu machen von seiner Person. In seinem Kommen feiern wir die Vorahnung des Kommens der Güte Gottes selbst! Er erinnert mich an Gott-Vater. (so wie mich Franziskus an Gott-Sohn erinnert).
Er muss nicht anklopfen, sich nicht wiederholt vorstellen. Ihn kennt jedes Kind! Noch! Nikolaus ist eine durchaus dominante Persönlichkeit. Wenn er kommt, dann beherrscht er die Szene, tritt nicht untertänig auf, klingt nicht umständlich, hält sich auch nicht lange mit bürgerlichen Grußformeln auf, sondern er kommt sofort zur Sache, fragt mich nach dem Glauben, der in der Liebe tätig wird. Er ist an den Früchten meines Lebens interessiert. Es sorgt ihn, wenn mein Leben vergeblich verliefe. Auf einmal steht er Platz greifend mitten im Raum, mitten im Leben, mitten in meinem ahnungslosen unaufgeräumten Innenleben. Nikolaus kommt und will Ordnung bringen, ungefragt, unerbeten. Geduldig bringt er sich Jahr für Jahr in Erinnerung, gibt nicht auf, uns zu besuchen, geht uns vielleicht auf die Nerven mit seiner penetranten Hartnäckigkeit, fragt mich nach dem, was ich mit meinen Talenten gemacht habe, ob ich sie gut angelegt und sinnvoll investiert habe. Oder habe ich sie falsch investiert. Nikolaus ist die lebendige Frage, die mir Gott einmal stellen wird: Lebe ich fruchtbar, wachsam, lebe ich als ein gewinnender Christ in den Augen Gottes?
Der Nothelfer kommt von draußen, von draußen vom Walde, von weit her, sowohl räumlich als auch zeitlich, er kommt aus einem Teil des Mittelmeerraums, aus Myra in Kleinasien, eine der wenigen Orte in relativ erreichbarer Nähe der Südosttürkei, wo es jetzt im Dezember noch warm ist, 70 km südlich von Antalya. Und weil er von ferne kommt, erinnert er uns an eine noch nicht erreichbare Einheit mit der Kirche des Ostens, denn er verbindet in seiner Person und Verehrung die beiden getrennten Lungenflügel des Kirchenleibes. Er ist kein kostümiertes Familienmitglied; es gab ihn wirklich: dieser Nikolaos, zwischen 280 (geboren in Patrara) und gestorben in Myra um 345 oder 351.
Er ist ein gestohlener (oder, nach westlicher Lesart: ein geretteter) Heiliger. Italienische Seeleute, haben sich gewissermaßen unrechtmäßig in den Besitz der Gebeine gebracht und sie in einer günstigen Gelegenheit,1087 nach Bari „übertragen“.
3. Unerschöpfliche Wunderquelle! Von Nikolaus nie genug
Tief verstrickt ist er in ein Gewebe aus Dichtung, Legende und Wahrheit. Von ihm wie von jeder reichen Persönlichkeit gibt es viel zu erzählen. Auch manches Unglaubliche. Denn von nichts kommt nichts... Er gehörte zu den Menschen, die das Volk Gottes 'schwer beeindruckt' haben. Er kommt nicht als Witzfigur, nicht als komödiantischer Spaßmacher, Dienstleister und harmloser Geschenke-Bringer, er kommt als himmlischer Helfer, als Wundermann, als Schenker, auch als Richter. Das macht seinen Ernst aus! Er muss mir so kommen, weil ich nicht allein Ordnung bringen kann in das Schlamassel eines überschuldeten und undurchsichtigen Lebens. Dazu muss mir ein anderer verhelfen. Mit ihm kommt die Wahrheit Gottes hinein in ein Leben, das auch von Lüge und Zweideutigkeit durchsetzt ist. Er kommt als Sieger über das Volk (denn das steckt in seinem Namen Nikolaos: 'Sieg über das Volk’, Sieger über alles Gemeine und Böse und Schmuddelige). Er feiert den Sieg mit seinem glaubwürdigen Leben: als Retter vor dem Ertrinken, als Ernährer, der bewahrt vor dem Verhungern; als Kinderfreund, der drei Mädchen durch das Geschenk dreier ins Fenster geworfener Goldklumpen mit dieser gespendeten Aussteuer vor der Prostitution bewahrt. Nikolaus ist Schlichter vor der vorschnellen Aburteilung. Er ist Totenerwecker dreier eingepökelter Studenten und Retter vor dem ewigen Tod. Er ist der, der Menschen zurückholt aus der Verlorenheit und in den sicheren Hafen hineingeleitet.
Er kündet als Gabenbringer auf seine Weise von der „unbegrenzten Kreditwürdigkeit“ des Menschen, also von einer Güte, die nicht von dieser Welt ist, von einer Großzügigkeit und Lebensrettung, die einfach himmlisch ist. Einer, der teilt und austeilt, vermehrt und schweigt und zur rechten Zeit spricht, einer , der staunt vor Gott und uns vor die Göttlichkeit Christi führt; einer, der es wagt, sich dem Unrecht in den Weg zu stellen und sich rettend in den Weg stellt, wenn ein Mensch falsch beschuldigt wird. Einer Gabe, die unsere Erwartungen überschreitet und übererfüllt, auch meine unausgesprochenen Wünsche kennt, der Auswege kennt, da wo es - menschlich gesprochen – nur noch unabwendbare Notlagen gibt. Nikolaus bringt also einen Vorgeschmack oder Nachgeschmack der 'großen Süßigkeit' Jesu Christi. Er tut Gutes, ohne dabei selbst erkannt zu werden; er lässt sich nicht fotografieren beim Retten und Spenden. Er tut es selbstverständlich, Sponsor, also 'Verlobter' im Verborgenen. Er wird auf frischer Tat ertappt beim Tun des Guten. Darum wird die Tat mit den drei Goldklumpen erst nachträglich und zufällig öffentlich. Er gehört also zu den Menschen, die Gottes Liebe und Überfluss (Ölreichtum zeichenhaft deutlich im Ölwunder von Bari, wo aus seinen Gebeinen eine süße Flüssigkeit tropft) widerspiegeln, ihn einfach weitergeben, unverstellt, uneigennützig, ohne Hintergedanken, mit wachen Augen für das, was jetzt dringend und unaufschiebbar ist, einer in der Nachfolge dessen, der umherzog und Gutes tat. Das macht ihn groß in einer Welt, die oft bloß zuschaut und wegschaut, die fremde Not des Alleinseins, des Sich-Überflüssig-Fühlens, des Nicht-mehr-Gebraucht-Werdens.
4. Das starke Rückgrat des Bischofs
Um so erfinderisch zu sein wie Nikolaus, dazu braucht man kein Patentamt. Das, was dieser Bischof tat, war nicht übermenschlich; vielleicht wird er deshalb so geliebt. Darum ist er mehr als der große Gabenbringer, er bringt gerade noch rechtzeitig die Frage mit, welche guten Vorsätze ich mir gegeben habe in der Adventszeit. Nikolaus ist ja kein Märtyrer mit heroischen Tugenden - trotz einer möglichen Haft vor dem Konzil von Nizäa 325-; er ließ sich nicht für Christus quälen wie die Blutzeugen Andreas, Barbara und Katharina. Nikolaos ist Bekenner, (confessor“), wie der hl. Bischof Martin. Nikolaus strahlt Alltagsgüte aus, also Zivilcourage, Rückgrat (er habe am ersten Tag nach der Geburt bereits 'aufrecht in der Badewanne' gestanden), er besaß den streitbaren Mut zur Einmischung, zum Schlichterspruch, zur Verschwiegenheit...
Was kann man Schöneres sagen, als dass: Dieser Mensch wagt den aufrechten Gang, von ihm geht Gottes Glanz und Menschenfreundlichkeit aus...?! Der ist transparent für den Größeren?! Er verleihe uns die Gabe, buchstäblich das die Not Wendende zu sehen und auch zu tun: da wo Not am Mann und an der Frau ist, wo es lichterloh 'brennt'. „Hilf, Herr meines Lebens“ , dass etwas von Nikolaus auf dich und mich abfärbt!
Was für ein Wunder, wenn ein Mensch das Wunder der Wandlung, des Schenkens weiterschenkt bis in unsere Zeit. Dieses Wunder fließt über auch in unsere Zeit, wie das geheimnisvolle Santa Manna, das Öl, dass am 'Übertragungstag in Bari aus seinen Gebeinen fließt und aufgefangen wird. Der Heilige ist fließend, beweglich gemacht durch den Tau, der vom Himmel fließt.
Der im Jahre 1994 viel zu früh verstorbene frühere Bischof Klaus Hemmerle von Aachen, der mich 1988 zum Priester geweiht hat, ehrte seinen Namenspatron mit diesen Worten:
„Gerade darin vollendet sich Gottes Größe, dass er seine Geschenke nicht nur zum Haben, sondern auch zum Schenken weiterschenkt....
Und auf die Frage hin, warum es in seinem Bischofsring drei Goldpunkte gab, gab er diese Auskunft:
Ich entschloss mich recht bald dafür, die drei Kugeln aus der Nikolauslegende (für mein Bischofswappen) zu wählen... Ich denke, dieser einfache Nikolaus hat mit der Einfachheit solcher Botschaft uns das Entscheidende auch heute zu sagen. Liebe, die aus dem Glauben wächst, stößt Kugeln an, die auf unzählige andere Kugeln treffen und eine endlose Bewegung der Liebe auslösen, die leise, aber wirksam Leben prägt und verwandelt.“ (Klaus Hemmerle)
(Kurt Josef Wecker)
Wortgottesdienst zum 1. Advent am 28.11.2020 aus der Johannes Baptist Kirche in Nideggen
Gottesdienst an Allerheiligen auf dem alten Nideggener Friedhof am 01.11.2020 mit Pfarrer
Kurt Josef Wecker
Gottesdienst vom 25.10.2020 aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Nideggen.
Erntedank-Franziskusmesse vom 04.10.20 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Gottesdienst vom 27.09.2020 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker aus der St. Johannes Baptist Kirche in Nideggen.
Gottesdienst vom 06.09.2020 aus der St. Johannes Baptist Pfarrkirche in Nideggen
Anmerkung zur beigefügten Bildbetrachtung
Das in der Zeitschrift veröffentlichte Bild zu dem Text von Herrn Pfr. Wecker darf aus rechtlichen Gründen (Copyright) nicht vervielfältigt werden.
Bildbetrachtung.............................................................Mt 18,20,Bild von einer Hausgemeinde in der Coronazeit oder von einem ‚einsamen Streaming-Gottesdienst‘
Wohl in keinem Kirchenjahr der jüngeren Geschichte hatte ein Bibelspruch einen solchen „Sitz im Leben“ wie 2020 Jesu Verheißungswort:„Wo zwei oder drei auf meinen Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Runde“ (Mt 18,20; Übersetzung Fridolin Stier).Nie war das Wort zeitgemäßer als heutzutage!Wir erinnern uns an die strenge „Absonderungsverfügung“: keine kirchliche Großveranstaltung, vorgeschriebene soziale Isolation. In der FAZ hießes vor Ostern unter Berufung auf Mt 18,20:„Die Zweiheit einer Zusammenkunft reicht aus, damit ein Gott sich dazugesellt... Somit kollidieren die neuesten staatlichen Vorgaben,sich außerhalb des eigenen Hausstandes nur noch zu zweit in der Öffentlichkeit zu versammeln nicht mit dem biblischen Minimum an Religionsfreiheit“.D.h. die Mindestvoraussetzungen für einen Gottesdienst waren erfüllt. Vielleicht haben wir es in diesen Wochen wieder neu entdeckt: Man kann, zurückgeworfen auf die eigenen vier Wände, nicht nur miteinander kochen, spielen, sich Geschichten erzählen und Filme anschauen; wir können auch miteinander beten und uns dabei der Nähe dieses fremden Gastes gewiss sein, der sich zu uns gesellt. „Liebster Jesu, wir sind vier, dich und dein Wort anzuhören“, so wurde ein Kirchenlied verballhornt. Womöglich haben wir in der Grenzerfahrung der Pandemiekrise ganz intensive Erfahrungen gesammelt. Die stillen Hausgottesdienste und die einsamen Streaming-Gottesdienste in leeren Kirchen bleiben im Gedächtnis, egal, wie langedie Vorsichtsmaßnahmen angesichts der Krisenbedrohung noch dauern werden. Im großen Rahmen konnten wir nicht zusammenkommen und können es bis heute nicht unbefangen. Viele haben den Gottesdienst am Küchentisch, auf der Wohnzimmercouch und auf der Bettkante gefeiert und sich auf das Versprechen des Auferstandenen verlassen, dass er der Dritte oder Vierte in unserem Bunde ist; dass Er sich leise einmischt in unsere Zweisamkeit, unsere Gebetsgruppen komplettiert und die Kirche aus ihrem Lagerkoller, aus ihrer Selbstgenügsamkeit und ihrer ‚splendid isolation‘ erlöst. Nein, wir brauchen unseren Herrn nicht herbeizureden; er kommt aus freien Stücken, zuweilen plötzlich und unerwartet. Zumindest zu Hause durfte die Hausgemeinschaft beim Beten eng zusammenrücken, weil das in Distanz und unter Masken gefeierte Gotteslob schwerfällt. Wir wollen uns fühlen, wenn wir Ihm nahe sind. Das Wunder der kleinen Zahl, die seltsame Vorliebe Jesu für intime Atmosphäre, das stille Kämmerlein, für die beiden Freundinnen Martha und Maria in Bethanien, für die zwei oder drei Frauen am Grab, die beiden Emmausjünger... Nein, Jesus war nicht auf die große Zahl fixiert. Er will bei den Menschen wohnen. Dabei misst er sein Kommen nicht an der Größe der Veranstaltung. Kann das sein, dass er gerne auf Wohnungssuche, auf Hausbesuch ist und sich so klein macht, auf keine Abstandsregeln achtet und sich Zeit nimmt für die Kleingruppe?„Die Kirche ist die Gegenwart Christi“, sagte Dietrich Bonhoeffer. Er ist da, ortsungebunden, wunderbar frei, klassenunabhängig-und nie als Privatbesitz festzuhalten. Wenn Er erscheint, dann weitet er unsere Stuhlkreise und bewahrt uns davor, mit uns alleine zu bleiben. Wie begegnen wir Ihm und uns in schwierigen Zeiten? Ich weiß nicht, ob Sie eher in einer liturgischen Massenveranstaltung oder inmitten einer winzigen Wohngemeinschaft oder in einem Krankenzimmer die Gegenwart des Herrn spüren? Dieses „ekklesiologische Dogma“ des Herrn ist seine Zusage in einer Zeit, die alles so langsam und die unsere Zusammenkünfte so verhalten und überschaubar macht. Senfkornklein ist er da, nicht bei allem und jedem, sondern dann, wenn wir seinen heiligen Namen hochhalten, ihn vermissen, Seine Näheersehnen-auch für den Einsamen, der nicht einmal einen Partner oder Mitbewohner bei sich hat.
Kurt Josef Wecker
Gottesdienst vom 23.08.2020 aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Nideggen.
Hl. Messe aus der Salvatorkirche Heimbach am 21.06.2020
Gottesdienst vom 28.06.2020 aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Nideggen
Gottesdienst mit Pfarrer Kurt Josef Wecker zum Nideggener Patrozinium am 21.06.2020
21.Juni 2020 12. Sonntag im Jk. A
Erste Lesung: Jeremia 20, 10-13 Zweite Lesung: Römerbrief 5, 12-15Evangelium:
Matthäusevangelium 10,26-33 att
Hauptbeitrag Kurt Josef Wecker
Wegweisung zum 12. Sonntag
Vorgestern war das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Am Samstag, dem 20.6., ist das Fest des Unbefleckten Herzens Mariens und zugleich Sommersonnenwende/Sommerbeginn. Heute am Gedenktag des hl. Aloisius Gonzaga ist Sonntag: „Das Jahr steht auf der Höhe“ (GL 465) und nimmt Kurs auf - Weihnachten. Dazu passt das dreimalige „Fürchtet euch nicht!“ Jesu im heutigen Evangelium, ein Vorgeschmack der Engelbotschaft der Hl. Nacht in 6 Monaten. Nach dem Fest des Erlöser-Herzens dürfen wir vor Ihm unser Herz ausschütten. Das Fest des Täufers Johannes- der abnimmt, damit ein anderer wächst (Joh 3,30)- und auch die großen Schulferien werfen ihren Lichtschatten voraus. So manche Schützenvereine und Bruderschaften begehen um das Johannesfest herum ihre Patronatsfeste und Kirmesfeierlichkeiten. Fußpilger sind unterwegs. Das Naturjahr und die Botschaft heute legen es nahe, Gottes schöpferische ordnende Allmacht (Sonnenbahn) und Gottes Liebe zum Detail und Unbedeutenden (Jesu Bild vom fallenden Spätzchen und ausfallenden Haar) zu bedenken. Am Sonntag feiern wir die Gewissheit des Glaubens: „Wir sind in Gottes Händen. Darum: ‚Fürchtet euch nicht‘“ (Bonhoeffer, Nachfolge, München 1989, S.209), auch wenn wir fallen wie die Spatzen. Dann ist Er da, nicht immer wie ein Schutzengel oder ein Rettungsnetz, sondern wie der, der uns in Christus auch im Abgrund nicht allein lässt (vgl. Ps 139,8b). Werden wir auch – im Sturz eines Spatzen vom Himmel – Gottes Willen erkennen und uns seinen Händen überlassen? Werden wir, angeregt durch das heutige Evangelium, zu Mutmachern und öffentlichen Glaubenszeugen!
Predigtgedanken (Kurt Josef Wecker)
’Sonnenstillstand‘
Zeitansage: Heute ist Sommerbeginn. Im Internet finde ich diese Frage: Zweimal im Jahr wird die Sonne gewendet. Aber von wem? Wer steht hinter dieser Schwerstarbeit? Wir können die Sonne nicht anhalten und nicht den Lauf der Dinge, der Planeten beeinflussen. Doch ohne unser Zutun geschehen heute große Dinge über unseren Köpfen. Selten beginnt der Sommer schon am 20.6. (zuletzt 1896) wie in diesem Jahr - und nicht am 21. oder 22. Juni. An diesem Sonntag ist es schon Sommer geworden: Mittsommernacht. Um 23.43h am Samstag ist es so weit: Sommerbeginn, Mittsommer, wie die Skandinavier sagen. Fachleute sagen etwas missverständlich: „Solstitium“, „Sonnenstillstand“. Doch die Sonne kommt nicht zur Ruhe; sie erreicht nun den nördlichen Wendekreis und ‚klettert‘ auf die höchste Mittagshöhe. Zwar ist die Erde im Juni 5 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt als im - auf der Nordhalbkugel eher kalten - Dezember. Und doch rückt uns die Sonne heute nahe. Ein wahrhaft ‚mystischer‘ Tag zwischen Saat und Ernte; weiße Nächte‘ im Norden. Im Naturjahr ist nun der Höhepunkt, das Jahr hat Halbzeit. Heller wird’s nicht mehr, vermutlich noch wärmer… Die Sonne ist nicht unbesiegbar; sie wird – zunächst unmerklich – schwächer. Von nun an geht’s nicht bergab, sondern auf Weihnachten zu. Das Jahr bewegt sich wieder auf die zweite Sonnenwende und Jesu Geburtstag zu; unsere Pilgerreise durch die Lebenszeit geht auf Ihn zu, auf diese Sonne, die nie schwächelt, die nie untergeht. Auf ihn läuft alles hinaus, ob wir es wissen oder nicht
Spatz und Haar
Angesichts solcher unvorstellbaren kosmischen Ereignisse komme ich mir vor – wie ein Spatz, wie ein Haar in der ‚Weltsuppe‘, ein Stäubchen im Kosmos. Doch nicht von der Sonne und den Sommervögeln, den Schwalben, spricht Jesus zu seinen Jüngern, sondern von Sperlingen, also vom Kleinen. Da ist sie wieder: Jesu Vorliebe für das Geringste. Er hat Spatzen und Haare im Blick und darin Gottes Fürsorge und Vorsicht. Piepmätze und Haare - das sind „wertlose Dinge“, kaum der Rede wert. Jesu hatte in seiner ‚Vogelpredigt‘ in Galiläa diese kleinen tschilpenden Mitgeschöpfe (vgl. Mt 6,26) genauso vor Augen wie Franziskus in Umbrien. Was kümmert es uns, wenn so ein Allerweltstier vom Himmel und ein Haar vom sich lichtenden Haupt fällt? Jesus aber würdigt das Winzige. Er schenkt dem Übersehbaren Wertschätzung und feiert eine „Andacht zum Unbedeutenden“ (Sulpice Boisserée). Spatzen zählen zu den ‚Proletariern‘ unter den Vögeln. Doch gerade ihre augenscheinliche Wertlosigkeit gefällt Jesus. Spätzchen, auch wenn sie vielleicht im Land Jesu größer sind als bei uns, waren nur billiges Geflügelfleisch für arme Leute in Palästina: Armeleutebraten. Sie wurden auf den Märkten in Zehnerbündeln verkauft. Für einen Spatz zahlte man nur ein halbes As. Ein As war eine römische Bronzemünze im Wert von 1/16 Denar. Ein Denar entsprach einem Tageslohn. 2020 ist die Turteltaube, 2001 war der Spatz – oder auch der gemeine graue Haussperling – Vogel des Jahres; auch diese häufigste Singvogelart geriet auf die rote Liste bedrohter Tierarten. 7,5 Millionen solle es davon in Deutschland geben, vielleicht eine halbe Milliarde auf der Erde. Ihr Körpergewicht: 30-35 Gramm. Ihre Lebenserwartung: 3-5 Jahre. Als Getreidefresser wurden sie lange Zeit bekämpft (unter Mao in China als Volksfeinde vernichtet), und auch in Deutschland noch um 1950 vergiftet. Sie wissen: Diese kleinen Singvögel bieten Stoff für Schimpfwörter: Spatzengehirn, Dreckspatz, frecher Spatz, Frechspatz, fauler Pfützenspringer, Schimpfen wie ein Rohrspatz, sich vermehren wie Spatzen… Jesus richtet den Scheinwerfer seines Wortes auf diese unscheinbaren Kreaturen, weil sie allen vertraut waren. Sie sind wir Straßenkinder unter den Vögeln, sie suchen die Nähe der Menschen. Gerade ihre gewöhnliche Unscheinbarkeit und ihr scharenweises Auftreten macht sie so übersehbar. Sie sind allgegenwärtig, aber niemand trauert einem von ihnen nach, wenn er tot vom Himmel fällt. Doch: dem Augen-Blick Gottes geht das eine Kleine nicht verloren. ER hat es im Moment des Sturzes im Blick: der Spatz im freien Fall! Das ‚wertlose‘ Kleintier entgeht Ihm nicht. In jeder Sekunde seines kurzen Lebens ist es umgeben von Gottes Fürsorge. Er allein hat die Übersicht über dieses winzige übersehbare Leben, seine ‚Staubkornexistenz‘.
Marktwert des Menschen
Und ihr, die ihr hier sitzt, seid mehr wert als alle Spatzen. In Sätzen wie diesen steckt das ganze Evangelium drin. Ihr seid keine Masse, kein Material, kein Kanonenfutter, keine bloßen Kunden und Konsumenten, keine Artikel, die sich auf dem Jahrmarkt der Welt möglichst gewinnbringend verkaufen. Ihr seid ‚mehr‘ wert. Wir hören ein Substantiv: Mehrwert. Hat der Mensch einen Mehrwert oder nur einen bestimmten Marktwert – wie Spitzenfußballer oder Models? Das sind Menschen, die an ihren Transfersummen oder Abendgagen ablesen können, was sie wert sind, und wie ihr Wert mit der Zeit ins Bodenlose sinkt. Trainiertes oder ästhetisch ansprechendes ‚Menschenfleisch‘ wird heute so gehandelt wie in der Antike die Unfreien auf dem Sklavenmarkt. Man kann anhand der Gehirnmasse mittels eines ‚Rankings‘ den Nutz-, Gebrauchs- oder Handelswert der eigenen Person durch ein Marktforschungsinstitut oder einen Karriereberater feststellen lassen. In Sonntagsreden wird betont: Personen haben keinen Wert, sondern eine Würde. Und Würde lässt sich nicht verwerten. Doch Zyniker rechnen uns aus, wieviel wir wert sind, je nach Alter und Gesundheitszustand meiner ‚Körperbestandteile‘. Und überall der Appell: Verkauf die bloß nicht ‚unter Wert‘! Bleibt im Rennen! Kämpft um eure Marktanteile! Halt dich fit, flexibel, mobil, attraktiv, intelligent, athletisch… Was ist mit der Milliarde Menschen, die ihre elementaren Bedürfnisse nicht befriedigen können? Was ist mit den Behinderten, den Kranken, den Kindern, die nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen? Ihr Marktwert ist gleich Null! Sind sie weniger wert als Spatzen? Was ist mit den Heranwachsenden, die man mit Wissen auffüllt wie Container, um dieses ‚Humankapital‘ gewinnbringend anzulegen… Lohnen sich nur Beziehungen, die ‚wertsteigernd‘ und mir von Nutzen sind? Sehe ich den Andern zuerst als Konkurrenten im Kampf um Marktanteile?
Sonnenwende - Spatzensturz
Darum zucke ich zusammen, wenn ich manchmal das Lob höre oder es einer anderen Person sage: „Sie sind ein wertvoller Mensch!“ Wer heute wertvoll ist, kann morgen zur wertlosen Manövriermasse werden, austauschbar, unwertes‘ Leben. Darum ziehe ich Übersetzungen des heutigen Evangeliums vor, die das Wort ‚wert‘ umgehen. „Ihr seid besser denn viel Sperlinge“ (Luther). „Mehr denn viele Spatzen geltet ihr.“ (F. Stier). Die Mitfeier dieser Messe, auch mein Glaube und alle ‚guten Werke‘ steigern nicht meinen Marktwert vor Gott. Das Evangelium ist, wie der evangelische Theologe Eberhard Jüngel sagte, eine „wertlose Wahrheit“. Wir sind Ihm lieb und teuer, so wie wir sind - auch wenn wir erfolglos, machtlos, tatenlos, ratlos sind. Einige unter uns fühlen sich vielleicht so wertlos wie spottbillige Allerweltstiere, so unscheinbar wie ein grauer Haussperling. Unter uns sind Menschen, die sich wie ausgebrannt und verheizt vorkommen; Opfer dieser Zeit, über die andere herfallen, - wie Spatzen, geschlagen von Raubvögeln. Denen wird gesagt: Mitten im Leben seid ihr von Gottes Blick umfangen. Gerade ihr seid kostbar in seinen Augen. Ihr habt Ansehen und Würde, aber keinen Mehr-Wert vor ihm. Ihr seid „Mein Schatz“. Unser Kurs vor Ihm fällt nie ins Bodenlose. Ihr bleibt im Augen-Blick Gottes, ob ihr steht oder ob ihr – wie Spatzen vom Himmel – fallt. So zerkratzt wir auch sind, wir bleiben das Ebenbild Gottes. Wir sind ihm so wichtig, dass er für uns den Schuldschein bezahlt und in Christus für uns in den Tod geht.Heute ist Sommerbeginn: Der Schöpfer wendet nicht nur die Sonne. Er ist nicht nur für das Große und Ganze zuständig. Er hat meine staubkornkleine Existenz im Blick und sorgt sich ‚haarklein‘ um mich. „Fürchtet euch nicht“. Jesus wiederholt sich und zitiert die Engel der Weihnacht. Lasst euch nicht einschüchtern. Er liebt das Detail und hat selbst mein (spärliches) Haar im Auge. Nichts entgeht ihm. Wir sind mehr als Stimmvieh und Schlachtvieh. Ich bin von Ihm umgeben, auch wenn ich falle und stürze. In der Taufe wurde ich tief in ihn hineingetaucht. Er liebt mich mit Haut und Haaren. Diese gute Botschaft wollen wir glauben und sie wie Spatzen von den Dächern pfeifen. Ihnen einen guten Sommer! Kurt Josef Wecker
Fronleichnamsgottesdienst mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Fronleichnam in der Coronazeit 2020
Predigt von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen-Heimbach)
Liebe Gemeinde,
im Jahre 1994 schrieb Kardinal Ratzinger einen wichtigen Satz: „Die Teilnahme am Leben der Kirche darf nicht allein auf die Frage nach dem Kommunionempfang reduziert werden. Den betreffenden Gläubigen muss geholfen werden, zu einem tieferen Verständnis vom Wert der Teilnahme am eucharistischen Opfer Christi, der geistlichen Kommunion, des Gebetes, der Betrachtung des Wortes Gottes, der Werke der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit zu gelangen. “ Damals erläuterte er einen Passus aus der Enzyklika „Familiaris consortio“ von Papst Johannes Paul II.. Diese Antwort war auch als Reaktion gedacht auf die Frage von wiederverheiratet Geschiedenen, was ihnen vorenthalten bleibt, wenn sie an der Kommunionbank leer ausgehen. Und dann wies Ratzinger hin auf Selbstverständliches und Unterschätztes. Der vor kurzem verstorbene Salzburger Dogmatiker Gottfried Bachl schrieb dazu einem einen Essay: „Ratzinger tröstet“. Der Präfekt der Glaubenskongregation erinnert uns daran, dass Christi Wege weiter und größer sind als die der Kirche. Wir haben die Gegenwart Christi nicht in der Hand, können sie auch nicht auf die sakramentale Kommunion allein einengen. Kirche ist keine Fabrik, die Jesu Gegenwart herstellt und garantiert, vermehrt und garantiert. Es gibt die „geistliche Kommunion“, das Gebet, die Betrachtung des Wortes Gottes, die Taten der Nächstenliebe. In diesem Jahr wurde den Gemeinden monatelang der Verzicht auf den ‚Fronleichnam‘ zugemutet. In Vlatten verzichtet die Gemeinde bis heute wegen der möglichen Ansteckungsgefahr auf den Empfang der sakramentalen Kommunion. Es bleibt der virtuelle Kontakt, nur eine digitale, ‚entleiblichte‘ Weise der Gegenwart Jesu, aus der Ferne, auf Abstand. ER fällt nur ins Auge, nicht in den Mund. Anderenorts, wo die hl. Kommunion ausgeteilt wird, sind es momentan seltsame Verrenkungen und Versuche: z.B. in Form der Darreichung auf einer Serviette unter Vermeidung einer zu nahen Begegnung, anderenorts durch Plexiglas oder mit Zangenkommunion oder mit weit ausgetreckten Armen mit oder ohne Handschuhe. Oft war es in der ersten Phase der Coronakrise der Priester allein, der in den stillen oder in kleinstem Kreis gefeierten Messen die Kommunion stellvertretend empfing. Fragen wir uns ehrlich: Machte uns der Entzug zu schaffen? „Jesus allein im Abendmahlsaal“, so zeigten es Karikaturen in den Tageszeitungen zu Gründonnerstag. War - und ist zum Teil noch heute - diese Kommunionaskese, diese permanente Fastenzeit eine übervorsichtige Überreaktion der kirchlichen Behörde, ein anmaßender Griff auf die persönliche Verbindung mit Gott? Hat die Kirche die Gläubigen in eine Art religiöses Niemandsland geschickt, eine Art eucharistische Aushungerung, quasi in die Wüste, dorthin, wo Gott allein das hungernde Volk Gottes vom Himmel her mit Manna ernährt hat? Andere fragen sich: Wie wird es zukünftig sein, wenn immer weniger Priester immer weniger Messen feiern und dadurch immer seltener die sakramentale Kommunion ermöglichen können? Bedeutet dies dann eine Art permanenter Hungerzustand, eine jesus-lose Zeit in vielen Gemeinden? Katapultiert uns der Virus also wie ein Brandbeschleuniger in eine Zeit hinein, wo wir Jesus immer seltener eucharistisch begegnen werden? Denn das, wonach gehungert wird, ist nicht auf Abruf da: das nährende Brot des Himmels, diese Gabe, in der Er sich uns darreicht. Diese Nahrung aus der Hand Jesu ist nicht irgendein Zeichen, die Nahrung ist der „Fronleichnam“, ist Gottes schöne Bescherung in Person, Christus selbst: Christus in der Gemeinschaft seiner Jüngerinnen und Jünger; sein sehr kreativer Weg zu uns, in einem unverwechselbaren und doch zerbrechlichen und materiell wert-losen Zeichen, einem vergänglichen Lebensmittel. Nun gibt es die anderen Sakramente der Kirche, vor allem die Taufe. Auch darin ist Er ganz präsent. Die anderen Zeichen relativieren den steilen Satz, als sei Jesus wirklich nur in der Eucharistie gegenwärtig. Zuweilen spitzen wir ja alles auf einen Augenblick hin zu, wenn die Messdiener klingeln und signalisieren: Es klingelt, Er kommt! Können also nur die Wandlungsworte, die ich hier spreche, die Gegenwart Jesu bewirken? Oder muss in jedem Fall in einer Wortgottesfeier die Kommunion ausgeteilt werden, weil Gottes Wort nur die ‚halbe‘ Wahrheit ist, uns nur eine uneigentliche Gegenwart Jesu bringt. Beinhaltet allein die Eucharistie das Ganze? Können wir uns die Gegenwart Jesu so zerstückelt vorstellen, hier dünn und da dicht, hier so allgemein und da ganz gewiss und konkret?
In diesen Wochen der schweren Pandemiekrise war der Kontakt der Gläubigen zu Jesus nicht abgebrochen oder zerrissen, als würde man ein Kabel durchtrennen. Ja, es ist möglich, mit Jesus zu leben und sich zugleich zeitweise in Ausnahmezeiten in Abstand zur kirchlichen Gemeinschaft zu befinden. Die Kirche hat Jesus nicht in der Hand und kann ihn auch nicht im Tabernakel wie in einem Depot aufbewahren. Ich ‚mache‘ hier nicht die Gegenwart Christi, wenn ich mit Wandlungsvollmacht die Wandlungsworte ausspreche, als käme Jesus automatisch oder auf Befehl herbei. Gott ist von sich aus da, ich kann ihn nicht herbeischaffen, ich kann das Heilige nicht in die Hand bekommen, nur erbitten und erwarten und empfangen. Er ist da auch in den anderen Sakramenten da - voll und ganz, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit. Das anzunehmen, setzt eine kirchliche Selbstrelativierung voraus, auch eine Gelassenheit der Kirche, die Jesu den Vortritt lässt; ihm, der ganz andere Mittel und Wege findet, unser Allernächster zu sein.
Wenn ich das tue, was man Versehgang nennt, also einem sterbenden Menschen die Kommunion oder das hl. Krankenöl zu bringen - dann transportiere ich nicht Jesus irgendwohin, wo er nicht zuvor war. Auch im Sterben eines Menschen ist er da; und doch ist es eine Wohltat für einen schwerkranken Menschen, ihm deutlich zu machen, wie nahe der Herr bei uns ist, mit seinem zerbrechlichen Fronleichnam unter unser Dach tritt, wie er sich auf den Weg macht zu uns, sich uns auf die Zunge legt in einem kleinen Brotstück, wie das Lebenszeichen des Krankenöls ein Gespür der Zuneigung Jesu verleiht, wie seine geistliche Gegenwart immer wieder in leibliche Zeichen eingeht.
Außerhalb der Hl. Messe und des ‚Fronleichnams‘ ist Er eben nicht nur irgendwie, annäherungsweise, verdünnt, symbolisch blass und quasi in geringer Dosierung da. Er ist ‚voll präsent‘ und gegenwärtig, wenn er verspricht, bei uns zu sein, immer wenn zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind und wenn wir uns betend seiner Nähe öffnen; immer, wenn wir ein stilles Gebet sprechen vor einem Bildstock oder einem Gnadenbild; wenn ich eine Kerze entzünde in der leeren Kirche, wenn wir in Ps 139 den Lobgesang auf die uns umgebende Gottesgegenwart meditieren; oder dann, wenn ich staune über etwas Wunderschönes in der Natur oder der Kunst, wenn wir uns menschlich verhalten, gutmeinend und segnend übereinander sprechen, wenn wir im Gesicht des Anderen das Antlitz Jesu entdecken und dann auch in mir Ihn wahrnehme, dann wenn ich zu ungeahnter Güte in der Lage bin...
Zutiefst verständlich ist die Leidenschaft und Sorge um die sakramentale, eucharistische Grundversorgung der Gemeinden, um das Manna in Wüstenzeit dieser Krise von Welt und Kirche. Dann brauchen wir essbare Wegzehrung, etwas Spürbares, Berührbares, eine Kraft, die sich mit uns vereint. Es darf nicht alles in der Fernbedienung, im Virtuellen aufgehen. Und darum feiern wir heute – bedingt durch das unsichere Wetter und das Prozessionsverbot - in den ‚Obergemächern‘ unserer Kirchen den Gründonnerstags-Augenblick, seinen unverwechselbaren Weg, sich uns unter armseligen Zeichen zu reichen, er, der sich uns ganz leiblich mitteilt. Tut dies zu meinem Gedächtnis und gegen eure Gedächtnisschwäche, eure Vergesslichkeit! Wir spüren und fühlen, dass Er lautlos da ist und nicht in der Vergangenheit verschwindet, dass Er seit seiner Himmelfahrt seine liebende Aufmerksamkeit schenkt in den Sakramenten, in seiner geistlichen Gegenwart, in der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unseren Herzen.
„Geistliche Kommunion“ haben wir in diesen Wochen sozialer Distanz neu entdeckt, die Geistesgegenwart Jesu, Augenkommunion, das Schauverlangen, so hieß das im Mittelalter, als Menschen fast zur jährlichen Osterkommunion verpflichtet werden mussten. Geistliche Kommunion mit Christus, das ist auch die wunderbare Geste der Messdiener, die in Schmidt dem Herrn einen Blumenteppich gestalten, einen sehr vergänglichen roten, nein bunten Teppich und Königsweg, mit Schöpfungsgaben von draußen. Ja, Gott wohnt in Kirchen und Tabernakeln, aber nicht nur dort; ich kann ihn nicht räumlich einzäunen, wegsperren, für mich behalten. „Großer Gott, ganz klein.“(Kurt Marti) Der, den wir nicht umfassen können, begibt sich freiwillig in die Winzigkeit der Hostie und lässt sich doch nicht darauf festlegen. Dieses Geheimnis zu feiern, den Fronleichnam in unserer Mitte, den Herrn, der so wunderbar frei ist und nicht festgelegt, den wir an allen möglichen und unmöglichen Orten antreffen - das heißt, den uns in diesem Jahr verunmöglichten Gründonnerstag nachzufeiern und die österliche Brotbrechung zu begehen, an diesem Fest, wo Er uns müde und gotteshungrige Wanderer durch die Zeit besucht und wir ihn bitten: Herr, bleibe bei uns, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen
Kurt Josef Wecker
Sonntag, 07.06.2020 Trinitatis
Fürbitten
Gott des Himmels und der Erde, gib deinen Geist in unser Herz, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest und damit wir in rechter Weise bitten. Beten wir durch Christus in der Kraft seines Geistes:
Wir bitten für diese Welt, die an die Grenze geraten ist und angewiesen ist auf rettende und friedliche Auswege; dass wir uns nicht lähmen lasen von Schreckensmeldungen und den Mut zum Entscheiden und Handeln empfangen.
Wir bitten für diese Welt, in der Menschen jetzt schwer krank sind und auf Verstand und Fantasie, auf hilfreiche Hände und deinen heilenden Geist so angewiesen sind. Und für die Helfenden, dass sie behütet bleiben.
Wir bitten für die, die das Leben hart trifft, für alle, die den Mut und das Vertrauen und die Kraft zu beten verloren haben und die an keine gute Zukunft mehr glauben können. Gib dich ihnen zu finden.
Wir bitten für diese Welt, damit alles getan wird, damit unseren Kindern eine gute und friedliche Zukunft und ein wohnlicher Planet Erde ermöglicht wird. Bewahre die Schöpfung in deinen Händen.
Wir bitten für eine Welt und für die Menschen, die uns Mut machen, an dich, Gott zu glauben, die uns deine Zuneigung und Fürsorge, Gott, ahnen lassen; um Momente des Glücks und einen Vorgeschmack deines Himmels.
Wir bitten für eine Welt, in der immer noch Menschen durch Rassenhass diskriminiert und durch Krieg und Gewalt vertrieben, verletzt und getötet werden, besonders nun im Jemen. Und für die, die vor Krieg und Hungersnot fliehen. Falle den Gewalttätern in den Arm.
Wir bitten für die Menschen nun besonders in den Elendsgebieten und Megastädten in Indien und Lateinamerika, da, wo nun die Pandemie am schlimmsten wütet. Lass die Entscheidungsträger das Richtige für die Ärmsten der Armen veranlassen.
Wir bitten um Mut und Glaubwürdigkeit für deine Kirche. Öffne ihr die Augen für deine verborgene Gegenwart und lass sie Zeugin deiner oft fremden und unfassbaren Nähe sein.
Wir bitten um eine Welt, in der es bald wieder feierliche Gottesdienste und gemeinsames Gebet, frohen Gesang und die schönen Zeichen des gefeierten Glaubens an dich, Gott geben möge.
Wir bitten um dein Entgegenkommen und das Wunder der Auferstehung, um das Geschenk des ewigen Lebens für unsere Toten und alle Verstorbenen, deren Namen du allein kennst.
Dich dreifaltiges Geheimnis feiern wir, dich, Gott, der du so leise und schonend unter uns wohnst und dein verborgenes Zelt aufgeschlagen hast in unserer Mitte - und in unserem Innenleben. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen
kjw
Die Frage nach dem verborgenen Gott in der Coronazeit (Sonntag Trinitatis 2020)
Liebe Gemeinde,
der Sonntag der heiligsten Dreifaltigkeit stößt uns auf Gott. Wir sagen: Es ist gut, dass es dich gibt. Bevor wir Gott zu irgendetwas ‚brauchen‘, feiern wir: danke, dass Du da bist und wir durch dich sind. „Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott“, sagte der Historiker Leopold von Ranke. Auch diese Coronaepoche ist unmittelbar zu Gott. Darum müssen wir uns als Gläubige zu allererst fragen, was diese seltsame Zeit mit Gott zu tun hat und was Er mit uns macht. Ich weiß nicht, ob ich und die Menschen angesichts der Krise ansprechbarer geworden sind für das Evangelium. Gibt es irgendeine für uns verstehbare Botschaft, die uns Gott damit zukommen lassen will? Seine leise Sprache in der Pandemiekrise - nicht die Sprache eines zornigen strafenden Gottes, aber eines verborgenen Gottes, eines anstrengenden Gottes, der nicht nur zur Schönwetterphase des Lebens und zum festlichen „Tafelsilber“ der Kirche gehört, sondern der größer ist, fremder, unfassbarer, fragwürdiger… „Gott imponiert uns heute nicht mehr“, sagte Sloterdijk. Das ist das Problem! Das kann eine Antwort sein auf die Glaubenskrise. Bleibt uns in dieser Pandemiephase frommes Schweigen übrig? Oder Verlegenheit, weil ich Gott nicht als den flotten Problemlöser präsentieren darf. Vielleicht haben wir uns in all den Fürbitten und Gebeten dieser Tage gefragt: Könnte er in die Abläufe einer solchen Pandemie eingreifen und sie zum Stoppen bringen? Trauen wir ihm den direkten Eingriff zu, und dürfen wir das von Ihm erwarten? Kann Gott rettende Einfälle vom Himmel regnen lassen? So fragen wir, die wir uns ohnmächtig und hilflos erfahren. Auf einmal waren wir ja nicht mehr Herr unserer Lage. Wir haben eine winzige unsichtbare Macht, die uns alle bedroht, noch nicht im Griff. Will er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, der Fledermäuse und der Viren, die Welt mit der Zumutung dieser lautlosen Macht zur Besinnung bringen, dass sie verwundbar und schwerkrank ist, dass es Risse in der Schöpfung gibt, die nicht von Menschen verschuldet sind? Will er mich umerziehen und durch Erschütterung wecken, mich herausbrechen aus falschen Verstrickungen und fatalen Prioritätensetzungen? Will er mich zum Umdenken bekehren, dass es ‚so‘ nicht weitergehen kann mit meinem Lebensstil, auch mit der ungebremsten uferlosen Globalisierung (von der ich profitiere), mit dem Lebensstress, mit dem Motto: Jeder ist sich selbst der Nächste…? Das haben wir gelernt: Wir sitzen alle in einem Boot, manche im Kesselraum, andere auf der Komfortzone. Will ich diese Schicksalsgemeinschaft der Menschheit einsehen? Will er, durch den und in dem und mit dem alles ist, mich drängen zu mehr Demut und Einsicht in meine Endlichkeit und zur Annahme meiner Grenzen und der Zerbrechlichkeit all meiner Pläne und Wünsche und Träume? Will er mich bewegen zu einem gelassenen Umgang mit all dem, was ich für so selbstverständlich halte? Hat Gott das durch die Lektion dieser Wochen gewollt: dass wir allesamt besonnener, dankbarer, gesammelter, aufmerksamer leben, das Ende bedenkend, die Bedeutung unserer Grenzen ehrend? Will uns Gott also in dieser Zeit eine Lehrstunde erteilen, so dass sie zum Kairos wird, zur Entscheidungszeit an der Weggabelung? Sind wir so lernfähig und verbesserlich, so dass wir gereinigter aus der Krise herauskommen, solidarischer, empathischer, in der Not einander beistehend? Im Mittelalter har man nach Zeichen der Zeit gefragt, als 1348 wie aus heiterem Himmel die Pest aus Asien über das Schwarze Meer und die Häfen Italiens und Frankreichs nach Mitteleuropa kam; da war man schnell dabei, Antworten und Gründe zu suchen, wie das passieren konnte. Man sah die Pestepidemie als Strafe Gottes, als Vorbote des Gerichts, als Geißel. Und Gott malte man als jemanden, der Pfeile und Speere abschoss auf die Menschenkinder. Und darum brauchte man Maria und ihren Schutzmantel (als Schutzschild) und die Fürsprache der Pestheiligen Sebastianus und Rochus und Christophorus. Man sah die Pest als Aufruf zu Buße und Umkehr. Es war die Zeit der Pietà, der Andachtsbilder, zu denen man angesichts der Pestilenz floh. Vieles, was man vorher im Glaubensleben tat, intensivierte und steigerte man: die Heiligenverehrung, die Feier der Pestmessen, die Verehrung der Gnadenbilder, Wallfahrten, Prozessionen, Reliquienkult…. Damals wie heute waren Quarantäne, Reisebeschränkungen, bevorzugt Messen im Freien (wie im Mailand des hl. Karl Borromäus) Eindämmungsversuche. Der Lockdown angesichts der schleichenden Bedrohung brachte uns genauso wie den mittelalterlichen Menschen die Erfahrung: wir sind überfordert, wir werden von einer unsichtbaren Macht bedrängt, mit der wir nun leben und uns arrangieren müssen.
Aber noch einmal: Gott und das Virus? Haben wir bei all dem, was wir folgsam an Hygiene- Maßnahmen geleistet haben, Gott vergessen, ist er in der Umsetzung der Regeln verblasst. Haben wir als Kirche versucht, auch ohne ihn mit der Krise fertig zu werden? Ja, wir spüren, dass wir neuzeitliche Menschen sind, geben der Vernunft der Experten und dem Wissen der Epidemiologen das letzte Wort. Und doch wären wir sprachlos, wenn wir das Bekenntnis zur Allmacht Gottes außen vorließen. Was aber macht die Erlösungsbotschaft von Ostern in einer Welt, die sie nicht mehr braucht? Manche sagen, in diesen Monaten ging ein Kapitel der Geschichte des Christentums zu Ende. Gott, der für viele nicht notwendig ist, der nicht gebraucht werden kann für unsere Zwecke und Erwartungen. Uns holt die Wahrheit des dunklen Satzes Bonhoeffers ein, dass wir „ohne Gott vor Gott“ leben. Ihn müssen wir suchen in allen Dingen, nicht nur den schönen und hellen; ihn, den tief Versteckten? Was hat sein Geist in uns bewirkt? Hoffentlich haben wir eine Art Herdenimmunität entwickelt gegenüber weniger Wichtigem und sind trotz äußerer Distanz bleibend näher zusammengerückt. Brauchst du, Mensch, Religion in dieser Krise, wo wir den Virus nicht wegbeten können? Viele sind verstummt, vielleicht auch weil wir Bischöfe und Priester eher sprachlos wurden angesichts dessen, was uns überrollt. Gott ist manchem fremd geworden. Uns Kirchen brach die schöne Sonntagsgewohnheit weg, all die vertrauten Rituale der Verbundenheit, vieles Bewährte: gemeinsam vor Gott zu stehen, ihn zu feiern, ihn zu loben, ihm zu klagen. Vermissen wir es wirklich? Oder haben wir uns diese ‚Sonntagsheiligung‘ schnell abgewöhnt? Mühsam und zunächst auch mit unbefriedigend gestalteten Gottesdiensten müssen wir wieder zurückfinden „zur alten Liebe“. Denn auch die Erfahrung eines Verlustes wirkt ansteckend. Ratlosigkeit durchweht die Kirche pandemisch wie ein seltsamer Hauch. Man kann von dieser Anfechtung angesteckt werden, der bohrenden Frage, wozu wir Gott brauchen, ob Kirche notwendig ist, ob es nicht auch ‚ohne‘ geht? Viele haben Gott als den großen Unbekannten erfahren, als den „verborgenen Gott“, den „Deus absconditus“ (so erfuhr ihn Luther), ein bergendes Geheimnis und ein Abgrund. Und wir haben gespürt, dass es zu einfach ist zu sagen: Der „liebe Gott“ wird es schon richten. Jürgen Ebach, ein Alttestamentler, wagte den Vergleich: Der liebe Gott, das hört sich harmlos und verharmlosend an, so wie Frauchen und ein Hund, der mir kläffend entgegenkommt und mich anbellt - und sie beruhigt: „Der ist lieb, der tut nichts, der bellt nur…“
Mose ist nicht dem ‚lieben Gott‘ begegnet. Etwas von der wilden Fremdheit des Wüstengottes vom Sinai durchbebt die heutige Lesung (Ex 34,4-9): Mose, dem Gott begegnet auf dem sturmumtosten Gottesberg. Gott - nicht zu fassen, unbändig, nicht verfügbar, nahe und doch fern, nicht die Antwort auf meine Fragen, ohne festen Wohnsitz, nicht herbeizurufen, weil er so frei ist, von sich aus zu kommen, mir entgegenzutreten. Er ist Mose zugewandt und doch den Gottesmann zu Boden zwingend, sperrig und ungemütlich. Ein Gott, der mir nie gehört, dem wir nicht ins Gesicht schauen können. Der Salzburger Dogmatiker Gottfried Bachl, der vor wenigen Tagen starb, hat in seinem Gottesfragebogen formuliert: Ist es in der heutigen Zeit schwieriger von Gott zu sprechen, als zur Zeit des Moses? Man muss zu Gott den mühsamen Berg hinaufsteigen. Mose ruft Gott an und er schweigt. Oder er spricht so leise, dass ich in all meiner Geschäftigkeit nicht höre, so zart, so zerbrechlich. Und dann wirft sich Mose nieder und betet, stellvertretend tut er das, und nimmt betend Gott Willen und Gebote an. Er bittet Gott – um Gott, um seinen Atem, seine Verheißung seine Gegenwart in der Mitte dieser schwerkranken Welt, als Kopf seines kopflosen Volkes.
Kurt Josef Wecker
Pfingstgottesdienst aus Nideggen mit Pfarrer Kurt Josef Wecker am 31.05.2020
Pfingsten 2020
Kurt Josef Wecker, Pfarrer (Nideggen/ Heimbach)
Liebe Gemeinde,
Pfingsten 2020 feiere ich in diesem Jahr drinnen und draußen, Im Obergemacht von Schmidt und Nideggen - und auf einem freien Platz in Vlatten. Denn wir haben die Wahl, welcher Pfingsterzählung wir uns eher anvertrauen, in welcher Gestalt uns das Festtagsgeschenk erreichen soll: Gott ist frei; er atmet, lüftet, weht, windet, stürmt da, wo er will….
Wir haben dieses Pfingsten so nötig, denn viele sind verstummt, ratlos. Ist denn diese Welt ‚von allen guten Geistern verlassen‘? Manche sprechen von der Sprachlosigkeit der Kirche und der Kirchenführer in diesen Wochen.
Vielleicht entscheiden wir uns bei diesem schönen frühsommerlichen Wetter eher für das ‚Draußen‘. Da soll uns der Geist erreichen! Wir versuchen, uns live hineinzuschalten in den gewaltigen, unabsehbaren Geist-Event in Jerusalem, einem wunderlichen, plötzlichen beinahe ekstatischen Anfang. Es schien, dass im Himmel die Schleusen aufgegangen waren: ein mitreißender Einfall von oben, ein erschreckender und doch auch entsetzlicher positiver Aufwind, der nicht initiiert wurde durch Menschenhand; eine Motivationskraft, die zur Grenzüberschreitung führte, zu einer wie betrunken wirkenden, in jedem Fall ziemlich euphorisch wirkenden jungen Kirche, die anlässlich dieser Höhepunkterfahrung ausbricht aus ihren Schlupflöchern. Denn ein Sturm kam auf, der nie abgeflaut ist, der eigentlich auch dieses Gotteshaus so durch-schüttelt, dass wir danach den Dachdecker bestellen müssten angesichts der Sturmschäden am Dach, den ‚Dachschäden‘ auch an uns. Der Geist ist kein Lüftchen von gestern; er will ja uns durch-rütteln und uns auf Außenstehende wirken lassen wie geistvolle Betrunkene. Also: Keine falsche Bescheidenheit, auch wenn ich vielleicht erschrecke über meine eigene Kargheit, Leere, Renovierungsbedürftigkeit, meinen Kleinglauben, meine Zurückgezogenheit! Was für ein Enthusiasmus, den man vielleicht in den mächtig wachsenden Pfingstkirchen spürt - die gelöste Stimmung einer Gemeinde, die außer Rand und Band gerät, die das Außerordentliche liebt und sich in diesem Geistbesitz genießt.
Oder steht mir eher der stille Weg ins ‚Drinnen‘ näher, der uns ohnehin wochenlang in der Pandemiekrise nahegelegt wurde, die exklusive Gruppe im Obergemach, das unaufdringliche Sich-in-den Weg-Stellen Jesu, die lautlose Mund-zu-Mund-Beatmung der Jünger durch den Überraschungsgast Jesus, der die dicke Luft einer geschlossenen Gesellschaft zu einer gelösten Atmosphäre verwandelt. Wenn Er kommt, gibt es Durchzug, ein Durchlüften, keine stehende Luft. Pfingsten, da lassen wir uns den Atem Jesu gefallen, seine heilbringenden „Aerosole“ gegen den Todes- und Pesthauch der Welt. Durchlüften von Räumen ist neben dem nur verhaltenen Singen die Empfehlung der Virologen gegen gefährliche Aerosole. Die Luft, die durch die Orgelpfeifen geht und die die Orgel ‚singen‘ lässt, muss uns genügen. Ohnehin gilt bei aller Inbrunst des Singens: Jesu ‚In-Erscheinung-Treten‘ kann niemand herbeizwingen, herbeidenken, nicht einmal herbeibeten, herbeisingen... Jesu Kommen geschieht nicht auf Zuruf, ist nicht plakativ, sondern lautlos und verborgen. Nein, Pfingsten ist nicht auf den Begriff zu bringen, nicht in einen Evangeliumstext hinein zu pressen. Pfingsten schießt über und ist Ausdruck göttlichen Überflusses!
Ein gewagtes Bild in diesen Tagen; doch das ist die Wirkung des Auferstandenen: „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe…“ Christus ist ‚ansteckend‘, und er fand Menschen, die mit ihrer Glaubensfreude ansteckend gewirkt haben. Gott ist ein Erreger, eine Kraft der Veränderung, er durchweht ‚pandemisch‘ den Makrokosmos und meinen Mikrokosmos. Der Jesus-Virus, diese ansteckende, mitreißende Kraft des Himmels, steht allen offen. Es könnten jeden erwischen. Ich und du – wir könnten dazugehören; er macht Menschen ‚heiß‘, Die pfingstliche Geistausschüttung und der göttliche ‚Funkenschlag‘ machen alles neu; alles wird durcheinandergewirbelt. Diese Kraft ist systemsprengend und verwandelt 11 ängstliche Jünger im stickigen Obergemach zu Jerusalem zu ‚systemrelevanten‘ Zeugen und Weltreisenden in Sachen Evangelium. Von Gott her weht auf einmal ein ganz anderer Wind, der die Lebensgeister weckt oder der sich mit unseren Lebensgeistern verbindet; ein heiliges Geben und Nehmen, ein Ein- und Ausatmen, eine wie aus heiterem Himmel geschenkte Lebenskraft, ein Gast der bleibt (anders als die Weingeister und Poltergeister dieser Welt, die kommen und gehen).
Wir können nie aus dem Umfeld dieses Atems Jesu herausfallen, auch wenn wir uns ihm verschließen können. Wenn wir es versuchen, wenn wir im Alleingang leben und denken und nichts Gutes mehr vom anderen erwarten, dann kommt nicht viel Gutes dabei heraus, dann denken wir schlecht von Gott und der Welt, dann nehmen meine Gedanken ein Gefälle, einen Abwärtstrend ins Negative und Trübe, dann schleichen sich Misstrauen und falsche Vermutungen ein, dann fallen Türen zum anderen ins Schloss, dann gebe ich Gott keine Gelegenheit, mich zu stören und zu unterbrechen, sich in mein Denken einzumischen. Dann versuchen wir das Unmögliche, Alleingänge: ohne Gott klar zu kommen und zu denken, mit uns allein zu sein. Wir vergessen, dass wir uns unentrinnbar in ihm bewegen. Der Geist ist etwas Merkwürdiges. Denn wir sehen ja nur uns – zerbrechliche, eher ernüchterte, gebeugte Geschöpfe, die wir Gefäße des Heiligen Geistes sein sollen. Wir sind sichtbar, doch der, der uns erfüllt, uns bewohnt, denn sehen wir nicht.
Vieles, was uns gefährlich werden kann, sehen wir nicht. Es liegt in der Luft und wird eingeatmet; dazu zählen auch schlechte Stimmungen, vergiftete Atmosphären, Gerüchte… Aber auch das heilbringende Fluidum Gottes sehen wir nicht. Und doch ist es da, verteilt sich drinnen und draußen. Es ist die Kraft, die kam und kommen musste, als Jesus sich zurückzog in die Verborgenheit.
Beides gilt: die stürmische, impulsive, überschäumende Seite des Pfingstgeschehens und der unerlässliche Atem Jesu, der die junge Kirche und auch uns jetzt leben und beten und glauben lässt. Dem einen kommt der Geist verstörend vor, wild und zu tollen Aktionen hinreißend, den anderen macht er eher still und horchend, erwartungsvoll. Im einen wirkt er eher flüchtig, im anderen nachhaltig; den einen entspannt sein Kommen, den anderen reißt er mit. Wir alle leben von diesem Sturm und Atem. Gäbe es diese Bewegung nicht, wie könnten wir uns auftun und zu Gott eine Beziehung aufbauen? Gäbe es ihn nicht, dann fiele uns nichts ein, nichts auf; dann blieben wir die Alten, würde uns keiner zum Vergeben und Schenken bewegen, dann blieben wir starr und unveränderlich, unwandelbar, dann gäbe es kein Empfangen und keine Resonanz. Wer legt uns also die Worte in den Mund, wenn wir leer-gesprochen sind, wenn unsere Verständigung vom Misslingen und Missverstehen bedroht ist, wenn wir hartnäckig schweigen, wo wir reden sollten, als seien wir mit Stummheit geschlagen und nicht mit dem Taufwort „Effata!“ geweckt und geöffnet worden. Wer gibt ein Reden, das befreit, Klarheit schenkt, dass wir Auskunft geben können über das, was uns im Glauben bewegt; wer schenkt eine Grundstimmung (einen „Teamgeist“), die uns alle an einem Strang ziehen lässt...? Wer lässt mich weiter schenken – ohne Berechnung -, was mir selbst nur als Geschenk zukommt. Der Heilige Geist ist Gabe für alle, keine private Auszeichnung, sondern Talent, das wir nicht vorsichtig deponieren, sondern mutig investieren sollen; eine Gabe, die nur im Teilen und auch im ermutigenden Delegieren da ist und unter die Leute kommt. Ein Funkenschlag vom Himmel, der bewirkt, dass die Freude am Glauben in mir brennt; ein Reichtum, den wir nicht leisetreterisch verstecken sollen wie eine Reliquie oder einen Museumsschatz. Im Ausüben der Talente, die wir fruchtbar gebrauchen und anlegen sollen im Dienst am Nächsten, bezeugen wir den, der sie sie uns schenkt. Gottes Geist können wir nicht in Sicherheit bringen und für alle Fälle auf die hohe Kante legen. Es ist eine uns anvertraute Gabe, die sich verteilen will.
In jedem Fall galt: Es musste etwas geschehen. Wir sind atem-bedürftig. Nicht erst in diesen Coronatagen spüren wir sie, die Lücke, die Armseligkeit, die Leere. Es muss eine Hilfe kommen, eine Energieversorgung sichergestellt werden, eine Ressource erschlossen werden, eine Antriebskraft gezündet werden, die nicht von dieser Welt ist, die nicht unter uns entdeckt und angebohrt werden kann wie ein Gasfeld unter dem Meer. Es muss sich eine unsichtbare Kraftquelle auftun, die erklärbar macht, dass wir heute als atmende Menschen hier sind, als Christen glauben und beten. Eine Kraft, die uns die Ohren und Herzen öffnet für das Unerhörte von Ostern, die mehr ist und gibt als das, was wir zu hoffen wagen und uns gewünscht hätten; ein Fluidum, das uns umhüllt und unterfasst, uns trägt, durchdringt und berührt, inspiriert, verblüfft und nachdenklich macht und das doch nicht mein Geist ist, sondern eine Größe, die uns überwölbt. Haben wir uns in vielleicht einsamen Coronatagen gefragt: Wer lebt in mir? Wer gibt mir Einzigartigkeit, lässt uns zu guten Einfällen kommen, bewegt uns heute, hier zu sein, auszuhalten, nicht aufzugeben? Wer bestimmt mein Leben, erwählt mich zu seiner Eigentums- und eben nicht Mietwohnung? Wer übt einen prägenden Einfluss auf uns auf, bringt in mir Neues hervor. Pfingsten gestehen wir uns ein: ich und du – wir können diese Lücke nicht füllen. Niemand von uns kann die Lücke füllen, die der Weggang eines anderen Menschen, vor allem dessen Tod, reißt. Auch wenn wir vielleicht Techniken entwickeln, diese Lücke schönzureden. Oder die Lücken, die sich z.B. in diesem Kirchenraum auftun, vor allem die Lücken im Gedächtnis, die Lücken, die der Tod reißt. Pfingsten ist eine Antwort des Himmels auf eine Lücke, die wir Ratlosigkeit nennen, Ahnungslosigkeit, Verlegenheit - angefangen von der größten Krise, die die Kirche zu bewältigen hat; dem Fehlen Jesu, seines Körpers am Ostermorgen und dann angesichts seiner Rückkehr in die Verborgenheit seines Himmels, in die Nähe zum Vater. Empfinden wir diese Lücke? Schmerzt sie uns, vermissen wir Ihn, seine sichtbare Nähe? Reicht uns diese seltsame Gegenwart in der Hostie, diese reine Unscheinbarkeit, die nach nichts schmeckt und in der doch alles drinsteckt?
Die arme Gestalt der Hostie und vielleicht auch unsere arme und ratlose Christenheit stehen ja in Spannung zum Überfluss-Geschehen des Geistfestes, dieser Ausschüttung der Gottesenergie. Wir könnten darangehen, diese Lücke eigenmächtig aufzufüllen. Wir brauchen weder Christus noch den Geist; wir sind unseres eigenen Glückes Schmied und schauen, wie wir mit der eigenen Geisteskraft klarkommen. Das kann nur in dem enden, was man „Burn out“ nennt, die totale Überanstrengung, Übermüdung, Unlust. Ohne den fremden Geist Gottes, ohne dieses Multitalent, diese hochbegabte Gottesenergie, wären wir nicht Herr unserer Sinne; aber auch mit dem Geist gilt: Wir sind nicht Herren im eigenen Haus; wir werden bewohnt, besucht von einem fremden Gast, der kommt und bleibt, der bittet, der sich breit machen möchte in uns, zwischen uns. Der unersetzbare Geist, der das eigentlich Unsagbare sagbar und glaubhaft macht: Der Tote lebt. Christus will in uns einziehen, sich in uns hineinatmen. Warten wir auf den, den wir nicht haben, den ich auch nicht sofort und auf Abruf einfach bekomme. Warten wir auf rettende Einfälle, kleine Vorzeichen der großen Rettung und auf die kleine Brotzeit, in der uns ein Vorgeschmack der schönen Beschwerung bereitet wird. Amen
Kurt Josef Wecker
Hl. Messe am 7. Sonntag der Osterzeit mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Mt 28, 16-20 Predigt zu Christi Himmelfahrt A, Trinitatis C und 7. Ostersonntag im Coronajahr 2020
Von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen/ Heimbach)
Heute ist „Matthäi am Letzten“ - so nennt Luther im 4. Hauptstück des Katechismus (wo es um die Taufe geht) die letzten Verse, die Schlussszene im Matthäusevangelium. „Da unser Herr spricht Matthäi am letzten“. Wir nutzen diese altertümliche Wendung, wenn wir sagen wollen: Wir müssen das Schlimmste erwarten, sind am Ende, finanziell oder gesundheitlich. Das Ende aller Dinge ist gekommen. Die Lage ist aussichtslos, wir sind kurz vor dem Ruin, der Katastrophe, dem Weltuntergang. Nun ist der Anfang vom Ende gekommen. Steht es wirklich schon so schlimm, ist wirklich Matthäi am Letzten? Das dicke Ende, o weh! Lasst alle Hoffnung fahren! Schluss mit lustig! Wir stehen an der Grenze, gar am Abgrund. Weltuntergangsstimmung macht sich breit.
Irgendwie fühlen wir uns wie ‚zwischen den Zeiten‘, nicht nur im Kirchenjahr, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, in diesem seltsamen Vakuum, an das uns der Evangelist Lukas denken lässt. Als hätte es in der lukanischen ‚Zeitrechnung‘ zehn christuslose und geistlose Tage in der Kirchengeschichte gegeben! Dese Erfahrung paart sich 2020 mit dem Gespür, dass vieles ‚danach‘ nicht mehr sein wird wie ‚davor‘, dass durch einen unsichtbaren Virus und die Gefahr, die von ihm für die ganze Menschheit ausgeht, eine Zäsur gesetzt wird, die unsere Welt womöglich nachhaltig ändern wird; ein grundstürzendes Ereignis, das mich morgen nicht mehr so leben lässt wie gestern. Und dabei hat die Wendung bei Luther einen guten Klang. Eine solche Bedeutungsverschiebung gibt es auch bei dem Wort „Heimsuchung“, das wir als Redensart eher negativ besetzt verwenden. Die wenigsten denken daran, dass Luther damit den Besuch, die freundliche „Heimsuchung“ Elisabeth durch Maria, diese heilsame Heimsuchung, der leise Nachklang des unwiderruflichen Besuchs Gottes in Christus, mit dem Er, wie es Kardinal Walter Kasper ausdrückt, „eine Pandemie der Liebe“ einläutet…
Heute also ist Matthäi am Ende, das große Schlussbild des ersten Evangeliums. Nichts Bedrohliches und Beunruhigendes schwingt mit, keine Strafpredigt, keine Ankündigung des Jüngsten Gerichts oder des Zornes Gottes. Wir hören das Schlusswort. Letzte Sätze haben es in sich - im Roman, im Evangelium, im Leben eines Menschen. Die „letzten Worte Jesu am Kreuz“ wurden von vielen Komponisten vertont und von Heiligen betrachtet. Letzte Worte - da klingt etwas aus, verhalten oder mit einem Paukenschlag, lapidar oder als großes Finale, abschließend oder öffnend, als Schlusspunkt oder eher mit Semikolon.
Wie hört Christus auf? Ist es der Augenblick kurz vor seinem Verschwinden, dem Aufhören seines Wirkens? Wie bringen Menschen das Erzählen über ihn ans Ende? Es wäre eine schöne Betrachtung wert, welchem Evangelisten die schönste „Ouvertüre“ und das eindrucksvollste „Finale“ gelingt. Ja, welcher Evangelist setzt den besten, den wirkungsvollsten Schlusspunkt, macht also am meisten Lust, das Evangelium erneut zu lesen, am besten von Anfang an? Wer von den Vieren entlässt uns am erwartungsvollsten? Es ist eine Kunst, ein gutes Ende zu finden! Ein trauriges oder ein glanzvolles Ende, ein lapidarer Schluss oder ein Paukenschlag? Matthäus hört aus Jesus Worte heraus, die nachhallen und uns Beine machen, das ist kein trauriges Ende, das uns ratlos, mutlos und tatenlos zurücklässt. Matthäus gelingt das Kunststück eines Abschlusses, der uns zugleich nach vorne blicken lässt - als würden wir die Aussicht von einem hohen Berg genießen. Er weckt die Vorfreude auf das, was kommen mag und wie Jesus fortan mit seiner Kirche umgeht.
Der Evangelist Matthäus bezeugt ein offenes Ende, das an eine Fortsetzungsgeschichte denken lässt. Die große Verheißung und das letzte Wort Jesu, das so anders klingt als bei den anderen. Jesus geht nicht weg, sondern er kommt zum Vorschein: Er tritt (woher?) aus der Verborgenheit zu den Seinen, die von seiner Anwesenheit überrascht werden. Er macht nicht viel Aufhebens um seine Erscheinung. Das Drumherum der letzten Ostererscheinung im Matthäusevangelium ist kein Thema. Der Herr tritt zu Menschen, die ihn zwar sehen, aber trotzdem zweifeln. Und dieser Zweifel macht sie zu unseren Zeitgenossen. Man kann Ihn sehen – und zweifeln zugleich! Wichtig ist nicht das Sehen seiner Erscheinung, sondern das, was er spricht: Am Ende verspricht Jesus allen Ernstes, er werde nicht in den Himmel auffahren, sondern in die Kirche einfahren - also in diesen müden Haufen von elf mehr oder weniger zweifelnder zwiespältiger Jüngern, die er auf irgendeine Höhe fernab von Jerusalem, auf einen namenlosen, ortlosen Berg in Galiläa bestellt hat. So bekamen es ja auch die Frauen am leeren Grab zu hören: Sucht ihn anderswo, da, wo alles anfing, in Galiläa! Geht bergauf! Und oben, auf der Höhe, bekommen die Jünger hören, dass sich Jesus nicht in einen ‚Himmel‘ entfernt und abgesetzt hat, nein, dass er dabeibleibt; dass er seiner Kirche immer vorausgeht. Ohne ihn vermögen diese elf Männer nichts. Wir kennen die Vorliebe Jesu für Berge. Wenn es ernst und wichtig wird, wenn alles auf dem Spiel steht, da sind es Gipfelereignisse. Bei Lukas ist der Berg, der Ölberg wohl bei Bethanien nahe Jerusalems, der Berg des Abschieds. Bei Matthäus ist das Schlussbild ein namenloser Berg, auf dem er kommt. Bei Lukas eher ein Loslassen, bei Matthäus eher ein verheißungsvoller Neubeginn, neue Umgangsformen Jesu für die nachösterliche Gemeinde. So oft ich in Galiläa war - dieser Ort wird von den Pilgerführern nirgendwo exakt lokalisiert: Kommt der Berg der Verklärung in Frage, der ja zusammen mit den drei anderen Bergen, dem Berg der Versuchung und des einsamen Gebets und der Bergpredigt, eine so wichtige Rolle in der Jesusgeschichte spielt?
Es muss offenbleiben - so offen wie der Schluss des Matthäusevangeliums, dieser Blick ins Offene, ins Weite, in die Fortsetzungsgeschichte. Gute Regisseure beherrschen die Kunst, Aufmerksamkeit zu wecken, damit am Schluss die Spannung erhalten bleibt: bei spannenden Spielfilmen oder auch Endlosserien. Die Filmemacher nennen das „Cliffhanger“, Man bricht erst einmal ab, wenn es am schönsten oder dramatischsten wird und die Zuschauer süchtig fragen: wie gehst weiter? Denn am nächsten Tag sollen sie ja wieder einschalten und dran bleiben in der Endlosschleife einer Telenovela, den Daily Soaps, auch den anspruchsvollen Serien und Staffeln. Uns packt die Neugier, wie’s wohl weitergeht. Die Lust am Wiederanschalten muss geweckt werden.
Bei Matthäus (eigentlich bei allen vier Evangelisten) ist das Ende offen. Doch charakteristisch für den ersten Evangelisten ist: Matthäus kennt streng genommen keine Himmelfahrt Jesu, eher das Gegenteil. Jesus taucht auf, lässt sich sehen, wird zum ‚Herabkömmling‘, lässt den Zweifel einiger der Jünger zu, ohne ihn zu kommentieren. Jesus ist keiner, der zu guter Letzt Vorwürfe macht und Moralpredigten gegen Glaubenszweifel hält; er übergeht den Zweifel der Seinen, auch den Zweifel an deren eigenen Möglichkeiten, diesen Selbstzweifel, der bis heute an mir und an der Kirche nagt. Weniger die Art, wie Er erscheint, ist wichtig als das was Er sagt. Er gibt sich nicht zu berühren, hält also Abstand, aber er verteilt Aufträge, gibt große Versprechungen und schickt die Elf auf Weltreise. Er erzählt ihnen, wenn es zu „Matthäi am Letzten“ kommt, nichts von Weltuntergang, Apokalypse und Jüngstem Gericht. Er öffnet den Elf am Ende einen Weltraum! Die ganze Welt, alle zu Jüngern wandeln…? „Das ist ein zu weites Feld“, so endet Fontanes Effi Briest. Ist diese Aussendung, um alle Völker durch Taufe und Lehre zu Jesu Jüngern zu machen, auch „ein zu weites Feld“? Ist diese übermenschliche Aufgabe überhaupt leistbar und wünschenswert? Haben die Elf in diesem Moment überhaupt verstanden, was Er ihnen zumutet und zutraut? Die Kirchengeschichte ist die Fortsetzungsgeschichte dieses offenen Endes. „Christus als Gemeinde existierend“, so lautet die berühmte Wendung Dietrich Bonhoeffers. Die nachösterliche Gemeinde darf sich von Ihm angesprochen und ermutigt fühlen. Er teilt seine Macht, gibt uns endlichen Menschen Anteil an den göttlichen Möglichkeiten. Das große Pfingstgeschenkt klingt an. Die Gemeinde, die sich fragt, ob sie noch systemrelevant ist und die sich damals wie heute fragt: Was kann ich leisten? Wo bist du, Gott? Welche Möglichkeiten haben wir in dieser Coronaphase und was bleibt von uns - danach? Werden wir gebraucht, oder geht’s auch ohne uns? Dieser Zweifel ist nie überwunden; er hockt in uns wie in der unscheinbaren Schar der elf Männer, mit der die Evangelisierung aller Welt anfangen soll.
Diese Stunde der Messfeier ist für uns wie eine Bergbesteigung. Wir werden in dieses offene Ende, in den neuen Anfang hineingezogen. Ja wie gegenwärtig ist der Auferstandene in seiner Kirche, die gedrückt und runtergezogen wirkt von so viel Erdenschwere, die manche als sterbende, überlebte, überflüssige Institution wahrnehmen, als sturmumtostes Boot verzagter und kleingläubiger Besatzungsmitglieder, die es kaum für möglich hält, dass Er mit an Bord ist…
Der leere Raum der Kirche in der Pfingstnovene, trocken wie ein Schwamm, angewiesen auf die Ausgießung der Gnadengegenwart Christi. Mehr denn je braucht sie den Glauben an diese Verheißung, die er zu guter Letzt gibt: Ich verschwinde nicht, bin gar nicht weggegangen; ihr werdet mit mir nie fertig, bringt mich nie hinter euch; ihr könnt mich nicht abschütteln und euch als meine Ersatzmänner betrachten; mein Werk auf Erden ist eben noch nicht vollbracht. Noch sind nicht alle Wünsche erfüllt. Die Zeit der Wunder geht weiter. Ich bleibe euch auf der Spur, in bleibe in eurer Mitte, ich bin der Schnellere. Ich verleihe euch Vollmacht, nicht nur dir, Petrus; nein: euch allen, die ihr keine Elitetruppe seid, sondern ein armseliger zweifelnder Haufen, ein seltsamer Elferrat. Er rückt uns auf den Leib, lässt uns nicht mehr los. Ihn kann ich nicht abschütteln! Das ist das Ungeheuerliche, was Jesus zu guter Letzt verspricht, sich verspricht, seine Präsenz bis zu der Welt Ende. Er übernimmt in der Kirche das Regiment, er hat das Sagen auch nach seinem Weggang zum Vater. Christus in seiner Gemeinde gegenwärtig. Ihr Jünger Auf! Startet durch – mit mir und geht auf Sendung. Und ich, euer Christus, bin live dabei.
Kurt Josef Wecker
Hl. Messe zu Christi Himmelfahrt am 21.05.2020 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
FÜRBITTEN CHRISTI HIMMELFAHRT 2020
Christus, du erhöhter Herr, du sitzt zur Rechten des Vaters und zugleich bist du mitten unter uns. Sei unser Fürsprecher und trage unsere Bitten in das Herz des Vaters:
Für deine Kirche, die in den Sakramenten die bleibenden Spuren deiner Nähe feiert und deine verborgene Nähe bezeugen darf. Lass sie leben aus dieser Quelle und dich in dieser unübersichtlichen Zeit bezeugen unter deinem offenen Himmel.
Für alle, die dich angesichts der Pandemiekrise und ihrer Folgen aus dem Blick ihres Glaubens verloren haben. Für alle, die leben, als sei die Welt sich selbst überlassen. Für die, die nicht über den Tod hinaus hoffen. Und für die, die angestrengt und verzweifelt versuchen, sich den Himmel auf Erden zu schaffen.
Für alle, die dich suchen und deinen Segen vermissen. Für unsere Kinder, die dich in diesen Wochen zum ersten Mal unter dem Zeichen des Brotes gekostet hätten und deren Fest mit dir verschoben werden musste. Gib ihnen ein sehnsüchtiges Herz, bewahre in ihnen die Vorfreude und lass sie ihre Suche nach dir nie abbrechen.
Für die Mächtigen dieser Welt. Wir alle wurden an die Grenzen unserer Möglichkeiten gebracht. Denn deine Welt ist vielerorts schwerkrank. Lass die Entscheidungsträger die Grenze ihrer Macht erkennen und bei ihren folgenschweren Entscheidungen nach deinem Willen fragen.
Für alle, deren Nähe uns den Himmel erahnbar macht; für alle die noch staunen können und vor Gott auf die Knie gehen. Für alle, die unseren Blick zum Himmel lenken und die, die uns zum Segen wurden.
Für unsere Toten. Schenke auch ihnen eine Himmelfahrt. Lass sie jetzt am Ziel ihres Lebens in dir für immer glücklich sein.
Herr Jesus Christus, in dieser Stunde öffnet sich den Himmel über uns. Du fährst ein in unsere Mitte, unter Brot und Wein. Lass uns in der Kraft dieser verwandelten Gaben hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
kjw
Christi Himmelfahrt in Coronazeiten Apg 1, 1-11
Predigt von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen/ Heimbach)
Liebe Gemeinde!
Soziale Distanz ist eines der 10 Gebote in Coronazeiten. „Du sollst nicht schütteln deines Nächsten Hand“ „Liebe deinen Nächsten -aber komm ihm nicht zu nahe!“ „Übe dich in liebevoller Distanz!“ „Du sollst nicht küssen und umarmen, denn der Virus kennt kein Erbarmen!“, solche Gebote haben evangelische Gemeinden mit etwas Augenzwinkern formuliert.
Ein Pathos der Distanz ist angesagt. Manche achten energisch auf die Einhaltung der Regeln und stellen dabei auch durchaus aggressiv andere an den Pranger, wenn diese sich nicht an die Spielregeln der sozialen Distanz halten und Gefährdungsverhalten an den Tag legen. Geboten ist also der Verzicht auf alle Vertraulichkeit, auf Handschlag. Umarmung, das Flüstern ins Ohr, aufs Anrempeln in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aufs Drängeln in den Warteschlangen, aufs Abklatschen beim Abschied…. Wir üben uns ein in anmutigere und nicht so handgreifliche Formen des diskreten Grüßens, wie man es aus Japan oder Indien kennt. Erstaunlich rasch fanden die meisten zur neuen Normalität, die Regeln des sozialen Miteinander sind festgelegt, man pflegt nur Nähe zur engen Familie und Hausbewohner. Auch zum Heiligen geht man auf Abstand, komplizierte Regeln des Kommunionempfangs werden erlassen. Manche sprechen vom „Zangenmahl“ - , in der Orthodoxie gibt es Diskussionen über das Kommunion-Löffelchen in Rumänien, über das Küssen von Ikonen in Russland…Und mancher Promi aus Politik und Sport gerät ins Fadenkreuz, wenn er sich unbeobachtet wähnt, unbedacht diese Abstandsregeln bricht und jemanden öffentlich zum Abschied umarmt. Auf die richtige Entfernung kommt es ab, etwa 1,5-2 m soll man voneinander Abstand halten. Regelabstand mit Messband: ob es bei Liegestühlen und Strandtüchern im Süden ein Meter sein wird oder bis zu 5 Metern, darüber streiten sich die Experten. Eine permanente soziale Distanz ist genauso unerträglich wie das Gegenteil: Menschen, die uns buchstäblich „auf den Leib rücken“. Unerwünschte Nähe und das momentan wahrhaftig nicht angebrachte Bad der Prominenten in der Menge – das wäre momentan aufdringlich, unverschämt, manchmal bedrohlich. Bleib mir vom Leib! Und auch in normalen Zeiten signalisiert man mit 2 m Distanz, dass man keinen allzu nahen Kontakt möchte. Und eine ungebührliche Nähe wird zur Drohgebärde, zum Ausdruck von Macht. Machthaber lassen zu, dass sich ihre Untertanen nur kontrolliert annähern dürfen. Vorposten sorgen dafür, den Zugang zu den Mächtigen und Einflussreichen zu erschweren und zu kanalisieren. Wobei auch Distanz, die man einfordert, Ausdruck von Macht und Hierarchie ist, ein Autoritätsgefälle, manchmal auch von Arroganz, der Aura der Unnahbarkeit. Anthropogen sagen, dass etwa 50 bis 75 cm die richtige Entfernung für 2 Menschen ist, die miteinander ungezwungen kommunizieren möchten. Soweit sind wir noch nicht….
Man könnte meinen: Christi Himmelfahrt ist das große Finale. ER geht auf Distanz, zieht nun einen Schlussstrich. Mit Ostern nahm die Geschichte Jesu ein gutes Ende, und die Frage stellt sich: Wie geht’s weiter? Geht’s noch weiter? Ist Jesu Weggang der Anfang vom Ende? Heute lernt Kirche das Loslassen oder/ und den Neubeginn. Das Fest heute ist auch der Versuch, die Kunst des Aufhörens zu zelebrieren. Es ist Zeit für bohrende Fragen. Wird er nun aufhören, weil alles getan ist? Wäre nicht noch so vieles zu tun? Ist Sein Rettungswerk auf Erden wirklich vollbracht? War es wirklich Zeit für Ihn zu gehen…? Im Hollywoodfilm würden im Schlussbild großer Filme eingeblendet: The End. Abspann, fertig. Und soweit es keine Serie ist, dann war’s das; ein Happy End oder eben ein böses Ende. Im Märchen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In der Oper fällt der Vorhang, Applaus. Am Ende der Fernsehsendung: Macht’s gut, wir sehen uns, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und Tschüss…
Letzte Sätze und Handlungen sind schwer, wie der Ausstieg aus dem Lockdown. Anfangen mit dem Aufhören kann man; schwer ist es, mit dem Aufhören aufzuhören und neu durchzustarten. Christi Himmelfahrt hat es schwer, denn wer versteht es schon?
Ich weiß nicht, ob wir Meister im Umgang mit Beenden und Neuanfangen sind, ob wir uns auskennen mit Loslassen und Abschiednehmen, mit Zäsuren und Brüchen und Krisen, mit dem Spiel von Nähe und Distanz. Drei der Evangelisten machen kein Aufhebens von Jesu Weggang, allein Lukas gestaltet Jesu Himmelfahrt aus, sein Winken, seine Entfernung – und dabei seinen Segen, der deutlich macht: Hier wird kein Abschied für immer inszeniert, kein Nachklingen, kein Adieu vor dem endgültigen Verschwinden. Seltsam: Die Jünger bitten und betteln Jesus nicht an um das mögliche Aufschieben seines Weggangs. Niemand liegt ihm mit der Bitte im Ohr: Bleibe, bleibe doch noch ein Weilchen, gehe nie weg von uns…
Ein gutes Ende auch eines Romans, eines Films ist unabgeschlossen, auch wenn sich das seltsam anhört, eher ein Übergang, ein Atemholen. Wir wissen es aus Partnerschaftskrisen: Manche Trennungen enden im Desaster; lautstark oder sich totschweigend geht man auf Distanz; andere Abstandnahmen gelingen harmonisch, ohne „Rosenkrieg“, reibungslos. Trennungszeit.
Ich weiß nicht, ob die Kirche jemals über das hinwegkommen darf, was zu Himmelfahrt geschieht. Es ist ein schwieriges Fest von richtiger Nähe und notwendiger Distanz, von Abschied und neuer Annäherung. Wenn wir Christi Himmelfahrt richtig verstehen, dann als eine paradoxe Ansage: Durch dieses Fest rückt uns Christus auf den Leib. Er fährt ein in alle Zeiten, in alle Orte, in Raum und Zeit und Ewigkeit, in die kleinen Zeichen von Brot und Wein. Er löst sich von einem ganz bestimmten Flecken Land, so heilig es ist; von einer ganz bestimmten Gruppe von Vertrauten, so lieb sie ihm auch sind. Für sie er nicht mehr greifbar, für die Freunde, die sich so sehr an seine körperliche Nähe gewöhnt hatten. Er tritt ein in eine Verborgenheit, die ihn auch für die Apostel nicht fassbar mehr macht. Dieser Weggang, dieses Ende, macht ihn so kostbar für alle Welt. Was wäre, wenn er immer in Palästina unter den Elf geblieben wäre? Nein, er ist so frei zu gehen. Und er will nicht, dass Trauer aufkommt über das, was war. Ja, wir sollen an ihm hängen, aber nicht wie an einer lieben Erinnerung, sondern an dem, der verborgen bleibt. Er ist der, der eben nicht seinen Rücktritt eingereicht hat. Nein, wir werden mit Ihm nie fertig!
Jesus, Du bist nicht zu halten, weil du uns nicht gehörst und weil wir dich nie unter unsere Kontrolle kriegen dürfen! Du bestimmst fortan selber, wo du auftauchst und wie du dich bemerkbar machst. Du gehst uns voraus, immer, nach Galiläa und an alle möglichen und unmöglichen Orte dieser Welt. Nur so bist du unser Allernächster! Jesus geht auf Abstand zu damals, um uns heute nahe zu sein, seiner Kirche präsent zu bleiben, vor allem dieser schwer verwundeten Welt, die die Erfahrung seiner Nähe gerade jetzt so bitter nötig hat. Nur weil es Himmelfahrt gibt, können wir an Ihn in unserer Mitte glauben, ist die Kirche wahrhaft der Raum seiner Realpräsenz. Kein Priester, kein noch so guter und heiliger Christ und Papst kann Ihn ersetzen. Er ist unersetzbar, auch wenn er geht.
Er wird aber nicht vom Feld genommen wie ein verletzter Feldspieler beim Ballspiel, für den jemand von der Ersatzbank nachrückt. Wir können uns seiner nicht entledigen wie eine Last, die wir hinter uns machen, um dann ‚irgendwie‘ fröhlich unverbindlich in ‚seinem Geist‘ weiterzumachen… Wir können ihn aber auch nicht anflehen: Verweile doch, lieber Jesus, so wie du immer warst, es ist so schön mit dir auf du und du, mit dir in Hör- und Greifweite. Indem Er geht, traut er uns auch einiges zu, er gängelt mich nicht. Denn wir dürfen nach diesem Tag nicht wie angewurzelt stehen oder wie in einer Zeitschleife hängen bleiben. Angela Merkel sagte einmal, sie denke eine Sache immer zuerst von ihrem Ende her, bevor sie eine Entscheidung trifft. Und wer bei einer der vielen Endlosserien im Fernsehen motiviert werden soll, wieder einzuschalten, süchtig nach Fortsetzung, der braucht ein gutes Ende, einen „Cliffhanger“, wie die Filmemacher sagen, kein Schlusspunkt, eher ein Semikolon; ein offenes Ende, das Lust macht, neugierig zu sein, wie’s nun weitergeht.
Und wie es weitergeht! Er fährt ein in uns, auch in diese recht leeren Räume, die ratlose Kirche, die schwerkranke Welt, in die Hostie, in uns, die wir ganz neue Formen des Gottesdienstes und der Gottesnähe erproben.
Nein, das ist das Gegenteil von sozialer Distanz, von Abstandsregel. ER darf sich darüber hinwegsetzen! Er ist der Allergegenwärtigste. Er ist der Allernächste. Amen
Kurt Josef Wecker
Hl. Messe am 6.Sonntag der Osterzeit mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit A in der Coronazeit über Joh 14, 15-21
von Kurt Josef Wecker, Pfr. Nideggen/ Heimbach
Liebe Gemeinde, das ist das Szenario in vielen Pfarrkirchen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist überschaubar, in diesem Obergemach und auch in dem auf dem Zionsberg in Jerusalem. Da hocken sie, die zwölf Apostel, in ihrer freiwilligen Quarantäne, einer selbstgewählten Selbstisolation, vor Ostern, in einem angemieteten Raum und hören sich eine lange Predigt ihres Herrn an. Vermutlich hatte dieser Raum ein Fenster nach draußen; denn für Juden ist wichtig: wenn man drinnen betet, soll zumindest ein Fenster, eine Öffnung nach draußen, Lichteinfall von draußen möglich sein. Gemischte Gefühle im Obergemach, im Abendmahlssaal, eher Kyrie eleison als Halleluja. Eine Trostgemeinschaft; Männer, die sich fragen: Was steht uns noch bevor? Männer, die sich vermutlich nicht um die Einhaltung eines Mindestabstands zu Jesus scheren und sich an seine Stimme klammern. Männer, für die dieser Raum zum Ort des Zweifels wird, die sich vor und nach Ostern darin einschließen und ausschließen vor der bösen Welt: oder in Erinnerung zurückgehen in die schöne Zeit mit dem Nazarener in der Weite Galiläas. Ach, wie schön war Galiläa… Zeitreisen, wie wir sie auch zuweilen in diesen Tagen unternehmen an Orte, wo es schön war…
Das Evangelium versetzt uns in den Gründonnerstag. In der Stunde vor Jesu Auslieferung hocken die Jünger also zusammen, zwischen banger Traurigkeit und Freude, dass Jesus noch bei ihnen ist. Immerhin: vor Ostern ist ihr Herr noch dabei. Und nach Ostern, am Osterabend - keine fröhliche Zurückgezogenheit, sondern Absonderung, eher eine selbstauferlegte Ausgangsbeschränkung; da kann der Lagerkoller aufkommen. Wir werden in diesen Tagen vor Christi Himmelfahrt in die Stunde der Abschiedsreden hineingezogen. Jesus spürt: Ich muss meine Leute vorbereiten auf die Stunde null, ich muss jetzt Trauerarbeit leisten. Ich muss diese seltsame Männergesellschaft, diese verzagte Solidargemeinschaft, trösten und ihr ein großes Versprechen machen. Es ist in aller Melancholie eine dichte Atmosphäre, die da herrscht in dem geheimnisvollen Obergemach, der Urzelle der Kirche, wenn er spricht. Das können vielleicht nur Menschen verstehen, die mit ihm auf einer Wellenlänge liegen, Wahlverwandte, bei denen es funkt, die sich anstecken lassen von seiner Geistesgegenwart, ganz intensiv dranbleiben an Ihm, der das wunderbare Wort sagt: Ich lebe und auch ihr sollt leben. Weil ich lebe, darum werdet auch ihr Zukunft haben. Nur weil ich lebe und Leben schenke, ist Euer Leben mehr als das Überleben einer Krise.
Denn es gibt Tage, da haben wir Trost und gute Nachrichten nötig. An Tagen der Erschütterung, die zur Zeitenwende werden: Karfreitag/Ostern/Himmelfahrt. Das sind Ereignisse, die das Leben der Kirche unerbittlich in eine Epoche ‚vorher‘ und ‚nachher‘ zerschneiden. Da herrscht Ausnahmezustand, der mit Christi Himmelfahrt anhebt. Auf einmal sind viele Selbstverständlichkeiten dahin, die stützende Normalität aufgehoben. Machen wir uns nichts vor! Nach Christi Himmelfahrt ist der normale Umgang mit Jesus nicht mehr möglich: keine Berührungen, keine Umarmungen, kein leibhaftiges Sich-Festhalten an seiner Nähe. Er auf Distanz!
Wieviel Mindestabstand zu Jesus verträgt unser Glaube? Wir, die wir in diesen Wochen der Krise unter geistlichen Mangelerscheinungen litten, haben mehr denn je entdeckt: Die Nähe zu Jesus ist unersetzbar; und die darf sich nicht verflüchtigen ins Symbolische, ins Digitale und Virtuelle. Genau dieses von uns vermisste Handgreifliche hören wir heute in der 1. Lesung. Es ist bezeichnend, dass dieselben Jünger nach Pfingsten durch Handauflegung, durch körperlich spürbare Zuwendung und im Namen Jesu Wunder wirken, dass die Zahl der elf-zwölf Jünger explosionsartig, heute sagen wir: exponentiell wächst. Die Kurve der vom Geist Christi Angesteckten geht steil nach oben.
Doch nach Christi Himmelfahrt gelten auch extreme Abstandsregeln. Er ist nicht mehr zu betasten. Die Apostel werden zu Christus auf Abstand gehen am Karfreitag; und Er wird sich am Osterabend durch dicke Mauern und skeptische Herzen zu ihnen durcharbeiten und am Tag seiner Erhöhung/ Himmelfahrt auf physischen Abstand gehen zu ihnen. Diesen Einschnitt zu verkraften, das setzt schon ein hohes Maß an Überzeugungskraft voraus. Sein Geist muss die Jünger und uns nachösterliche Christen davon zu überzeugen, dass Er bleibt, bei ihnen und uns, obwohl er geht, gerade weil er auf Distanz geht. Eine schwere Lektion. Denn die Kirche möchte ihn im Grunde anders bei sich haben, auf Abruf, direkter, sinnlicher, berührbarer, erlebbarer…Als ich die Predigt schrieb, hörte ich Musik, eine sehnsüchtige Arie: „Ach bleibe doch, mein liebstes Leben. Fliehe nicht von mir“, heißt es in Bachs Himmelfahrtskantate. Bleibe! Finde kreative Wege zu bleiben Nein, er hinterlässt nicht eine Art Abwesenheitsnotiz, in seinem Geist und Leib ist er der Anwesende
Wir stehen in den „Bitttagen“ und haben Trost, den Geist als „Mutmacher“, nötig. Viele Christen fragen in dieser Krise der ganzen Welt traurig und irritiert: Wie konnte es geschehen? Hätten wir inständiger bitten müssen? Warum ist der Herr so verborgen? In dieser Woche hat ein evangelischer Altbischof in der FAZ den Kirchen vorgeworfen, sie hätten in dieser Coronakrise versagt, sie seien mit ihren Stellungnahmen und Deutungen so sprachlos gewesen angesichts der Frage nach dem Warum und dem Walten des verborgenen Gottes. Sie hätten nur das in feierlichem Ton wiederholt, was auch andere sagen konnten in dieser Pandemiekrise. Dieses ‚Armutszeugnis‘ der Kirchen ist eine vorpfingstliche Mangel-Erfahrung: wir sind sprachlos. Uns fehlen Deutungen. Bitten wir, dass wir Gottes Wirken in dieser unübersichtlichen Zeit spüren und es Antwort gibt auf die Frage, was uns diese Heimsuchung sagen soll und warum Er der Welt und der Kirche diese Durststrecke zumutet. Ein Kriegsheimkehrer, desillusioniert und ohne Glauben an Sinn nach dem von ihm im 2. Weltkrieg und danach Erlebten, fragte auf der Bühne: „O ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Gebt doch Antwort? Warum schweigt ihr denn? Warum? Gibt denn keiner Antwort? Gibt denn keiner Antwort? Gibt denn keiner, keiner Antwort?“, so in Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“.
Wenn Er nicht wäre, im Obergemach dieses Raumes und in unserem Innenleben, dann bliebe nur der unheimliche Leerlauf einer verwaisten Kirche. „Wir sind alle Waisen, ihr und ihr, wir sind ohne Vater.“ (Jean Paul, Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei). Doch Jesus verspricht: Ich lasse euch nicht mutterseelenallein als Waisen zurück. Mehr haben wir nicht als dieses leise Versprechen des Auferstandenen!
So wenig wie sich die Jünger auf Dauer im Obergemach einschließen können, so wenig kann Kirche auf Dauer in einer digitalen Welt bleiben. Der Glaube kann nicht gesund bleiben, wenn wir nur flüchtig Kontakt zu Ihm und der Gottesdienstgemeinde halten. Und darum hoffe ich, dass uns die allmählichen Lockerungsübungen und das Neuaufleben des liturgischen und seelsorglichen Lebens und der Mutmacher-Geist des Herrn wieder zueinander bringen.
Suchen und fragend sind wir hier: Warum bist du Gott, so zurückhaltend, so leise, so verborgen? Warum mutest du uns in deiner Himmelfahrt eine Abschiedserfahrung zu? Jesu Geistesgegenwart ist seltsam, unaufdringlich, in seinem Wort, in noch fast leeren Kirchen, in unseren Privathaushalten, wo wir ihn nur leise feiern und erfahren konnten, nicht in tollen Erlebnissen und Erleuchtungen; in Zeiten, wo wir Abschied nehmen müssen von vielem Selbstverständlichen und dem in Normalzeiten kaum Geschätzten, wo wir selbst Jesus nicht einmal sakramental empfangen konnten, sondern nur geistlich. Doch die geistliche Kommunion mit dem Erhöhten ist mehr als ‚virtuell‘, mehr als die Einbildung meines frommen Bewusstseins… Er, der zu Himmelfahrt auf Abstand geht, er kommt als Rettung: „Nah ist/ und schwer zu fassen der Gott/ Wo aber Gefahr ist, wächst/ das Rettende auch“, sagt Hölderlin, der Lieblingsdichter des gegenwärtigen Papstes. Hoffen wir, dass wir sensibel werden für das Rettende, das auf leisen Sohlen kommt und sich genau da zeigt, wo das Dunkel der Bedrohung und des Todes so übermächtig werden.
Kurt Josef Wecker
6. Sonntag der Osterzeit 2020 in der Coronazeit
Fürbitten
Jesus sieht, was uns fehlt. Als Bittsteller stehen wir vor ihm. Wir leben, weil er lebt und sein Leben mit uns teilt. Bitten wir in der Kraft seines Geistes:
Schicke unserer Zeit deinen Geist zu den Menschen, die durch die außergewöhnliche Katastrophe aus der Bahn geworfen worden sind und in deren Alltag Krankheit und Not eingebrochen sind wie eine fremde macht und stärke ihre Hoffnung in aller Not und Angst.
Schicke deinen Geist in alle verfahrenen Situationen und lass das Wunder neu geschehen, dass alle Menschen sich verstehen und bauen an einer menschenwürdigen Welt
Schicke deinen Geist zu denen, die sich wie leer und ausgebrannt erfahren, ohne Lebensfreude und ohne Aufmerksamkeit für das Schöne. Lass uns geistesgegenwärtiger leben.
Schicke deinen Geist in die Herzen der Menschen, die mutlos geworden sind angesichts der Rätsel und Dunkelheiten dieser Tage und die vereinsamt und vergessen sind, die von niemandem vermisst werden.
Schicke deinen Geist des Heils zu den Menschen, die mit uns leben, die uns von dem geben, was wir nicht selbst sind und können, die uns bereichern gerade mit dem, was uns fremd ist.
Schicke deinen Geist in unsere Gemeinden, auch den Geist der Vorfreude und Fantasie, damit bald wieder feierliche Gottesdienste, lautstarker Gesang und ein Wiedersehen vor dir möglich sind.
Schicke deinen Geist der Klugheit und Weisheit in die Entscheidungszentren und Forschungsstätten dieser Welt, die so angewiesen ist auf rettende Einfälle und Auswege, auf segensreiche Erfindungen und die Bereitschaft, rettende Medikamente zu teilen.
Schicke deinen Geist des Respekts und der Toleranz und Gewaltlosigkeit in unsere Gesellschaft, wenn sie sich zu entzweien droht übe die die richtigen Wege in und aus der Krise; und lass uns behutsam mit den Schwächsten und Gefährdeten umgehen.
Sende aus den Geist des österlichen Lebens. Lass unsere Verstorbenen und alle uns unbekannten Toten die Stunde der Auferstehung erfahren und das Geschenk des ewigen Lebens empfangen.
Herr, wir bitten nicht darum, dass du uns alle Wünsche und Träume erfüllst, aber dass wir dich und deinen heiligen Willen tiefer verstehen und dir nachfolgen. Dich feiern wir nun, Herr, der du leise zu uns trittst. In deiner Nähe möchten wir bleiben. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen
kjw
Gottesdienst 5. Sonntag der Osterzeit mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
5. Sonntag der Osterzeit 2020 in der Coronazeit - „Kantate“ über Joh 14, 1-12
Predigt von: Kurt Josef Wecker, Pfr, Nideggen/ Heimbach
Liebe Gemeinde,
haben Sie sich schon gut eingelebt? Das wurde ich in den ersten Wochen nach meinem Umzug öfter gefragt. Beginnen Sie sich schon, etwas heimisch zu fühlen? Wie lange braucht man, um sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen? Wann wird die Fremde zur neuen Heimat? Ja, ich fühle mich sehr wohl in der neuen „irdischen Wohnung“.
Viele von uns wurden in diesen Wochen zurückgeworfen auf ihre eigenen vier Wände. Wir gingen mehr nach innen als nach außen. Und die Wohnungsfenster wurden zum Fenster zur Welt. Die Wohnung wurde zu einer Art zweiten schützenden Haut, einer Zufluchtsstätte, manchmal auch einer Konfliktzone, einem Raum der Langeweile oder der Einsamkeit. Wir zogen uns unfreiwillig in unser Schneckenhaus zurück. Die Wohnung als Schutz vor den Unbilden des Lebens. Für viele wurde der Wohnbereich wieder zum Arbeitsbereich: Alles unter einem Dach. Heimarbeit ist angesagt. Normalerweise wohnt man nicht im Büro oder Fitnesscenter, aber zumindest die Wohnung wurde für viele zum Büro und wird es womöglich für manche nach der Krise auch bleiben.
Die Wohnung ist für Menschen, die viel reisen müssen und in Hotels zu Hause sind, ein spürbarer Ort der ‚Entschleunigung‘. Wohnung steht in Spannung zum Unterwegssein. Wir sehnen uns in diesen Coronazeiten nach Weite und Mobilität, nach Grenzöffnung und Reisen, aber wir spüren die Sehnsucht nach Heimat in unübersichtlicher Zeit, nach vier Wänden, in denen man sich auskennt. Denn man fragt sich in den Zeiten ‚davor‘, in der Phase hoher Mobilität: Wo sind die vielen mobilen Menschen eigentlich zu Hause, die nur Hotelzimmer als ihre Tageswohnung angeben können? Es ist offensichtlich nicht gleichgültig, wo man wohnt und Wurzeln schlägt, wo man unterkommt. Viele investieren viel Zeit und Geld in das Projekt ‚Schöner Wohnen‘.
Wo sind Sie zu Hause? Sind Sie zu Hause zu Hause? Wo und bei wem fühle ich mich daheim? Oder bin ich Zuhause an einem besonderen Lieblingsort, an heiligen Stätten, in Büchern, in der Kunst, in einem Freundeskreis?
Sind Sie, seid Ihr bei der Mutter zu Hause. Heute ist Muttertag und viele spüren, wie untrennbar das Zuhause, das Wohngefühl von der Mutter geprägt ist oder war. Dort, wo meine Wiege stand…
Oder sind Sie bei sich zu Hause? Da, wo wir geboren und aufgewachsen sind? Da, wo wir willkommen sind und wiederkommen dürfen? Da, wo meine Familie und Freunde sind, wo meine Sprache gesprochen wird, mein Kirchturm steht? Da, wo ich meine Ruhe habe? Da, wo wir uns fallen lassen dürfen und spüren können: Hier gehöre ich hin, hierhin passe ich…?
Vom Zuhause, von den Wohnungen, von Wohnungen spricht Jesus heute im Abendmahlssaal. Um von sich als dem Weg dorthin, quasi als der Straßenkarte zu diesem Zuhause im himmlischen Jerusalem, in der neuen Stadt, die keine Wohnungsnot kennt. Er ist „Weg“ (Joh 14,6). Es sind lange Abschiedsreden, die Jesus vor dem Karfreitag in einer Predigt vor zwölf (!) Zuhörern hielt. Diese lange Predigt bekommt die Kirche vor Christi Himmelfahrt und Pfingsten zu hören. Die Apostel spüren: da kommt was auf uns zu! Da bereitet der, der der Weg ist die Stunde vor, in der er sich zurückzieht und heimkehrt. Wird dann eine Wohnungsnot über uns hereinbrechen? „Meister, wo wohnst du?“ Das haben sie ihn vor Jahren gefragt. Und er damals: „Kommt und seht!“ Wird er nun sagen: Seht selber zu, wie ihr ohne mich klarkommt. Sucht euch was Neues…! Ich ziehe aus, ich kündige unsere Wohngemeinschaft? Oder: Ich ziehe ins Ortlose, ans Kreuz? Ich ziehe zum Vater, dorthin könnt ihr mir nicht folgen…? Ich kehre dorthin zurück, wo ich herkam, wo ich hingehöre.
Wir wissen nicht, wie Jesus in seinen Erdentagen gelebt hat, wie er es sich eingerichtet hat, geschmackvoll oder zweckmäßig. Der Menschensohn hatte keine feste Anschrift. Wir hören nur: der Menschensohn hatte nicht einmal ein Kissen, auf das er seinen Kopf betten konnte. Seine erste Wohnung, der Kreißsaal im Erdloch von Bethlehem: eine Höhle. 30 Jahre in einem armseligen Dorf Nazareth. Danach wohnte er quasi zur Untermiete bei der Schwiegermutter des Petrus, kam vor den Toren Jerusalems schon mal unter bei Freundinnen und Freund in Bethanien; zuletzt musste er in Jerusalem ein Notquartier, das „Obergemach“, anmieten. Und diese WG wird Jesus nun verlassen.
Er geht mit einer Verheißung: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“ Und ich gehe euch voraus, sie euch zu bereiten. Er - unser Quartiermeister (vgl. Joh 14,2). Er geht, weil er sich darum sorgt, dass auch wir ein Zuhause haben; und wir (so nennen die Schweizer einen Wohnungsumzug) ‚zügeln‘ ihm nach, wir sind Nachzügler.
Wenn die Coronakrise einmal etwas abgeklungen ist, dann wird auch die Frage der Wohnungsknappheit, der Mietpreise wieder ein Thema des Tages. Aber Jesus ist kein Wahlkämpfer, der viele irdische Wohnungen und sozialen Wohnungsbau verspricht. Hier predigt einer, der sagt: Ich bin eure neue Heimat. Ich bin Weg und Ziel. Er verspricht nicht nur einen riesigen Schlafsaal für alle, sondern viele Wohnungen, für ganz verschiedene Menschen und Geschmäcker, Gesichter, Lebensgeschichten. Der eine Weg und die vielen Wohnungen! Jesus sagt nicht nur: Im Haus meines Vaters ist Platz für alle. Das war vielleicht die Sorge der Jünger: Wird der Platz reichen oder wird es eng? Wird der Platz an der Sonne knapp? Und wie finden wir ohne dich hin? Nein, er spricht von vielen Wohnungen. Und vielleicht werde ich mich wundern, wer in die Wohnung neben mir einziehen wird… Und darum gehört zur Gewissenserforschung die Frage: Was, wen würde ich gerne mitnehmen in den Umzugskartons in die himmlischen Wohnungen? Darf mir Christus beim Aussuchen, Packen, Tragen helfen? Wie lebe ich damit, dass neben mir nicht mein Wunschnachbar wohnen wird, sondern ein fremdes, unerwartetes Gesicht?
Für alte Menschen ist die Vorstellung schlimm, einmal ausziehen zu müssen aus den vertrauten vier Wänden und einziehen zu müssen in ein Standardzimmer oder in ein Zweibettzimmer in einem Seniorenheim, dorthin, wohin man kaum etwas von seiner gewohnten Umgebung mitnehmen kann. Und wichtig wären solche Zeichen: Erinnerungsstücke, Lieblingsfotos, Bilder, Bücher, Sitzmöbel…. - eine transportable Heimat eben. Wir denken an Menschen vor 75 Jahren in der „Stunde null“, nach dem 8. Mai 1945, als sich so viele „draußen vor der Tür“ wiederfanden, obdachlos nach den Bombenangriffen und der Vertreibung aus der alten Heimat, belastet mit der Ahnung, nie mehr in das eigene Zuhause, in die alten Wohnungen zurückkehren zu können. Ich denke an die, die heute geistig obdachlos geworden sind und nicht mehr wissen, wohin sie gehören. An engem Raum für Familien gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Wohnsilos nennen wir hässliche Zweckbauen in den Riesenstädten, Bettenburgen, wo Menschen teilweise gestapelt werden wie in Futterspeicher, in Kästen für Wanderarbeiter in China, Indien, Indonesien… Wir denken an Menschen, die vor 75 Jahren in den ausgebombten Städten in Bunkern hausten; Vertriebene, die einquartiert wurden, zwangseingewiesen auf engstem Raum, ohne Privatleben, Schutzraum, Intimsphäre…
Und dann diese Verheißung: „Im Hause meines Vaters sind viele Bleiben“ (Joh 14,1, übersetzt von F. Stier). Was hören wir daraus: Wir werden unsere eigenen vier Wänden haben, auf uns zugeschnitten. Das hört sich so an, als dürften wir uns höchstpersönlich mitbringen - und das, was uns eigen ist: meine unverwechselbare Lebensgeschichte, das Gute von mir, was bleiben muss. Wir werden nicht über einen Kamm geschoren und zwangseinquartiert. Die himmlischen Wohnungen, das ist keine Notunterkunft für 80 Milliarden Menschen im neuen Jerusalem. Es sind nur Bilder von dem, was kommt! Doch Jesus lädt uns ein, sie uns auszumalen. Vielleicht wird es ein Mehrfamilienhaus sein, doch ohne Blockwart und Gesichtskontrolle, ohne endlose Behördengänge und Bewerbungen, kein riesiges Auffanglager. Wir dürfen auch in Gottes Reich unser eigenes Reich haben. Wir dürfen auch bei Gott zugleich bei uns sein. Hier darf ich sein, wie ich bin. Hier darf ich darauf hoffen, verstanden zu werden. Vielleicht sind es keine Singlehaushalte, in denen jeder nach seiner Façon selig werden kann. Wir werden keine Eigentumswohnung haben, weil wir dann bei Gott zu Gast sind, Tür an Tür mit dem Geheimnis. Selig werden wir nur gemeinsam, als Untermieter Gottes, ohne Angst vor Kündigung. Bei Gott herrscht keine Wohnungsknappheit. Mit ihm unter einem Dach, in seinem Vater- und Mutterhaus. Im Glauben wollen wir die Kunst lernen, mit vielen gemeinsam das eine Vaterhaus Gottes zu bewohnen. Das nennen wir Ökumene. Oikos heißt Haus, das Haus Gottes mit vielen Etagen, „in versöhnter Verschiedenheit“. Ja: Es gibt ein Zuhause, eine neue Heimat, die liegt nicht hinter uns, wie bei den Heimatvertriebenen, sondern vor uns. Das Türschild lautet: „Das Haus des barmherzigen Vaters“ (Klaus Hemmerle).
Heimbach ist Wallfahrtsort. Heimweh nach Heimbach, dem Heim am Bach, am Bach Rur und dem Rinnsal Heim-Bach. Pilger, die hierhin kommen, sie wissen darum, dass unser Heim am Bach Rur nicht unsere letzte Wohnungsanschrift ist: hierhin kommen Menschen, die ja zeitweise freiwillig ihre irdischen Wohnungen verlassen, um auf Zeit im Freien die Rolle des Pilgers einzunehmen, die also den Platz auf offener Straße einnehmen, als Fußwallfahrer, freiwillig unbehauste Menschen – das ist das heilige Spiel des Pilgers. Wir sind nur Gast auf Erden, nur Erdenbürger auf Abruf, unter Vorbehalt. Menschen, denen immer wieder von Zeit zu Zeit das Gnadenbild zur Heimat für ihre Augen wird. Und zur Erinnerung an eine Heimat, in der noch niemand von uns war, an ein Ziel, das uns erwartet und an dem wir von einem Quartiermeister erwartet werden. Wir können es uns hier noch so schön und gemütlich einrichten, unsere Mietverträge auf Erden sind begrenzt. Ausziehen müssen wir alle. Das wissen wir zwar alle, aber es sind die Pilger, die uns an diese nackte Wahrheit erinnern. Wir sind nur Gast auf Erden. Hier auf Erden sollten wir uns vorbereiten auf diese Ewigkeit, in der wir mit Gott unter einem Dach zusammenwohnen. Dieses Bei-Ihm-Wohnen will eingeübt sein.
Am Ende, in der Vollendung sind wir ‚Untermieter Gottes‘. Und auf Erden ist es beinahe umgekehrt. Da sind wir die Wohnung, die Wahlheimat, der Tempel Gottes, seine Verstecke, seine Geburtshöhle.
Das wird deutlich im Kommuniongang. Und darum schmerzt es, dass ich – als Vorsichtsmaßnahme gegen Ansteckung - (noch) keine Kommunion austeile. Dabei bewohnt Gott nicht die leeren Kirchen allein, sondern jede und jeder von uns. Gott bittet um Obdach. Er zieht ein in dich und in mich und feiert Kommunion mit uns. Im Haus dieser Welt gibt es auch viele Wohnungen, doch er klopft an. Man kann ihm den Einlass verweigern. Ob er Zutritt bekommt, liegt nicht allein in Gottes Hand, sondern in meiner freien Entscheidung. Auf dieses Risiko lässt Er sich ein. Und das Paradox des Glaubens ist: Der Quartiermeister ist zugleich unser Untermieter. Der Weg ist das Ziel. Amen
Kurt Josef Wecker
Fürbitten
Jesus ist der Weg und das Ziel unseres Lebens. Er gönnt uns den Atem des Lebens, er lässt uns hier auf Erden Heimat finden und er verheißt uns ein ewiges Zuhause. Bitten wir in der Kraft seines Geistes:
Wir bitten für diese Welt, in der Menschen an die Grenzen ihrer Kraft geraten.
Wir bitten für diese Welt, in der Menschen schwerkrank sind und mit dem Tod kämpfen.
Wir bitten für diese Welt, in der Menschen den Weg verloren haben und nicht mehr durchblicken.
Wir bitten für diese Welt, damit auf ihr unseren Kindern ein wohnliches Zuhause bewahrt werde.
Wir bitten für diese Welt, in der sich Menschen als geistlich obdachlos erfahren; in der Menschen bitterlich weinen, da sie sich mutterseelenallein und vergessen fühlen.
Wir bitten für eine Welt, in der es das kostbare Geschenk der Mütter und Großmütter gibt, die uns die mütterliche Zuneigung und Fürsorge Gottes ahnen lassen.
Wir bitten für eine Welt, in der vor 75 Jahren ein Weltkrieg zu Ende ging, für uns eine Friedenszeit begann und immer noch Menschen durch Krieg und Gewalt vertrieben, verletzt und getötet werden.
Wir bitten um eine Welt, in der es bald wieder feierliche Gottesdienste und gemeinsames Gebet, frohen Gesang und die schönen Zeichen des gefeierten Glaubens an dich, Gott geben möge.
Wir bitten für diese Welt, die angewiesen ist auf den Geist Gottes, auf rettende Einfälle und Auswege, auf segensreiche Erfindungen, auf Vorsicht in Zeiten der Ansteckung und auf Rücksicht für die Schwächsten und Gefährdeten.
Wir bitten um Auferstehung, um das Geschenk des ewigen Lebens für unsere Toten und alle Verstorbenen, deren Namen du allein kennst.
Dich feiern wir nun, Herr, der du so leise und schonend unter uns wohnst und dein verborgenes Zelt aufgeschlagen hast in unserer Mitte - und in unserem Innenleben. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen
Gottesdienst zum Wallfahrtsjubiläum - Heimbacher Schmerzensfreitag in der Salvatorkirche Heimbach am 08.05.2020 mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Gottesdienst zum 4. Sonntag der Osterzeit mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Predigt am 4. Sonntag der Osterzeit (Jubilate) in der Corona-Zeit 2020 über 1Petr 2,20b-25
Gute Nachricht: der langersehnte Regen
Liebe Schwestern und Brüder! In dieser Woche kam er, der von vielen langersehnte Frühlingsregen; die Natur konnte auftanken; und mir fiel auf, dass es während der ganzen langen Corona-Pandemie hier noch nicht geregnet hatte. Das war kein normaler April, das Unnormale reichte bis in die Wetterlage. Das Wetter war unwirklich schön sommerlich, aber trocken, knochentrocken, besorgniserregend ausgedörrt war der Boden, feuergefährdet der Wald. Ein Hoffnungslicht: All die Bestattungsliturgien der letzten Zeit fanden auf den Friedhöfen im Sonnenschein statt; und diese trotz aller Traurigkeit österlichen Lichtverhältnisse auf den Gottesäckern der Gemeinden waren für mich Augenblicke der Auferstehungshoffnung. Doch nun der Wetterwechsel. Dürfen wir nun auch diesen Segen, diesen Regen als Hoffnungszeichen deuten, wo wir uns auch gesellschaftlich und im gottesdienstlichen Leben auf gewisse Lockerungsübungen einstellen können, auf zarte Pflänzchen einer vielleicht wiederkommenden neuen Normalität? Der Frühlingsregen als gutes Omen und Vorgeschmack auf andere gute Nachrichten…? So wie der 8. Mai 1945, der Tag des Kriegsendes, trotz der nun folgenden schweren Nachkriegszeit eine gute Nachricht war, auch wenn damals für viele in Deutschland schwere Jahre begannen. In dieser“ Stunde Null“ konnte niemand ahnen, dass diesem 8. Mai 1945 75 Friedensjahre folgen würden. 75 Jahre ohne Krieg - und ohne Pandemie! Eine so lange Friedenszeit in Europa ist nicht selbstverständlich und ein Dankgebet wert!
Irgendwann ist man in diesen Wochen so wild auf gute Nachrichten wie ein Drogensüchtiger… Wir halten Ausschau nach Zeichen, das es wieder besser geht, starren auf Zahlen, hoffen auf die Trendwende. Wir wollen wissen, wohin der Weg geht, Perspektiven, Schritte in der Krise, sehr vorsichtig und tastend, demütig und im Wissen, dass wir uns auf dünnem Eis uns bewegen. Denn die Bedrohung ist weiterhin da, unsichtbar, aber real, vielleicht unter Kontrolle und doch jederzeit virulent, so dass das Geschehen unkontrollierbar werden kann.
„Sieben Wochen ohne“
„Sieben Wochen ohne“ - so heißt die alljährliche Fastenaktion der evangelischen Kirche! Sage und schreibe seit sieben Wochen helfen wir uns hier geistlich mit digitalen Gottesdiensten und freuen uns an dem, was in unseren Gemeinden in der Kreativität des Glaubens geschah. Das kirchlich-liturgische Leben ist seit dem 21. März bei uns virtuell; ich bin dankbar für die Brücke des Trostes und der Beheimatung, die mit Hilfe der Technik und dem Knowhow der medienerfahrenen Messdiener geschlagen werden konnte; ich hoffe, dass der Zugang zu diesem Angebot nicht nur den ‚digital Fitten‘ offenstand... Doch Online-Gottesdienste sind nur Notbehelfe, weder ausreichend noch geistlich sättigend. Immerhin: Sie helfen gerade auch denjenigen, für die ein physischer Gottesdienstbesuch ein Lebensrisiko wäre.
Kirche ging nicht auf Tauchstation in diesen Tagen. In einigen Gemeinden der GdG wurden großartige Initiativen der geistlichen Vernetzung gestartet, für die ich mich herzlich bedanke. Nachbarschaftshilfe, kleine Gesten der Verbundenheit und kreative Ideen, mit Mühe und Liebe genähten Masken, Einsatz um die Bewahrung des österlichen Brauchtums… In diesen Initiativen wurden in zahllosen Taten der Liebe verborgene Gottesdienste mitten im Alltag der Welt gefeiert, wo wir draußen vor den Kirchentüren und in uns und zwischen uns den auferstandenen Christus erfahren. Gott wie eine Überraschung. Denn wir können nie sicher sein, wann und wo und wodurch und durch wenn der lebendige Christus zu uns spricht und uns plötzlich und unerwartet begegnet.
„Sieben Wochen ohne!“ Für viele Gemeindemitglieder ist es eine extreme Erfahrung, den Glauben ohne regelmäßigen Gottesdienst und Eucharistie zu leben. Die Dichterin Eva Demski bezeichnete die Kirche als das „Rasthaus Gottes mit stiller Bedienung.“ Solche Raststätten brauchen wir. Sie waren zwar nicht geschlossen, aber die ‚stille eucharistische Bedienung‘ war in diesen Tagen nicht möglich. Gottesdienstlicher Verzicht war angesagt. Ein seltsamer Lebensstil für Katholiken. Wie lange noch? Wie lange noch dieses eucharistische Fasten wie am Karfreitag? Solch eine Erfahrung machen viele Gemeinden z.B. in Amazonien permanent. Nur selten kommt dort ein Priester vorbei, der mit den Menschen die Eucharistie feiern kann. Für uns ist dies ein ungewohnter Ausnahmezustand. Wie lange geht das gut? Womöglich entdecken wir nun, wie kostbar das Gut des gemeinsamen Stehens vor Gott und die Gabe des Leibes Christi ist... Wenn mir wirklich aufginge, was mir fehlt und wonach es mich hungert, dann hätte der Entzug des Heiligen ein Gutes, wäre der Verzicht eine Art ‚eucharistisches Heilfasten‘: das demütige Eingeständnis, dass ich Ihn nicht ‚habe‘ und Er nicht im Griff und in der Verfügungsmacht der Kirche liegt. Die Einsicht, dass Christus Geschenk ist, heilige Gabe, nicht auf Abruf zu haben… Wir müssen lernen, ihn zu vermissen, wie das hungrige Volk Gottes in der Wüste Bedürfnisse hat und das Manna empfing. Der österliche Herr ist frei und hinterlässt seine Fußspuren da, wo er will… Sieben Wochen ohne! Ich ahne: Der Bedarf nach gemeinsamer Gottesbegegnung und öffentlichen Gottesdiensten und liturgischer Lockerung ist bei vielen Gemeindegliedern außerordentlich groß. Wohin führt uns Gott mit dem Widerfahrnis dieser Mangelerscheinung? Der Hunger nach gemeinsam erfahrbarer Gottesnähe ist vital; manche packt auch eine verständliche geistliche Ungeduld! Der katholische Instinkt sagt: Es geht nicht ohne! Lebendige Gemeinden brauchen geistliche Beheimatung. Zusammenkommen und zu verlässlichen Zeiten und an vertrauten Orten. Physisch konkret wollen wir irgendwann wieder unsere Ängste und Bitten vor Gott bringen. Ja, Gottesdienst hat mit Begegnung, mit dem sichtbaren Zusammenhalt einer Gemeinde, auch mit einem ‚positiven Erlebnis‘ zu tun.
Ich frage mich, wie lange können wir uns den Verlust an gottesdienstlicher Erfahrung ohne geistliche Kollateralschäden ‚leisten‘? Wie lange soll sich die ungewiss lange Übergangszeit, die eucharistische Abstinenz erstrecken? Und doch ahne ich, der Weg in die Normalität wird lang sein. Welche kleinen und mit Bedacht gesetzten Schritte können wir wagen? Ich glaube, die Einschränkungen, mit denen wir das öffentliche liturgische Leben wieder anheben lassen müssen, werden uns noch längere Zeit in unserer Art, Liturgie zu feiern, begleiten.
Liturgische Lockerung
Die fünf (Erz)Bistümer in NRW haben gemeinsam mit dem Land abgestimmte Maßnahmen erarbeitet. Es sind Rahmenbedingungen, die ab Anfang Mai 2020 das schrittweise Aufleben der öffentlichen Liturgie in den Pfarrgemeinden wieder ermöglichen. Dieses auch von der Aachener Bistumsleitung erlassene Rahmenkonzept muss nun vor Ort im Detail in Form eines Schutzkonzepts verantwortungsbewusst von den Hauptamtlichen, Kirchenvorständen und Ehrenamtlichen ausgearbeitet und reflektiert werden. Die Umsetzung des Konzepts geht nicht ohne die Mithilfe der ortsansässigen Kräfte – der Dienst des „Türhüters“ ist sogar biblisch (Joh 10,3) - und nicht ohne grundsätzliche Überlegungen.
Auch in der Kirche geraten eher Zaghafte und Vorsichtige und Forsche und Lockerungsfreudige aneinander. Und wahrscheinlich brauchen wir solche Diskussionen, auch um Dampf abzulassen und Druck loszuwerden.
Ich halte nichts von einem Wettlauf, wer nun zuerst den Gottesdienst feiert. Der 3. Mai 2020 ist kein Zwangsdatum. Zudem: die von den Bischöfen erlasse Entbindung von der „Sonntagspflicht“ gilt weiterhin.
Ich plädiere für einen gestuften Beginn, eine vorsichtige Öffnung. In der Erprobungsphase dieses Experiments kommen aufgrund der baulichen Voraussetzungen zunächst die größeren Pfarrkirchen unserer GdG in Frage. Dort ist zu prüfen, ob die Sicherheitsstandards umsetzbar sind und wie ein Ansteckungsrisiko minimiert werden kann. Ich habe mich mit unserem Pastoralteam beraten und werde die Situation mit den Verantwortlichen in Nideggen und Heimbach sondieren und hoffen, dass wir ab nächster Woche an zwei Gottesdienstorten unserer GdG öffentliche Gottesdienste anbieten:
In der St.-Johannes-Kirche in Nideggen samstags um 18 Uhr und in der Heimbacher Salvatorkirche sonntags um 11 Uhr. Die in Nideggen am Vorabend gefeierte Messe soll nach Möglichkeit weiterhin aufgenommen und auf Youtube hochgeladen werden. In einem weiteren Schritt überlegen wir, wo wir werktags auch in den kleinen Pfarrkirchen oder im Freien zu Gottesdiensten und auch (Mai)-Andachten einladen.
Den Fußspuren des guten Hirten nachgehen
Jesus ist der gute Hirt, der Hirt und Bischof unserer aufgescheuchten Seelen. Diese brauchen die Gnadengegenwart Jesu genauso dringend wie die Weide (Joh 10,9) und Gärten den Frühlingsregen. Dieser Hirten-Beruf Jesu ist systemrelevant. Er ist heilsnotwendig. Wir blicken in eine neblige Gegenwart und Zukunft, wo so viel Ungewissheit herrscht und entdecken in unseren Leben „Fußspuren“ Jesu, wie es der 1. Petrusbrief (1 Petr 2,21) sagt. Diese Spuren Jesu dürfen in mir nicht verwittern und zugeweht werden. Gerade auch der Gottesdienst ist ein Ort, an dem ich auf die tief in mich eingedrückte Spur des Herrn aufmerksam gemacht werde. Die Spuren der Technik, die Kondensstreifen am Himmel, sind selten in diesen Wochen des Stillstands. Viele sagen: ich habe die Spur verloren, mir wurde der Boden der Normalität weggezogen; und trotz der verordneten Entschleunigung verrenne ich mich in Sackgassen, verfange mich im Grübeln, bin zu Tode gelangweilt und frage mich, wohin das alles laufen soll. Gehe ich noch in der unauslöschlichen Spur, die Jesus gelegt hat? Welche Spur möchte ich einmal in dieser zerbrechlichen Welt hinterlassen? Jesu Spur, die er seit der Taufe in uns eingraviert hat, zu entdecken im finsteren Tal der Gegenwart, das wünsche ich uns. Mit seiner Nähe und Liebe erreicht er uns. Und wenn wir einmal in der Zeit „danach“ auf diese seltsamen Wochen zurückblicken, dann wünsche ich Euch und Ihnen, dass wir das erfahren: er ist der Hirt, der im dunklen Tal (Gotteslob 421,2) nie von unserer Seite wich und der zur Not auch uns Schafe trägt, sich mit mir belastet und uns nachläuft, wenn wir orientierungslos herumirren.
Kurt Josef Wecker
Fürbitten
Gott, dies ist eine seltsame Zeit, die alles so langsam und anders macht; Zeit, in der wir so viel Geduld und Zuversicht brauchen, kreative Gedanken und Vertrauen. Wir bitten:
Für die Menschen, die schwerkrank in Hospitälern und isoliert in Altersheimen liegen, und für die Angehörigen, die sie nur sehr eingeschränkt oder gar nicht besuchen können. Lass niemanden allein, halte sie, wo wir es nicht können. Sei die Kraft in den Armen der Pflegenden und behüte sie vor Ansteckung. Zeige Wege auf, den Menschen aus in dieser schweren Situation die Treue zu halten und ihnen Zuneigung zu zeigen.
Für die Jugendlichen, die merken, dass ihnen der richtige Unterricht fehlt und digitale Treffen ihn nicht ersetzen können. Für die Kinder, die ihre Großeltern nicht besuchen. Wir bitten für alle Familien, die nicht wissen, wie es weitergeht. Gib deinen Geist, dass sich gute Alternativen auftun.
Für alle, die in diesen Wochen die Spur verloren haben und die Fußspuren Jesu in ihrem Leben und in dieser Welt nicht mehr entdecken. Für die, denen der Gottesdienst so fehlt und die sich freuen auf die beschränkten Möglichkeiten, wieder als Gemeinde vor dir, Gott, zu stehen.
Für alle, die ungeduldig und zaghaft zugleich sind, weil niemand genau weiß, was jetzt richtig und was falsch ist. Wir brauchen einen langen Atem. Wir bitten um Geduld und Besonnenheit bei allen, die nun Verantwortung tragen in Gesellschaft, Kirche und Wissenschaft.
für alle, die gedrückt sind, weil niemand von uns je zuvor eine Pandemie erlebt hat; für die, die durch Angstmacherei, wenig hilfreiche Kommentare und schlimme Szenarien wie gelähmt sind. Lass sie einen Ort finden, wo ihre aufgescheuchten Seelen zur Ruhe kommen. Lass sie offene Ohren finden - und Menschen, denen sie sich öffnen, mit allem Schweren, was sie bewegt.
Für alle, die keinen Schutz finden in diesen Wochen, die in den Elendsgebieten dieser Welt gar nicht auf sichere Distanz gehen können, die Obdachlosen, Flüchtlinge, Tagelöhner in Indien und in den Slums der Entwicklungsländer, , die nicht in Sicherheit zu Hause bleiben können, weil ihnen das Nötigste zum Überleben fehlt; denen das reine Wasser fehlt, um die kleinsten Hygienevorschriften zu erfüllen.
Für alle, die in diesen Wochen so großzügig und kreativ sind, die mehr Kraft haben als andere; für die, die tatkräftig Nachbarschaftshilfe leisten, die voller Sorgfalt Masken nähen und Kontakt suchen zu Menschen in Einsamkeit. Für die, die in kleinen Gesten das Ganze der Liebe des guten Hirten weitergeben und andere Menschen im Dunkel dieser Tage im Gebet vor dich tragen.
Für alle, die einen Menschen verloren haben und nicht in Gemeinschaft trauern können und für alle Toten unserer Gemeinden, die wir in diesen Wochen beigesetzt haben und beisetzen werden.
Gott, noch können wir nicht zusammenkommen, aber unser Herz ist offen für dich- Komm du zu uns, lass uns zur Ruhe kommen vor dir und nimm wahr, was uns bewegt. Wir warten auf die Zeit „danach“, auf das Fest, das du uns allen wieder bereiten wirst. Darauf hoffen wir, darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.
kjw
Gottesdienst zum 3. Sonntag der Osterzeit
Fürbitten 3. Sonntag der Osterzeit 2020
Als Bittsteller stehen wir wie die Emmausjünger vor dem Auferstandenen: „Bleib mit uns“ (Lk 24, 29)! Bleibe unser Gast, denn es will Abend werden! Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Welt!
Bleibe bei denen, die sich in dunkle Gespräche verfangen haben, in Selbstgesprächen kreisen und die niemanden haben, vor dem sie ihr Herz ausschütten können
Bleibe bei den Alten und Kranken und Gefährdeten! Bleibe bei denen, die mit dem Tod ringen!
Bleibe bei den Hoffnungslosen und Ratlosen, die deine Nähe und dein Weggeleit brauchen.
Bleibe bei den Einsamen und Isolierten, die nun besonders in den Alten- und Pflegeheimen und auf den Krankenstationen noch einsamer werden.
Bleibe bei denen, die in diesen Tagen ihren Mitmenschen nicht von der Seite weichen und Übermenschliches leisten: die Ärzte, Krankenschwestern und Pflegerinnen.
Bleibe bei denen, die geistesgegenwärtig präsent sein müssen im Dienst am Allgemeinwohl, bei den den Sicherheitskräften, den Verkäuferinnen, den Politikern und Wissenschaftlern.
Bleibe bei unseren Kommunionkindern, die sich darauf freuen, dass es auch für sie ein Emmaus und eine Feier des Brotbrechens geben wird, und bei allen Eltern, die noch warten auf die Möglichkeit, dass ihr Kind getauft wird.
Bleibe bei denen, die uns Wegbegleiter sind in schweren Tagen, die Zeit und Zuversicht schenken in dieser Zeit, die uns in diesen schweren Tagen Hoffnung machen und selbstlos Nachbarschaftshilfe leisten.
Bleibe bei den Kindern und Jugendlichen in ihrem Tatendrang und ihrem Bedürfnis nach Bewegung und frischer Luft und dem Schulalltag.
Bleibe bei uns, deiner Kirche, und lass sie spüren und feiern, dass dein Ostern wahrhaft gilt. Bleibe und beschenke uns mit Worten, die uns fehlen und mit einer Osterfreude, die in uns auch in dieser seltsamen Zeit weiterklingt.
Bleibe bei den vielen, die in dieser Stunde im Sterben liegen. Und bleibe treu bei unseren Verstorbenen, den Toten aus unseren Gemeinden und unserem Familienkreis, die wir in diesen Wochen bestatten – und all den namenlosen Toten. Bereite ihnen das Fest der Auferstehung.
Herr Jesus Christus, du lässt dich bitten zu bleiben. Du bleibst in dieser Welt und bist ihr nahe in ihrem Suchen nach rettenden Auswegen und guten Nachrichten. Sei unser Nächster, auch wenn es Abend wird und der Tag sich neigt. Bleib und gib dich uns zu erkennen. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit.
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Emmaus in Coronazeiten
Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit A zu Lk 24, 13-28b
Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen/Heimbach)
Liebe Gemeinde,
Ostern 2020 war kein sonderlich mobiles, auto-mobiles Fest. Die Autobahnen waren frei, beliebte Wanderwege hingegen bevölkert. In diesem Jahr waren wir keine Fernreisende; eher waren und sind viele von uns in diesen schönen Frühlingstagen unterwegs – so wie diese beiden Emmausjünger aus dem heutigen Evangelium; zu zweit oder allein, im stillen Zwiegespräch oder im Selbstgespräch, unter freiem Himmel, im Blick auf die schöne Schöpfung; aufgebrochen mit schwerem Herzen, das Menschen einander ausschütten, oder mit leichtem Schritt. Die Emmaus-Paarung ist vertraut in diesen Tagen: vielerorts sehen wir zwei Spaziergänger, die sich in gehörigem Abstand auf eine Parkbank setzen und ihr Leben teilen, ihre Sorge und Angst, ihre tiefsten Wünsche und kleinen Fluchten, ihre Ohnmacht und Resignation und Trotz, ihre enttäuschten Hoffnungen und kleinen Freuden, die geplatzten Termine, den Verlust des bisher so eingespielten Lebens, ihr Tasten nach Normalität, ihre Sehnsucht endlich dort anzukommen, da wo es besser ist. Wir Wanderer durch diese seltsame Zeit gehen unsere Wege und bleiben zuweilen traurig stehen, schütteln den Kopf über all die Widerfahrnisse, die die Welt in diesen Wochen überfordern.
Unwirklich kommt es einem vor: zwei Wochen schon nach Ostern. War Ostern schon, wo wir es gar nicht so richtig gefeiert haben…? Manche schwelgen in ihren Gesprächen in schönen Erinnerungen, wie es vorher war, rückwärtsgewandt, vor der Krise…. Ein bisschen Tunnelblick – noch ohne Licht am Ende. Manche entdecken in diesen Tagen im Gehen neue Möglichkeiten oder in der Begegnung einen Trost.
Wenn wir in diesen Tagen spazieren gehen und nicht in systemrelevanten Berufen dienstverpflichtet oder an das Bett gefesselt sind , dann sind wir privilegiert; wir gehen keinen schweren Gang wie so viele Schwerkranke und in ihren Heimen Isolierte; wir sind nicht auf unsere vier Wände zurückgeworfen wie in anderen Ländern mit strenger Kontaktsperre. Wir dürfen uns bewegen, das Weite und das Freie suchen. Das müssen keine religiösen Wege sein. „Emmausweg“ ist da zu hoch gegriffen. Und ob ich ein Auferstehungsjünger (geworden) bin, das steht noch dahin…
Gehen ist Therapie, das macht den Kopf frei. Vielleicht hatten wir zuvor selten Zeit, einfach nur zu gehen… Wenn wir zusammen ein Stück des Weges übers Feld gehen, dann sind es selten Bibel- und Glaubensgespräche. Zumeist sind mit anderem beschäftigt; das Bedrückende dieser Tage bricht dann aus uns heraus. Vielleicht bleiben wir bei unserem Austausch hängen im Ventilieren der bedrückenden Themen des Tages, tauschen Informationen, Gerüchte, Tipps aus. Finden wir überhaupt noch Zeit und Ruhe, über was anderes zu sprechen als über die Wucht der Viren-Krise dieser Tage und ihre Folgen? In dieser Phase der Krise gehen wir auf Sicht, wir stochern im Nebel herum, wir tapsen innerlich nach vorne, in kleinen Trippelschritten, wollen kleine Erfolge sehen, hoffen auf Licht am Ende des Weges, auf ein gutes Ziel und auf endlich bessere Nachrichten. Und wir ahnen, dass dieser Weg kein Sprint, sondern ein Marathon sein wird. Mit unseren Tagesthemen hängen noch dazwischen, immer noch in der Karwoche, zwischen Karfreitag und dem Aufblitzen des Osterereignisses.
Schwer ist es also, zu verstehen, dass es längst Ostern geworden ist. Nutzen wir das Traumwetter zu Emmauswegen, gerade in diesem Jahr! Vielleicht suchen Sie jemanden auf, mit dem Sie sich wie die Jünger auf den Weg machen, mit dem Sie über ‚Gott und Welt‘ sprechen? Mit der Sie ins Erzählen kommen über das, was sich in Ihren letzten Tagen, in Eurem Umfeld ereignet hat Und wo Ihnen vielleicht Gott Ihnen besonders nahekam oder wo Sie ihn nicht erkannten. Und: Welche Frage würden Sie in dieser Weltzeit Jesus stellen?
Mit unseren Wegerfahrungen spuren wir heute ein auf den Weg der beiden Emmausjünger. Das war kein Nachmittagsspaziergang, um sich die Füße zu vertreten; das war die kleine Flucht aus einer gefährlichen Stadt aufs Land, zurück in die Provinz, in die Heimat. Das war ein Weg der verabschiedeten Hoffnungen. Seltsam leise ist der Auferstandene dabei hinter ihrem Rücken. Ein Wanderer durch die Zeit, ein Unbekannter, ein Unerkannter. Wie kann man auch ahnen, dass er uns auf der Spur ist, dieser verborgene Begleiter, der uns nie im Stich lässt? Denn nicht nur meine Augen sind gehalten in diesen Tagen. Ich frage mich, wann werden mir die Augen aufgehen? Habe ich ihn wahrgenommen, wie er mich über die Schultern hinweg gefragt hat, worüber ich mich gerade unterhalte, was uns auf den Nägeln brennt? Wann wird uns das Osterwunder geschehen, dass wir besser sehen, klarer, dass wir intensiver als sonst hoffen auf einen rettenden Ausweg, auf Erlösung. Mein Herz ist womöglich noch kalt und versteinert trotz des Funkens von der Osterkerze; das brennende Herz, das fehlt mir, dass brauchen wir, damit wir ihn schmerzlich vermissen… Auch diese Krankheit kann uns überfallen: dass wir das Brennen im Herzen verlieren! Herzenscoolness oder Herzbrennen?
Jesus ist auf dem Emmausweg der beiden erst einmal – wie es sich gehört - auf Abstand, in sicherer Distanz, schleicht sich leise von hinten heran und dann kommt er ihnen als plötzliche Überraschung so nahe… Darf er, dieser Fremde, sich so einfach an uns heranmachen? Er ist nicht zögerlich; er klinkt sich ein in unsere Themen und fragt uns aus. Doch dann bringt er uns auf neue Gedanken, stößt uns in das Buch des Alten Bundes, entfaltet in diesem Schriftgespräch unter freiem Himmel sein Geschick aus dem ersten Testament. Doch so wichtig das Alte und das Neue Testament sind, das Christentum ist keine „Buchreligion“ wie der Islam, der in diesen Wochen seinen heiligsten Monat Ramadan begeht.
Nicht das Buch macht es, sondern die Begegnung mit einem Lebenden. Und dann die Wende am Ende des Emmausweges fast am Ziel. Der Bittgottesdienst der Jünger: Lieber Weggenosse, bleibe und werde unser Tischgenosse! Du kannst jetzt nicht einfach weiterwandern und auswandern aus dieser Welt, denn es wird Abend und dann Nacht. Laufe nicht weiter, zerstöre nicht unsere gerade erst aufkeimende Hoffnung, wir wollen mehr von dir! Bleibe bei uns, damit wir spüren, dass Ostern gilt und nicht abgesagt ist! Bleibe bei uns mit den Worten, die uns fehlen! Bleibe bei uns, damit es für uns alle einen Ostermorgen gibt! Bleibe, damit wir ein Herzbrennen spüren und der Oster-Jubel leise weiterklingt in unseren Herzen! Bleibe bei uns, damit auch wir unser Emmaus erreichen und erleben und weit über den Horizont dieser Welt hinaus zu hoffen wagen! Bleibe bei uns, damit wir in all den dunklen Geschichten von Krankheit und Tod und Existenzangst und Einsamkeit deinen leisen Hoffnungsschimmer wahrnehmen…!
Bleibe bei uns, damit du uns endlich – irgendwann in normaleren Zeiten – dein Brot brichst! Denn das Brot des Lebens vermissen unsere Kommunionkinder, diesmal in Nideggen-Schmidt und Heimbach-Hergarten. Und vielleicht sitzen in diesen Stunden Familien in einer Art round-table-Gespräch um den Küchen- oder Wohnzimmertisch zu Hause, in Eurem und in Ihrem Emmaus, und beten: „Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast“ und noch bescheren wirst… Ein solcher Emmaus-Gottesdienst ist auch zu Hause möglich in Coronazeiten. Wir vermissen dich, Herr und Dein heiliges Brotbrechen. Wir wollen deinen gebrochenen Leib bald gemeinsam kosten, diesen Vor- und Nachgeschmack von Ostern. Wir wollen dich Augenöffner und Herzspezialist bei uns haben.
Wir wollen sie spüren und berühren und kosten, die Erlösung, die essbare Ermutigung Jesu: Ich bleibe bei euch. Ich bin bei euch alle Tage. Wo zwei oder drei wie diese Emmausjünger zusammen sind, da ist dieser fremde Gast mitten dabei. Habe ich Ihn gebeten, ja ‚genötigt‘, in diesen Wochen Gast zu sein? Gab ich ihm Gelegenheit zu bleiben und sich einzumischen in unsere Gespräche, einzuspuren auf unsere Glaubenswege, Krankheitswege, Suchbewegungen, in das Zweifeln und Fragen, das Spekulieren und Rätselraten?
Der Emmausweg 2020 bleibt seltsam, weil das Ziel, das heilige Abendmahl fehlt, das Er den Seinen reicht. Irgendwie bricht das Emmausweg für uns in diesem Jahr ab, ohne Brotbrechen. Uns bleibt aus der Ferne das Ahnen, dass er da ist - anhand der Bruchstücke der Mahlzeit, auch wenn wir seine Nähe nicht sinnlich schmecken. Eine digital gefeierte Mahlzeit macht nicht satt. Damit kann ich Ihn nicht im Glauben ‚begreifen‘.
Vielleicht geht in diesem Jahr die andere schwere Seite des so sympathischen Emmaus-Evangeliums uns auf: Die Osterfreude ist nichts Lautes und Aufdringliches; sie ist wie ein Weizenkorn, das allmählich wächst. Der Emmausweg ist lang und verschlungen, hinein in den dämmrigen Abend, in den Ort des Brotbrechens. Und: Jesus ist nicht nur der Gegenwärtige und Nahe, er ist auch der, der auf Distanz geht und ausgerechnet in dem Augenblick verschwindet, wo er sich den Jüngern reicht. Nach Ostern sind wir eingeladen, Jesu an ganz anderen Orten als nur in einer leeren Kirche zu suchen und die Verborgenheit Gottes, die Unsichtbarkeit Christi auszuhalten; den unsichtbaren Dritten, der unser Herz berührt und der uns allen einmal wieder das Brot des Lebens bricht.
Kurt Josef Wecker
2. Sonntag der Osterzeit A (Weißen Sonntag)
Vorschlag: Kurt Josef Wecker
Eröffnung
Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist längst in unsere Mitte getreten, unmerklich und geheimnisvoll feierst du dein Entgegenkommen. Öffne uns für dein heiliges Kommen und Dasein. Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, seit deiner Auferstehung ist niemand vor dir sicher, kein Raum kann sich vor dir abschließen. Vergib, wenn wir immer wieder versuchen, ohne dich durchs Leben zu kommen. Christe eleison.
Herr Jesus Christus, wir können dich nicht sehen und ertasten wie Thomas, und doch bist du hautnah bei uns. Richte uns aus auf dich, wenn wir in uns verkrümmt sind. Kyrie eleison.
Tagesgebet
Gott, Jesus lebt. Er lebt nicht für sich. Er will sein Ostern nicht ohne uns feiern. Er geht weite Wege, um zu uns zu kommen und teilt uns seinen Lebensatem mit. Er will uns schenken von dem, was er ist und was er hat. Wir glauben, dass er nun zu uns tritt und diesen Raum mit seiner Gegenwart erfüllt. Öffne uns, jedem nach seiner Art, für dieses Geheimnis. Gib uns Hände, die nach ihm tasten, ein Herz, das für ihn schlägt und einen Mund, der sich nun vom Atem deines Sohnes füllen lässt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn und Gott, der mit dir und dem heiligen Geist lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit. Amen .
Gabengebet
Gott, wir haben Brot und Wein auf den Altar gestellt, damit dein Sohn in der Kraft des Geistes unter uns tritt und diese Zeichen wandelt und auch uns verwandelt – zu österlichen Menschen. Blicke auf diese Gaben und sieh auf uns. Schenke uns in dieser schweren Zeit das Wunder seiner Gegenwart. Darum bitten wir, durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Schlussgebet
Gott des Lebens, dein Sohn ist der Herr und die Mitte dieser Feier. Er gibt uns Grund zum leisen Halleluja und verleiht uns Mut, aus uns herauszugehen. Er bewegt uns aus der Erstarrung und traut uns zu, Zeuginnen und Zeugen seiner unwiderruflichen Nähe zu sein. Auf ihn sind wir alle angewiesen. Wir danken dir für deine Geduld, deine einfallsreichen Wege zu uns. Lass uns als österliche Menschen vor dir leben – im Anhauch deines Geistes. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn.
LiedvorschlägeGL 224 Vom Tode heut erstanden istGL 221 Ihr Christen singet hocherfreut (bes. Str. 7-12)GL 222 Nun freue dich, du ChristenheitGL 546 Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot (bes. Str. 4)GL 617 Nahe wollt der Herr uns seinGL 298 Herr, unser Herr, wie bist du zugegenGL 547 Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ)Ist das der Leib, Herr Jesu Christ (Diözesananhänge)Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (Kanon)
Fürbitten
Diese Welt voller Dunkel und Ungewissheit liegt im Osterlicht. Nie wird sie aus den Händen des Schöpfers und Vollenders fallen. So rufen wir in der Kraft des Geistes:
- Wir bitten in leeren Kirchen für die, die uns fehlen, die wir vermissen, für die, die sich oft lautlos und unmerklich aus unserer Mitte entfernt haben und für die, die nun gerne mit uns diesen Ostertag feiern würden.
- Wir bringen vor dich die Menschen, die um ihr Leben ringen, die auf den Intensivstationen betreut werden und die dort eine vertraute Stimme, ein geliebtes Gesicht vermissen. Schaffe du eine Brücke von Herz zu Herz, wo Menschen einander nicht besuchen und beistehen können.
- Besonders beten wir für die Kinder, die dir heute oder in den kommenden Wochen zum ersten Mal eucharistisch begegnet wären und die nun traurig und enttäuscht sind. Lass sie erwartungsvoll bleiben und die Vorfreude bewahren auf das Fest, das ihnen nicht genommen wird.
- An diesem zweiten Sonntag der Osterzeit beten wir für die Kirchen des Ostens, die heute unter erschwerten Bedingungen das Osterfest begehen und für die Einheit deiner Kirche, die allein darum lebt, weil du, Herr sie besuchst und beatmest.
- Sei bei den Familien und in Ehen, die es schwer haben. Behüte sie vor Unfrieden und Gewalt und schenke Zeit für das Gespräch und Vergebung, für Spiel und Tischgemeinschaft.
- Wir bitten für alle, die in diesen Tagen das Notwendigste tun und mehr als das; bei denen, die der Ansteckungsgefahr näher sind als viele andere: im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, Altenheimen und in der Tagespflege. Und lass die Forschenden im Kampf gegen die Krankheit Erfolge erzielen.- Schenke uns ein dankbares Herz für jeden Tag des Glücks, den du uns schenkst; gib allen einen Sinn für das Leben, das an seinen Grenzen auf dich verweist.
- Am achten Tag der Woche beten wir für alle, die ihr Leben vollendet haben und die in der Nacht des Todes nach dir tasten und auf dein Wort des Lebens hoffen.
Im Gebet halten wir dir, Gott, die Tür zu deiner Welt offen. Wir nehmen diese zerbrechliche Welt ins Gebet und tragen das Zerbrechliche und Gefährdete vor dich. Wir trauen dir Großes zu, wir vertrauen deiner Verheißung. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen
Weißer Sonntag 2020 – in der Coronazeit
Predigt von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen/Heimbach) über Joh 20, 19-31
Liebe Schwestern und Brüder, besonders auch liebe Kommunionkinder,
da hockt eine seltsame Ostergemeinde zusammen. Und wir spüren beim Zuhören des Osterevangeliums die Traurigkeit, die beklommene und ratlose Stimmung, die diese Männer erfüllt. Sie kommen nicht raus. Sie geraten nicht außer sich, sie müssen im eigenen Saft hocken bleiben. Reduzierte Teilnehmerzahl: 10 Männer am Osterabend - am achten Tag eine Woche später sind es 11 – also keine Massenansammlung. Von Aufbruch zu neuen Ufern keine Spur; keine Visionen, keine Reisen, gar Missionsreisen bis an das Ende der Erde. Eng zusammengeschweißt, abgeschottet von der Außenwelt, auf sich zurückgeworfen, so hockt die heilige apostolische Kirche beisammen.
Diese Selbstkasernierung der frühen Kirche ist auffallend und doch irgendwie verständlich, eine selbstgewählte Quarantäne. Männer, denen der leitende Kopf fehlt, ohne Mumm und Saft und Kraft. Die Karwoche ist für diese 10/11 Männer noch nicht zu Ende, und Ostern – wenn überhaupt – ein fernes Gerücht, illusionäres Frauengeschwätz. Ja, so kann es sein: Draußen ist es Ostern geworden; doch keiner geht hin und die Kirche kriegt es nicht so richtig mit. Die frühe Männerkirche leckt eher selbstbezogen ihre Wunden. Ein enttäuschter Elferrat ist ratlos und fragt sich in endlosen Stuhlkreisgesprächen, wie es nun weitergehen soll ohne Ihn, ob sie in ihr altes Leben zurückkehren sollen.
Ja, diese Truppe muss sich im Obergemach die Zeit vertreiben. Viele sind in diesen Wochen der Kontaktbeschränkung verurteilt zum Ausharren in ihren eigenen vier Wänden und fragen sich: Wie entkomme ich dem Lagerkoller, der Langeweile? Manche finden Ablenkung in Spielen, Lesen, Musik hören, Telefonieren, im Aufräumen und Wegschaffen, bei der Wohnungsrenovierung oder Gartenarbeit, im Betrachten von Fotos früherer Urlaubsreisen, auch im Ausprobieren neuer Formen der Glaubenspraxis. Andere erfahren sich trotzdem als antriebslos, sie vermissen die Normalität, die leibhaftigen Begegnungen, das Gewusel des Alltags.
So sind viele Zeitgenossen augenblicklich den Stubenhockern im Obergemach in Jerusalem nahe, dieser apostolischen Kirche in Schockstarre. Nein, den Mut zum Aufbruch kann niemand sich selbst einreden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann säßen sie noch heute dort. Immerhin ein Gutes: Kirche blieb damals zusammen, widerstand dem Fluchtimpuls. Die Männer hätten sich ja auch zerstreuen und nach Galiläa zurückschleichen können. Nein, sie blieben in einer Solidargemeinschaft an einem symbolträchtigen Ort auf dem Berg Zion in Jerusalem beieinander. Dieser Zusammenhalt ist das Positive an dieser traurigen Gesellschaft Jesu.
Manche Kritiker, auch manche Gläubige, werfen der Kirche in diesen Wochen vor, sie sei sehr botmäßig gewesen, habe sich allzu schnell und gehorsam staatlichen Anordnungen zum Kontakt- und Versammlungsverbot gebeugt, die über sie verhängt worden sind. Manche sagen, die Kirchen seien zu sehr in Deckung gegangen, hätten sich verkrochen, seien von der Bildfläche der Öffentlichkeit in virtuelle Welten verschwunden. Verborgene Kirche im Shutdown, in Selbsteinschließung, im Krisenmodus, im Pausenmodus, nur noch Online präsent… Darf die Kirche ihre Türen schließen? Wozu ist die Kirche da – gerade in dunklen Tagen? Und ist Ostern nur noch ein verzichtbares kulturelles Erbe? Wie lange wird das so bleiben? Wie lange hält man dieses Selbstabschließung aus? Wann dürfen wir wieder raus? Wann dürfen wir uns wieder an das Licht der liturgischen Öffentlichkeit wagen?
Christi Ostertag lässt sich nicht verschieben und verhindern, durch keine Macht der Welt und der Kirche. Ostern geschieht trotzdem, auch unabhängig von der verschreckten apostolischen Männer-Kirche, die sich zurückgezogen hat.
Jesus setzt sich über jegliche Besuchsverbote und Abstandsregeln hinweg. Das ist seine Souveränität! Seine königliche Freiheit! Seine nun allerdings wunderbare ‚Heimsuchung‘. Er bricht sich Bahn ins Obergemacht und tritt in die beklommene Stille, in das orientierungslose Suchen und Fragen der Jünger hinein; er durchbricht, unterbricht diesen heillosen Zustand. Draußen passierte seine Auferweckung in aller Herrgottsfrühe; und Er muss des Abends in den Abendmahlssaal hineinkommen, in eine Männergesellschaft, für die Ostern ein ungefragtes Ereignis ist.
Ich weiß nicht, womit sich diese Männer die Zeit vertrieben haben. Mit Beten? Mit Diskutieren? Mit Schuldzuweisungen? Mit Selbstmitleid? Mit dem Schmieden von Plänen für die Zeit danach? Zerstreut oder andächtiger Stille? Haben sie die Auferstehung Jesu geahnt, ersehnt? Oder innerlich die schöne Zeit mit ihm abgehakt? Wurden latente Vorwürfe an Jesus laut, dass er es mit seinem provokanten Auftreten auf die Spitze getrieben und auch seine Anhänger in Gefahr gebracht hat? Warum auch musste er in das Hochrisikogebiet Jerusalem kommen?
Dass sich diese Krise zum Guten wendet und diese Männer wieder einen Weg ins Leben finden, das entscheidet Jesu Kommen. Die Kirche muss überrascht und überrumpelt werden durch den, der ungefragt kommt. Er hat uns nicht vergessen in der Krise, er haut nicht ab. Er muss die Initiative ergreifen und ‚von außen‘ kommen, auch wenn niemand nach ihm fragt und niemand sein Kommen für möglich hält. Aus uns selbst heraus wissen wir nicht, was Ostern ist. Doch ER bringt Glanz und Bewegung in den stickigen Raum und muss kommen, um meinen Osterglauben zu erwecken. Er ruft: Aufwachen und tief durchatmen!
Nicht der Glaube der Kirche weckt ihn auf, sondern Er erweckt den Glauben an ihn. Die Jünger leben nicht, als sei Jesus auferstanden. Sie können nicht so tun als ob… ER muss sich aus freien Stücken bemerkbar machen. ER muss ihnen ‚ins Auge stechen‘ und aufblitzen in ihrer Mitte. Dann erst können sie glauben. ER sucht die Kirche auf, die den Glauben an Jesu lebendige Gegenwart verloren hat. Aus uns heraus wissen wir nicht, was kommen mag.
ER kommt, wenn keiner ihn für möglich hält, und er hält sich nicht an das Besuchsverbot. ER ist so frei, um zu sagen: Ich komme ohne Eintrittskarte und Voranmeldung. Kirche spürt ihre Verletzlichkeit. Und ER zeigt uns, die wir unsere Wunden lecken, seine fünf Wunden. Der Gekreuzigte konfrontiert uns mit seiner Versehrtheit. Jesu spürt die Verletzlichkeit seiner Kirche ohne ihn, vielleicht ihre Selbstzweifel: Wie systemrelevant sind wir noch? Jesus zeigt ihnen seine eigene Verletzlichkeit. Die in die Osterkerze gebohrten Wundmale erinnern daran. An den Wunden bleibt er identifizierbar auch nach Ostern.
Für ihn gelten die Abstandsregeln nicht, die wir zu Recht für uns beachten, den Sicherheitsabstand und die Besuchsrestriktionen, die wir zu akzeptieren haben, weil es um den Schutz der Schwächsten geht. Halten wir uns diese von ihm völlig außer Acht gelassene soziale Distanz vor Augen! Thomas darf ihn sogar mit ungewaschenen Fingern berühren. (Heute feiern die orthodoxen Kirchen Ostern, und wir lesen in der Zeitung, wie schwer es orthodoxer Frömmigkeit fällt, auf das Küssen von Ikonen, Kreuzen und Reliquien zu verzichten, auf den gemeinsamen Empfang des Leibes Christi mit dem gemeinsam(!) genutzten Kommunionlöffel).
Der nahe Christus atmet, er bläst sie an; so ganz ohne Schutzmaske. Er darf das. Er wiederholt die Mund-zu-Mund-Beatmung des Schöpfers, als er Adam, dem Staub-Menschen, den Odem einblies. Jesus, der neue Adam, steckt die Seinen an mit seiner österlichen Lebenskraft. Die Apostel dürfen Gottes Lebenskraft inhalieren. Und so nimmt er ihnen die Angst, verbreitet den Geist des Trostes und des Mutes. Er flößt ihnen die Freude und den Frieden ein. Von dieser spürbaren Zuwendung ihres Herrn lebt die Kirche. Jesus spürt: Ich kann es nicht nur bei virtueller Gegenwart belassen. Kreativ schafft er sich plötzlich Zugang in den Quarantäne-Saal der Jünger. Leibhaftig will er erscheinen, lässt sich Berührung gefallen und auch unser leises „Christos anesti“, Christus ist auferstanden, wie es die Orthodoxen heute zurückhaltend und in kleinem Kreis singen.
Jesu Aufscheinen unter uns, das feiern wir erneut so zurückhaltend und virtuell. Doch sein Besuch bei der Kirche bricht nie ab. Er besucht Sie und Euch in unseren Hauskirchen, tritt ein unter Ihr Dach.
Und das werden wir leibhaftig feiern, wenn wir wieder zusammenkommen dürfen, wenn unsere Kommunionkinder ihn endlich anfassen und empfangen dürfen und seine Nähe spüren. Er möchte uns wiedersehen. Sakramental wird er sich dann in Griffweite bringen, in greifbare Nähe. Dann wird er uns erlösen von unserem Lagerkoller und uns auf ganz neue Gedanken bringen. Und dann öffnet er uns die verschlossenen Kirchentüren. Seine pfingstliche Mund-zu-Mund-Beatmung lassen wir uns gefallen. Und alles werde anders nach dem Ausnahmezustand des Osterereignisses!
Kurt Josef Wecker
Die Feier der Osternacht mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Segnung der Osterkerze
Pfarrer Kurt Josef Wecker hat die Osterkerze am Osterfeuer entzündet
und alle Osterkerzen gesegnet
Osternachtpredigt in Coronazeiten über Mt 28, 1-10
Gedanken von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen-Heimbach)
Liebe Mitchristen,
oft wird in Italien in diesen Tagen an ein literarisches Meisterwerk erinnert; als 1348 in Europa die Pest wütete, schrieb der italienische Schriftsteller Boccaccio zwischen 1349 und 1353 seine Novellensammlung „Das Dekameron“. Zehn junge Edelleute, sieben Frauen und drei Männer, fliehen vor der Seuche in ein Landhaus bei Florenz und vertreiben sich die Zeit, indem sie einander einhundert Geschichten erzählen, unterhaltsame, schlüpfrige, spannende Geschichten zum Überleben. ‚unterhaltsame‘ Geschichten gegen die Krankheit, Geschichten gegen den „schwarzen Tod“.
Die Ostergeschichte, wir müssen sie uns sagen lassen. Wir erfinden sie nicht, um uns gegen den Tod zu zerstreuen oder uns abzulenken und zu vertrösten. Gott liebt Geschichten, und Jesus ist ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Ganz leise kommt die Ostergeschichte in diesem Jahr auf uns zu; wir flüstern sie uns zu wie ein wunderbares Gerücht, von Haus zu Haus, wir brauchen sie, diese gute Nachricht, dringender denn je. Nicht als vielstimmiges Halleluja, sondern als leise Hoffnung. Wir müssen keine Geschichten erfinden, wir dürfen sie uns immer wieder sagen und verkündigen lassen, nichts selbst Ausgedachtes. Die Geschichte vom guten Ausgang des Lebens Jesu, vom Licht, das uns leuchtet, sie ist mehr als Mutmach-Geschichte. Sie erzählt von dem, der unser Leben vollenden will. Eine Geschichte des Lebens gegen all die Passionsgeschichten, die uns in diesen Wochen erschüttern.
Die kleine Ostermorgengeschichte am leeren Grab (Mt 28, 1-10) habe ich so oft schon verkündet und zu normalen Zeiten überlese ich Details, die mir heute ins Ohr springen. Was, waren es am Anfang wirklich nur zwei Frauen? Sind wirklich nur zwei dabei, als das ungeheuerste Ereignis des Glaubens geschah? O ja! Ostern ist ein sehr intimes Fest, es dringt nicht an die große Öffentlichkeit und wird zunächst auch nicht an die große Glocke gehängt. Ein so kleines Fest, obwohl es alle Welt angeht: urbi et orbi. Zwei Frauen, Maria und Maria Magdalena, verwandt wohl oder miteinander befreundet; zwei Trauernde, die sich an die Ausgangsregeln, an die Ausgangssperre des Sabbats halten und die sich ganz in der Frühe rauswagen, wo es kein Gedränge gibt, wo die Straßen und auch der Friedhof noch leer sind. Sie kommen nicht hinaus vor die Tore der Stadt, weil sie sich die Beine vertreten wollen und Frühlingsgefühle sie überkommt. Sie kommen, weil sie ihren Jesus vermissen und zumindest dem Toten etwas Gutes antun wollen, dem Gekreuzigten, der am Abend des Freitag in aller Stille im allerengsten Kreis von Sympathisanten beigesetzt worden ist. Man kann es überlesen, wie überschaubar die erste Ostergemeinde war, zwei oder (bei Markus) drei Frauen. Das war’s. Zwei Friedhofsgängerinnen mit ihren Salbgefäßen, die das erste Ostern begingen auf dem Friedhof vor den Toren der Stadt Jerusalem. Richtig gelesen: Osternacht mit 2 Menschen - mehr nicht. Ganz klein und allmählich beginnt das Größte. Bei Jesu Auferstehung sind keine Zuschauer dabei, die Applaus spenden (Applaus ist ein fremd gewordenes Geräusch in diesen Tagen, soweit er nicht auf den Balkonen den Helferinnen gezollt wird) ; Gott handelt in aller Ruhe; der erste Ostermorgen ist nur ein winziger Frauen-Wortgottesdienst unter freiem Himmel vor einem leeren Grab. Ostern für eine Kleingruppe, der ein Engel eine kurze Osterpredigt hielt, vor der sie mit gemischten Gefühlen davonlaufen – ohne zu ahnen, dass sie ihrem Christus dabei vor die Füße laufen. ER kennt nicht die Regel der Kontaktsperre. Er lässt die Berührung seiner Füße zu. Wo zwei oder drei mit ihren Salbgefäßen traurig und ratlos zusammen sind, wo eine Kleingruppe nach Christus sucht und Ihn vermisst, da kommt er ihnen entgegen, da ist Er mitten unter ihnen. So schön unsere vollen Gottesdienste sind und so sehr wir die volle Kirche vermissen, so imponierend ein voller Petersplatz ist: Das allererste Ostern bewegt keine Massen. Ostern fängt senfkornklein an. So klein geht es übrigens danach weiter mit den Männern: nur Petrus und der Lieblingsjünger, dann das Zusammensein Jesu allein mit Maria Magdalena, für die er der Unberührbare, der Unfassbare bleibt, dann das Zusammentreffen mit 10-11 Jüngern im Obergemach und mit 7 Jüngern am See, der Weg mit den beiden Emmausjüngern.
Alles beginnt einem Ort der Leere. Das leere Grab - die leere Kirche. In diesem Jahr spüren wir, dass Ostern ein schweres Fest ist. Es ist schön schwer! Selbst das Brot, das der Auferstandene den Jüngern in Emmaus ausgibt, wird uns fehlen. Wir vermissen so vieles: den überwältigenden Moment, wenn sich das Licht verteilt und sich auf die Gesichter legt. Äußerlich in diesem Jahr ein blasses Fest, und ein Online-Gottesdienst ein schaler Ersatz; und doch ist Gottes Tag unaufschiebbar; wir werden nicht leer ausgehen. Es bleibt uns sein Wort und sein Versprechen und sein Geist und die ‚geistliche Kommunion‘. Es bleibt das unverhoffte Wiedersehen mit Ihm in unseren vier Wänden, beim Frühlingsspaziergang, bei der Nachbarschaftshilfe… Da ist er überraschend dabei, so wie es den Frauen erging, die Jesu leises Entgegenkommen erfuhren.
Herr, wir brauchen dich! So dringend brauchen wir dieses Fest und den Engel, der Licht am Ende des Tunnels verkündet! Kleinlaut und stotternd begehen wir Ostern - und doch auch ein wenig trotzig, im Geist des „Jetzt erst recht“! Mit brennenden Kerzen in den Fenstern und auf den Wohnzimmertischen; mit brennenden Fragen auf dem Herzen! Ja, es wird wieder blühen („Andrá tutto bene“ – „Alles wird gut“, wie sich die Italiener zusprechen). Wir möchten sie hören: die gute Nachricht von Ostern. Seit Ostern wird nichts mehr in der Welt sein wie zuvor.
Ich wünsche es uns am Fest der Auferstehung Jesu: Wir wollen Gott und seinen Osterwind einatmen - und das in der Gemeinschaft aller Atmenden. „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe“, heißt es in einem modernen geistlichen Lied. Einer, der uns nahekommen darf, unendlich nahe, und der uns ansteckt mit seiner österlichen Lebenskraft; auch wenn in diesem Jahr alles anders ist. Auch wenn ich mit mir allein bin, bin ich mit Ihm zusammen? Diese tief verborgene, in uns atmende Gegenwart Gottes wollen wir glauben.
„Über was lacht Gott? Über Planung!“ sagte der Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, der dieses geistliche Spiel wegen der Coronakrise absagen und auf 2022 verschieben musste. Ja: Über was lacht Gott? Über Planung! Kirche muss sich bescheiden eingestehen: Unsere Planungen werden durchkreuzt. Wir sind es nicht, die Ostern in der Hand haben. Aus Liebe zu Ostern, das uns nicht gehört, müssen wir auf das öffentliche Ostern verzichten, um so erst richtig zu spüren, was uns fehlt. Wir sind nur Zeuginnen und Zeugen einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Wir geben das Gerücht von seiner Auferstehung weiter, bezeugen einander Geschichten gegen den Tod und die Verzweiflung. Wir feiern das, was wir in diesen schweren Wochen nur zweifelnd und stotternd bekennen: dass ER größere Möglichkeiten hat als wir, dass unsere Hoffnung weit über diese Erdenzeit hinausgeht. In diesem seltsamsten Osterfest der Kirchengeschichte merken wir: Ostern ist keine von der Kirche gemachte Veranstaltung; auch der Kirche wurde Ostern wie eine unverhoffte Nachricht ins Nest gelegt. Auf einmal sind wir auf uns selbst zurückgeworfen, auf unsere nackte gebrechliche Existenz – und auf den Gott, aus dessen Händen wir kommen und der uns auffangen wird, wenn wir fallen. unfassbar! Was wird das für ein Ostern? So viele Gewissheiten und schöne Freizeitgewohnheiten brechen weg, soviel Alltag geht uns in diesen Wochen verloren: Und dann muss auch noch das schönste Fest der Christenheit so seltsam begangen werden, so verborgen, als fiele es aus; so still, als bliebe uns allen das Halleluja im Hals stecken. Viele sind auf sich zurückgeworfen und erleben unfreiwillig ein ruhiges, stilles Fest. Auf Stille und Alleinsein sind wir vielleicht nicht vorbereitet. Fertige Glaubensantworten und triumphale Osterlieder gehen uns in dieser Zeit nicht leicht von den Lippen. Die Kirchen stehen leer, und wir üben uns in „Hauskirche“, feiern am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf der Bettkante das unglaublichste Fest. Manche fragen: Hält auch Gott Abstand von seiner Welt? Ist Er gegenwärtig in den leeren Kirchen? Bleibt Er dieser Welt treu, die so aus den Fugen gerät? Werden wir dem Auferstandenen ganz neu begegnen, dem die beiden Frauen vor die Füße fallen? Wird Er uns anatmen und ‚anstecken‘ mit seiner Lebenskraft?
Das Ostern, auf das wir hoffen, wird mehr sein als die Rückkehr zur Normalität, als Händeschütteln und Umarmen – so sehr wir uns auf solche körperlichen und herzlichen Zeichen der Verbundenheit freuen! Wir hören das ungeheure Versprechen des Ostertages. Uns allen ist Auferstehung versprochen. Es wird eine neue Osterwelt Gottes geben, ohne Schmerz und Leid und Tod, der Tag, an dem Er uns verarztet und uns die Tränen von den Augen tupft..
Nein, diese Geschichte haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Ein Engel ist der große Geschichtenerzähler, und Jesus beglaubigt sie durch sein Entgegenkommen.
Ihnen und Euch gesegnete Ostern!
Fürbitten
Als Bittsteller stehen wir vor dem Auferstandenen: Bitten wir wie die Emmausjünger: „Bleib mit uns“ (Lk 24, 29)! Gehe nicht auf Abstand zu dieser deiner Welt! Geh nicht weiter! Bleibe unser Gast, denn es will Abend werden! Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Welt!
Bleibe bei den Alten und Kranken und Gefährdeten! Bleibe bei denen, die mit dem Tod ringen!
Bleibe bei den Hoffnungslosen und Ratlosen, die nun einen Engel der Frühe brauchen, der sie aufrichtet!
Bleibe bei den Einsamen, die nun noch einsamer werden. Bleibe bei den Ängstlichen, die nun noch ängstlicher werden. Bleibe bei den Gefährdeten, die jetzt noch gefährdeter sind.
Bleibe bei denen, die nun stark sind und sein müssen in dieser schweren Zeit, bei den Helden und Heldinnen dieser Zeit: den, Ärzten und Ärztinnen, den Krankenschwestern und Pfleger-innen, den Sicherheitskräften, den Verkäuferinnen, den Politikern und Wissenschaftlern.
Bleibe auch bei denen, die nun nicht stark sind, die nicht stark sein können und auch nicht stark sein müssen: bei den Hoffnungslosen, den Überforderten, den Depressiven.
Bleibe bei denen, die Gott nicht verstehen, denen die Kraft zu glauben vergangen ist; bleibe bei denen, die nach neuen Worten und Wegen suchen, das schwere Geheimnis Gottes zu bezeugen!
Bleibe bei denen, die uns Zuversicht schenken in dieser Zeit, bei denen, die uns in diesen schweren Tagen aufmuntern und uns zum Lächeln bringen!
Bleibe bei den Kindern und allen die fragen: Wie lange noch? Bleibe bei den Irritierten und Hilflosen.
Bleibe bei uns endlichen Geschöpfen und deiner Kirche - und lass uns hoffen auf den neuen Himmel und die neue Erde, auf den Ostermorgen, den du auch uns bereiten wirst.
Bleibe bei den Sterbenden, bei unseren Verstorbenen, all den namenlosen Toten und bereite ihnen das Fest der Auferstehung.
Herr Jesus, bleibe und schaffe Licht aus Finsternis. Lass uns spüren, was uns fehlte ohne dein Ostern. Lass uns Ruhe und Rettung finden in dir. Das erbitten wir, durch Christus unseren Herrn.
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Evangelium zu Ostersonntag 2020 (Johannes 20,1-18)
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens,
als es noch dunkel war,
zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen:
Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen,
und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab;
sie liefen beide zusammen dorthin,
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus,
kam er als erster ans Grab.
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen,
ging aber nicht hinein.
Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war,
und ging in das Grab hinein.
Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch,
das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte;
es lag aber nicht bei den Leinenbinden,
sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.
Da ging auch der andere Jünger,
der zuerst an das Grab gekommen war, hinein;
er sah und glaubte.
Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift,
dass er von den Toten auferstehen musste.
Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein.
Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen,
den einen dort, wo der Kopf,
den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.
Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?
Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen,
und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Als sie das gesagt hatte,
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen,
wusste aber nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du?
Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm:
Herr, wenn du ihn weggebracht hast,
sag mir, wohin du ihn gelegt hast.
Dann will ich ihn holen.
Jesus sagte zu ihr: Maria!
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm:
Rabbuni!, das heißt: Meister.
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest;
denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.
Geh aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater,
zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen:
Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
Wort des lebendigen Gottes.
Aufstehen
jeden Tag wieder neu aufstehen , jeden Tag wieder neu beginnen , Aufstehen
jeden Tag geht der Herr mit, jeden Tag ist er da, Aufstehen
jeden Tag das Geheimnis neu entdecken, jeden Tag ihn wahrnehmen, Aufstehen
jeden Tag seine Botschaft hören, jeden Tag gestärkt leben, Aufstehen
jeden Tag auf´s neue, jeden Tag mit ihm sprechen, Aufstehen
jeden Tag seine Gegenwart im Herzen brennen spüren, jeden Tag dein Befreiungswerk verkünden, Aufstehen
jeden Tag, Der Herr ist wirklich auferstanden!
(M.T.)
Ostern in Coronazeiten
Gedanken von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen-Heimbach)
Liebe Mitchristen,
unfassbar! Was wird das für ein Ostern? So viele Gewissheiten und schöne Freizeitgewohnheiten
brechen weg, soviel Alltag geht uns in diesen Wochen verloren: Und dann muss auch noch das
schönste Fest der Christenheit so seltsam begangen werden, so verborgen, als fiele es aus; so still, als
bliebe uns allen das Halleluja im Hals stecken. Deutlich leiser wird es sein auf den Straßen und
Plätzen; der Verkehrslärm einer ansonsten mobilen Gesellschaft wird einer ungewohnten Stille
weichen. Viele sind auf sich zurückgeworfen und erleben unfreiwillig ein ruhiges, stilles Fest. Auf
Stille und Alleinsein sind wir vielleicht nicht vorbereitet. Fertige Glaubensantworten und Osterlieder
gehen uns in dieser Zeit nicht leicht von den Lippen. Die Kirchen stehen leer, und wir üben uns in
„Hauskirche“, feiern am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf der Bettkante das unglaublichste Fest.
Die Stille des Karsamstags ist in diesem Jahr ohrenbetäubend und prägt unsere Osterstimmung. Und
manche fragen: Hält auch Gott Abstand von seiner Welt? Ist Er gegenwärtig in den leeren Kirchen?
Bleibt Er dieser Welt treu, die so aus den Fugen gerät? Werden wir dem Auferstandenen ganz neu
begegnen, wird Er uns anatmen und ‚anstecken‘ mit seiner Lebenskraft?
„Von ferne“ (Mt 27,55) sahen die Frauen zu, als Christus starb, als man ihm die Dornenkrone
(Corona) aufdrückte. Auch die Frauen wurden auf dem Golgotha-Hügel zu einem Sicherheitsabstand
gezwungen; sie konnten nicht eingreifen, nicht trösten, nichts verhindern. Klein war die Schar derer,
die das erste Ostern begingen auf dem Friedhof vor den Toren der Stadt Jerusalem. Das Evangelium
berichtet von zwei oder drei Frauen – mehr nicht. Ostern beginnt ganz klein und allmählich. Bei Jesu
Auferstehung sind keine Zuschauer dabei, die Applaus spenden; der erste Ostermorgen ist nur ein
kleiner Frauengottesdienst unter freiem Himmel vor einem leeren Grab. Das erste Ostern ereignet
sich draußen – und wir sitzen drinnen. Ostern für zwei oder drei Frauen, denen „der Engel der Frühe“
(Peter Huchel) erschien (Mt 28,1; Mk 16,1). Wo zwei oder drei mit ihren Salbgefäßen traurig und
ratlos zusammen sind, wo diese Kleingruppe nach Christus sucht und Ihn vermisst, da ist Er mitten
unter ihnen. Wir nehmen uns zurück, um die Gefährdeten unter uns zu schützen. Jesus legt Maria
Magdalena gebieterisch nahe: Halte Abstand! Fass mich nicht an, komm mir nicht zu nahe, halte
mich nicht fest (Joh 20,17)! Fass mir nicht in die Seitenwunde, umarme mich nicht…!
Das leere Grab - die leere Kirche, verborgenes Ostern. Auch das Brot, das der Auferstandene mit den
Jüngern teilt, wird uns fehlen. Wir vermissen so vieles und werden doch nicht leer ausgehen. Es
bleibt uns sein Wort und die ‚geistliche Kommunion‘. So dringend bräuchten wir dieses Fest und den
Engel, der Licht am Ende des Tunnels verkündet! Kleinlaut und stotternd begehen wir Ostern- und
doch auch ein wenig trotzig, im Geist des „Jetzt erst recht“! Mit brennenden Kerzen in den Fenstern
und brennenden Fragen auf dem Herzen! Ostern - der Tag, den Gott gemacht hat, kann zwar von
keiner Menschenmacht abgesagt und keinem viralen Feind zunichte gemacht werden. Aber unserer
Festesfreude sind die Hände gebunden. Manche hatten zwar gehofft, dass ‚es‘ Ostern vorbei sein
wird. Aber nein, wir können kein Ablaufdatum für diese Phase der Pandemie nennen, die uns allen
zugemutet wird und das Leben so vieler akut bedroht. Wir müssen leben mit dem
Unvorhersehbaren, mit der unsichtbaren Bedrohung. Niemand von uns hatte die Pandemie ‚auf dem
Schirm‘, als wir vor Monaten Osterliturgien und Erstkommunionfeiern, Wallfahrtsjubiläen und
(Pilger)Reisen, Sportevents, Familienfeiern und Konzerte planten. Alles abgesagt. Diesen Bruch, diese
Passivität müssen wir aushalten und akzeptieren. Viele unter uns sind Zeitgenossen, die vorplanen
wollen, die alles im Griff haben und weit im Voraus organisieren möchten, die am liebsten alles
Unvorhersehbare ausschalten würden. Und nun müssen wir ein Ereignis verkraften, das so noch nie da gewesen ist und über dessen Verlauf wir keine verlässlichen Auskünfte wagen können. Wir
müssen uns der nackten Wahrheit stellen, dass wir nicht unverwundbar sind. Wir haben nicht nur
eine unsterbliche Seele; wir ‚bewohnen‘ einen sterblichen Leib. Und dieser Leib hat eine
‚Achillessehne‘; und er kann zum ‚Wirt‘ werden für einen gefährlichen unsichtbaren, ansteckenden
Gegner; deshalb können sich die Allernächsten gefährlich werden. Draußen ist es Frühling geworden;
wir haben das Osterlied des Heinsberger Dichterpriesters Wilhelm Willms auf den Lippen: „Alle
Knospen springen auf, fangen an zu blühen“. Ja, es wird wieder blühen („Andrá tutto bene“ – „Alles
wird gut“, wie sich die Italiener zusprechen) – aber wir müssen uns gedulden und momentan diese
„gebrechliche Einrichtung der Welt“ (H. von Kleist) erleiden. Uns fehlt so vieles: Nähe, Normalität,
Lebensfreude. Wir brauchen dich! Wir möchten sie hören: die gute Nachricht von Ostern.
Am Fest der Auferstehung Jesu wollen wir Gott und seinen Osterwind einatmen - und das in der
Gemeinschaft aller Atmenden. „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe“, heißt es in
einem modernen geistlichen Lied. Einer, der uns nahekommen darf, unendlich nahe, und der uns
ansteckt mit seiner österlichen Lebenskraft. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Distanz ist die
heilbringende Nähe. Das müssen wir lernen; das ist auch eine paradoxe Wahrheit von Ostern und
Himmelfahrt. Der Herr ist ‚unfassbar‘ und geht auf Distanz zu seinen Aposteln, um gerade so aller
Welt heilbringend nahe zu sein. Kann ich das glauben: Auch wenn ich mit mir allein bin, bin ich mit
Ihm zusammen? Diese tief verborgene, in uns atmende Gegenwart Gottes wollen wir glauben.
Wir brauchen die Auferstehung dessen, der das Leben ist, der ganz tief hinabsteigt zu uns und damit
das tödliche Risiko der Sterblichkeit mit uns teilt; mit dem, der sich den Tod holt für uns. Wir
brauchen die Auferstehung dessen, der nicht wie der germanische Held Siegfried von der eigenen
Unverletzbarkeit träumt, sondern sich tödlich verletzen lässt und gerade so unserer wunden Existenz
nahe ist.
Der Theologe und Arzt Manfred Lütz sagte in der Rheinischen Post: Uns wird in diesen Tagen in
Erinnerung gebracht: unser Herr ist kein „niedlicher Schönwetter-Gott“, sondern der gekreuzigte,
mitleidende Gott, der uns nicht vor der Krise bewahrt, sondern gerade in der Krise ganz tief
verborgen bei uns ist. Der Gekreuzigte ist der österliche Herr. Nein, der Osterjubel darf den
Kreuzesschrei Jesu nicht übertönen. Der ungebrochene Lobpreis-Glaube und ein überschäumendes
Halleluja-Christentum sind uns nicht möglich. Zurückhaltend und leise, suchend, fragend und
klagend, bescheiden und demütig sind wir unterwegs zum österlichen Herrn.
Wir sprechen nun viel von ‚Zur Ruhe kommen‘, von ‚Innehalten‘, ‚Entschleunigung‘, auch von
‚Einsamkeit‘. Diese ungewohnte Lebensform wird nun auch einer betriebsamen Kirche zugemutet.
Ich hätte mir diese Lehre für die Kirche anders gewünscht als durch einen Virus. Kirche wird in ihrem
Tatendrang gestoppt und zur Demut bewegt, auch zur Untätigkeit verurteilt. Das von außen
erzwungene Innehalten muss unsere Kirche nachdenklich machen. Vielleicht wird sie auf neue Weise
kreativ. Denn oft bewegt sie sich in frommer Geschäftigkeit auf der Stelle; sie läuft heiß im Leerlauf,
verfängt sich in Nebensächlichkeiten, rotiert zuweilen wie im Hamsterrad. Auch die Kirche ist endlich
und zerbrechlich. Manche fragen: ist sie ‚systemrelevant‘ oder eine verzichtbare Institution? Diese
ernste und strenge Zeit kann die Kirche zur Besinnung bringen; wir werden auf die „Essentials“ des
Glaubens zurückgeworfen, auf das, was uns wirklich fehlt, was wir brauchen, wenn uns alles andere
aus der Hand genommen wird; auf das, was wir zutiefst vermissen und hoffentlich auch nach der
Pandemie vermissen werden. Kirche muss sich bescheiden eingestehen: Wir sind es nicht, die Ostern
gestalten. Wir sind nur Zeuginnen und Zeugen einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Wir feiern das,
was wir in diesen schweren Wochen nur zweifelnd und stotternd bekennen: dass ER größere
Möglichkeiten hat als wir, dass unsere Hoffnung weit über diese Erdenzeit hinausgeht. Nein, Ostern
ist keine von der Kirche gemachte Veranstaltung; auch der Kirche wurde Ostern wie eine unverhoffte
Nachricht ins Nest gelegt. Auf einmal sind wir auf uns selbst zurückgeworfen, auf unsere nackte gebrechliche Existenz – und auf den Gott, aus dessen Händen wir kommen und der uns auffangen
wird, wenn wir fallen.
Das Ostern, auf das wir hoffen, wird mehr sein als die Rückkehr zur Normalität, als Händeschütteln
und Umarmen. Wir hören das ungeheure Versprechen des Ostertages. Uns allen ist Auferstehung
versprochen. Es wird eine neue Osterwelt Gottes geben, ohne Schmerz und Leid und Tod. Schon jetzt
begegnen uns „kleine Brüder und Schwestern“ dieser großen Auferstehung: in all den Zeichen der
Solidarität und Rücksichtnahme, der Nachbarschaftshilfe, der selbstvergessenen Einsatzfreude für die
Schwächsten, der Verarztung und Pflege an den Betten der Kranken, dem ‚Opfer‘ der Menschen, die
einfallsreich und mit ihrer kleinen Kraft das Ganze der Liebe Gottes weiterschenken: an die
Schwerkranken und Pflegebedürftigen. Kleine Osterspuren ahnen wir in der Erfahrung der Genesung,
, in der Sehnsucht und Vorfreude, uns nach dieser schweren Zeit wiederzusehen, uns zu umarmen,
den Leib des Herrn gemeinsam zu teilen und zu kosten. Wir beten um den rettenden Einfall im
Forschen der Wissenschaftler, im erhofften Durchbruch in der Seuchenbekämpfung… Eines meiner
Lieblingslieder aus dem Gotteslob ist „Der Mond ist aufgegangen“ (GL 93). Manche singen das
Mondlied abends auf dem Balkon. Da heißt es in der letzten Strophe: „Verschon uns, Gott, mit
Strafen/ und lass uns ruhig schlafen/ und unseren kranken Nachbarn auch.“
Als Bittsteller stehen wir vor dem Auferstandenen: Bitten wir wie die Emmausjünger: „Bleib mit uns“
(Lk 24, 29)! Gehe nicht auf Abstand zu dieser deiner Welt! Geh nicht weiter! Bleibe unser Gast, denn
es will Abend werden! Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Welt!
Bleibe bei den Alten und Kranken und Gefährdeten! Bleibe bei denen, die mit dem Tod ringen!
Bleibe bei den Hoffnungslosen und Ratlosen, die nun einen Engel der Frühe brauchen, der sie
aufrichtet!
Bleibe bei den Einsamen, die nun noch einsamer werden. Bleibe bei den Ängstlichen, die nun noch
ängstlicher werden. Bleibe bei den Gefährdeten, die jetzt noch gefährdeter sind.
Bleibe bei denen, die nun stark sind und sein müssen in dieser schweren Zeit, bei den Helden und
Heldinnen dieser Zeit: den, Ärzten und Krankenschwestern und Pflegerinnen, den Sicherheitskräften,
den Verkäuferinnen, den Politikern und Wissenschaftlern.
Bleibe auch bei denen, die nun nicht stark sind, die nicht stark sein können und auch nicht stark sein
müssen, bei den Hoffnungslosen, den Überforderten, den Depressiven.
Bleibe bei denen, die Gott nicht verstehen, denen die Kraft zu glauben vergangen ist; bleibe bei
denen, die nach neuen Worten und Wegen suchen, das schwere Geheimnis Gottes zu bezeugen!
Bleibe bei denen, die uns Zuversicht schenken in dieser Zeit, bei denen, die uns in diesen schweren
Tagen aufmuntern und uns zum Lächeln bringen!
Bleibe bei den Kindern und allen die fragen: Wie lange noch? Bleibe bei den Irritierten und Hilflosen.
Bleibe bei uns endlichen Geschöpfen und deiner Kirche - und lass uns hoffen auf den neuen Himmel
und die neue Erde, auf den Ostermorgen, den du auch uns bereiten wirst.
Bleibt und bleiben Sie gut behütet!
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Karfreitagsliturgie mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Hl. Messe zu Gründonnerstag mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Predigt zu Gründonnerstag
Gründonnerstag in der Coronakrise
Predigt in der Abendmahlsmesse von Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen-Heimbach)
Liebe Gemeinde,
heute geht die Fastenzeit zu Ende, die Quadragesima. Im Mittelalter gab es die „Quarantaine de jours“, die 40 Tage, in der eine Schiffsbesatzung und Händler in Pestzeiten an Bord bleiben musste und eben nicht im Hafen an Land gehen durfte. Die momentane Quarantänezeit beträgt etwa zwei Wochen. Wann geht – gefühlt - die Quadragesima der Kirche zu Ende, wann dürfen wir Christen ‚Land sehen‘?
Aschermittwoch ahnten wir, was kommt. Diese 40 Tage, die seltsame Karwoche, was für ein „einsames Abendmahl“. Eine Bildmontage in einer Tageszeitung zeigt in ironischer Verfremdung Leonardos letztes Abendmahl: Doch Er - ganz allein am Tisch; auf dem Tisch die Reste eines Mahles, aber die Jünger – abwesend. Das leere Obergemach in Jerusalem, die leere Kirche, die leeren Straßen und Plätze, bei einigen auch die leeren Terminkalender… Wir werden zur Stille, zur ‚Entsagung‘ , Vereinzelung und ‚Entschleunigung‘ angehalten. Alles wird auf ein Minimum herabgefahren, auch die äußere Gestaltung unseres schönsten Festes. Doch kann die Fastenzeit 2020 zu Ende gehen, wenn wir nicht gemeinsam Ostern feiern können? Kann es allen Ernstes eine „eucharistische Fastenzeit“ geben? Oder ein Mahl ohne dieses Lebens-Mittel? Ein heiliges Essen, das man nur digital aus der Ferne mitfeiert? Am Gründonnerstag feiern wir Jesu Zuneigung. Er sucht und gewährt Nähe. Und diese dichte Begegnung mit Ihm fehlt uns! Wir ersehen - Communio, leibhaftige Gemeinschaft! Wir halten uns an die Vorgaben: Lieber nicht berühren, Abstand halten, zu Hause bleiben! Gerade an dem Tag, als Jesus seinen Jüngern auf den Leib rückte! Damals! Soviel Kontakt war nie. Jesus zu Füßen der Jünger: Soviel Verzicht auf Sicherheitsabstand, auf sozialen Kontakt, so viel geschenkte Nähe war nie – und doch müssen wir momentan auf Distanz bleiben - zueinander und auch zum intimsten Geheimnis unseres Glaubens, zum eucharistischen Lebensmittel unseres Glaubens.
Gerade dieses „übernatürliche“ Geheimnis“ aber, das der Herr heute einsetzt, schwebt nicht über den Dingen; man kann es nicht digital kosten; denn Jesu Liebe wird essbar, greifbar unter Brot und Wein. Im Abendmahlssaal war eine analoge, keine digitale Gemeinschaft zusammen:13 Männer auf engem Raum, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 12 Männer in einem geschlossenen Schutzraum, die zu Tisch liegen und der Eine, der sie bedient. Da werden Zeichen der körperlichen Nähe geschenkt, Füße gewaschen und massiert. Das ist die überwältigende Weise, in der Jesus sich nicht an Abstandsregeln hält und stattdessen seine Zärtlichkeit und seine Größe zeigt – am Heiligen Abend der schönen Bescherung.
Doch am Gründonnerstag 2020 ist alles anders - und hoffentlich einmalig. Alles Anfassbare verschwindet. Ich kann Ihnen und Euch nichts Essbares weitergeben. Wir haben nichts in der Hand: kein Brot, kein Weihwasser, nicht die Hand des Banknachbarn… Draußen winken wir uns freundlich von Ferne zu. Und auch Gott winkt uns heute freundlich mit seinem Wort zu, alleine mit seinem Versprechen, seinem Segen. Aber auch mit dem Schweren dieser Zeit, die er uns zumutet; doch eben nicht mit einer Speise. Diese Gabe fehlt, die er uns in die Hand und auf die Zunge legt, dieses tiefste Bindeglied zwischen ihm und uns und unter uns. Wir sind alle wie Kinder vor der Erstkommunion, erwartungsvoll, doch ohne Erfüllung, sicher in innerer Einkehr und Andacht, aber… Und doch werden wir hörend hineingenommen in den Moment des Innehaltens im Abendmahlssaal, dem Atemholen, der Ruhe vor dem Sturm. Liebesdienst und Freundschaft inmitten der Krise, wo man zusammenrückt.
Auch viele von uns rücken näher zusammen, zu Hause; manche erleben vielleicht intensiver denn je – Familie. Einige werden sich vornehmen, zu Ostern etwas besonders Schönes zu kochen. Denn Ostern dürfen die, die zusammenwohnen, gemeinsam essen. Das wird uns nicht genommen. Ostern wird es aber so manche geben, die auf sich zurückgeworfen sind und alleine essen. Sie können nicht einmal am Gabentisch Gottes Platz nehmen.
Wir bleiben auf Abstand, zu ihm und seiner sakramentalen Nähe und untereinander. In solchen Momenten wird deutlich, was uns fehlt, worauf wir schmerzlich verzichten müssen und worauf wir uns freuen sollten. Ihn nur aus der Ferne zu empfangen, geistlich, wie wir sagen, virtuell, das ist ein Notbehelf, eine nicht zu verachtenden Notlösung. Aber virtuelles Dabeisein macht nicht satt. So schön und chancenreich die sozialen Netzwerke sind, sie alleine erquicken nicht und machen nicht glücklich. Es fehlt der direkte Kontakt, die Handreichung, die Umarmung, auch das Anrempeln.
Die Eucharistie ist keine Fernbedienung durch Gott, sondern Handreichung, sehr konkret, sehr spürbar, sehr geschmackvoll. Die Umarmung Christi ist herzhaft und herzlich. Aber auch der eucharistische Brocken, den Jesu den Jüngern hinhält, ist nur ein kleiner Bissen, ein Vorgeschmack; da muss noch mehr und Größeres kommen.
Vielleicht ist die Erfahrung des schmerzlichen Vermissens die einzige gute Chance in dieser schweren Zeit des Mangels: Dass wir begreifen, was uns fehlt oder auch: welche Nebensächlichkeiten mich zerstreuen; dass ich dankbarer lebe und die Feste und die Normalität des Alltags nicht für zu selbstverständlich nehme. Diese Sehnsucht nach dem, was uns fehlt, die sollten wir wachhalten - wie einen unstillbaren Hunger, einen brennenden Durst nach seinem Wunder und der Gemeinschaft derer, die sich um Jesu Gabentisch scharen. Aushalten müssen wir auch die Traurigkeit, dass wir das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen. Helfen wir einander, im Glauben zu bleiben und, ja, ‚Haltung‘ zu bewahren. So viele Zeitgenossen schenken Akte der Mitmenschlichkeit, so selbstvergessen, wie es Jesus tat, als er apostolische Füße abspülte.
Eine Frage dieser seltsamen Gründonnerstagsstunde wäre. Was halfen und helfen mir und Ihnen die vielen Kommunionen, die wir bereits im Laufe unseres Lebens empfangen haben, diese Medizin der Wandlung, diese Arznei der Unsterblichkeit? Haben Sie mich erreicht, gepackt, verwandelt? Reichen die ganzen Kommuniongänge, um mich jetzt geistlich über Wasser zu halten? Reichen sie, damit ich nun, wo ich so viel mit mir allein bin – bei Gott zu Hause bin? Bringt uns also die Erschütterung dieser Woche – Gott näher?
Wird Jesus für uns Mittel und Wege finden, um bei uns zu sein, um sich uns in dieser seltsamen Osterzeit in unser Gedächtnis einzugravieren? In dieser Zeit, in der die Kirche lernt, dass sie – gesellschaftspolitisch gesprochen- nicht systemrelevant ist. Sie muss sehr bescheiden, sehr demütig diese ‚Nebenrolle‘ in der großen Krise annnehmen.
Werden wir in unseren vier Wänden erfinderisch sein, Jesu Nähe zu feiern, auch wenn niemand ihn unter Brot und Wein kommuniziert – außer stellvertretend der Priester, der hier beinahe ganz allein die Messe feiert? Wie werden wir Ihm den Tisch decken zu Hause, wo nun das Wohnzimmer zur Kirchenbank wird? Ich lade Sie und Euch ein, sich um einen Tisch zu versammeln, Worte aus dem Alten Testament über die Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft zu lesen oder aus den Abendmahlsberichten, den Abschiedsreden Jesu, Lieder zu singen (wie Bonhoeffers „Von guten Mächten“, heute an seinem 75. Todestag) , Kerzen zu entzünden, Bachs Oratorien zu hören.
Die Jünger waren ratlose Gäste Jesu, schweigsam, beklommen. Eine richtige Festesfreude kam nicht auf. Und das geteilte Brot hat sie irritiert. Sie sind fundamental verunsichert, denn in der Eucharistie bekommen sie kein Wundermittel, keinen „Zaubertrank“ wie Asterix und Obelix, der sie stark und unverwundbar macht. Die Eucharistie ist kein Elixier der Sieger. Und sie ist auch nicht das „Mittel“, das der Kirche gehört und das sie einsetzt.
Es heißt: Eine Krise, ein Stresstest, zeigt die Seele einer Person. Die Jünger werden in dieser Krise schwach. Kirche gerät aus dem Gleichgewicht. Auch die Macher unter den Aposteln können nichts machen und verhindern. Diese Männer, die Jesu heiligen Leib in Empfang nehmen, gehen nach diesem Mahl bestenfalls auf Tauchstation, verstecken sich, verleugnen, verschweigen ihn, verraten ihren Herrn und Meister. Sie zeigen keine heroischen Taten. Sie kommen mit der Lebenskrise Jesu nicht klar. Sie werden in der kommenden Nacht der Krise nicht zu Helden der Kirche emporwachsen; sie fühlen sich überfordert, die werden bald weggehen ohne ihn, sich wegdrehen von ihm, sie wollen nicht zusehen, was mit ihm geschieht. Sie ahnen: Wenn wir in seiner Nähe bleiben und Kontakt zu ihm halten, geraten wir in Lebensgefahr. Er reißt uns mit sich. Er wird ausgeliefert, und wir müssen schauen, wie wir uns schützen. Ich gehe auf Abstand, ich kenne diesen Menschen nicht, diesen Gottesknecht, der alle Krankheiten trägt. Jesus wird wie ein Gefahrenherd, von dem sich auch die Kirche in der Nacht nach seiner Verhaftung absetzt. Niemand aus dem Kreis der Zwölf wir sein Leben einsetzen für ihn in dieser Nacht. Judas ist das ‚schwarze Schaf‘. Doch sind die anderen besser? Die elf Jünger schielen nach Notausgängen und Fluchtwegen. So wie bei uns der Gottesdienst als Risikoveranstaltung angesehen wird, so war die Nähe zu Jesus für die Jünger in Jerusalem ein Risiko. Darum die Strategie des Abtauchens, sicher ist sicher. Und sie fragen sich, jeder für sich im Stillen; was wird aus mir -nach seinem Tod? Wird es auch mich erwischen, oder werde ich davonkommen? Werden wir in dieser Grenzsituation auf Ihn stoßen? Und werden wir uns mit dem zeigen, der „all unsere Krankheiten trug“?
Ich feiere in einem fast leeren Abendmahlssaal, in einem Raum, in dem Jesus quasi ganz allein ist, wenn nachher alles zusammengeräumt wird, wenn die Kerzen ausgeblasen werden, der Altar entblößt wird und diese winzige Feier zu Ende geht. Er wird herausgehen aus dem Saal in Jerusalem, er wird sich stellen, sich den Tod holen für uns. Versuchen wir, unseren Ort in seiner Nähe zu finden. Ja, ich glaube: Jesus wird sich in diesem seltsamen Osterfest bemerkbar machen, wird unser Herz waschen und unsere „aufgescheuchten Seelen“ trösten. Er wird der Allernächste derer sein, die seine Leidensgeschichte durchmachen.
Singen wir, heute am 75. Todestag des Theologen Dietrich Bonhoeffers – er wurde im KZ Flossenbürg am 9. April 1945 von den Nazis ermordet - Lied (GL 430, GL Aachen 843) „Von guten Mächten wunderbar geborgen… Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern“.
Kurt Josef Wecker
Der Gottesdienst zu Palmsonntag mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Video zur Segnung der Palmzweige
Einführung in den Palmsonntag
Ist das eigentlich ein richtiger Palmsonntag? Wo so vieles fehlt, was uns lieb und teuer ist: die flatternden Bänder an den Palmsträußen der Kommunionkinder, die Prozession mit Jesus draußen auf der Straße oder am Stadttor oder auf der Burg, das jubelnde Hosianna, eine gewisse fast schon österliche Ausgelassenheit; Palmzweige, die an das Leben erinnern, an den Gottesfrühling, an den Sieger über Leid und Tod. Zweige, mit denen wir das Holz des Kreuzes zu einem Lebensbaum verwandeln…. All das fehlt. Wir können uns nur erinnern, wie es war und hoffen auf Zeiten, wo all das wieder eine schöne Normalität sein wird
Wir sind Sinnenmenschen. Wir brauchen einen Pack-an, gerade in diesen Zeiten, wo es so wenig anzufassen gibt. Normalerweise tragen wir diese grünen Buchsbaumzweige in den Händen, bewegen uns gemeinsam in Prozession; und spielen gewissermaßen das schöne schwere Spiel des Glaubens, pflegen diese schöne bewegliche Weise, uns Ostern anzunähern. All das wird uns in diesem Jahr nicht möglich sein. Es schmerzt, dass so vieles fehlt. Auch alles Laute und Zerstreuenden wird dieser Woche abgehen. Wie werden wir uns dem schönsten Geheimnis des Glaubens annähern? Wie werden wir aus dieser schweren Karwoche herauskommen und in das Fest finden, das wir Ostern nennen?
Ich lade Sie und Euch ein, dass wir uns geistlich mit der Hl. Schrift in der Hand, dem Gotteslob, mit brennenden Kerzen live vor den Toren Jerusalems versammeln und Jesu leisen Advent feiern.
Wir können singen
„Ihres Mächtigen, ich will nicht singen (GL 829)
„Singt dem König Freudenpsalmen“ (GL 280)
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (218, 1+5)
„Tochter Zion“ (GL 228)
„Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna“ (Neues geistliches Liedgut)
Predigt
Liebe Mitchristen,
vor wenigen Tagen, da segnete der Papst in einer so eindrucksvollen Liturgie auf dem leeren, regennassen Petersplatz die Welt- die große und die kleine, den Erdkreis und die Stadt. Ein Segen, bestimmt für die ganze Erde, denn die ganze Erde ist von einer gefährlichen Krankheit bedroht. Ein kleiner Mann und eine große Geste, eine schlichte und doch gottvolle Gebärde des Glaubens. Er segnete diese schwerkranke Welt. Er segnet eine Welt, die eine schwere, ernste Karwoche durchlebt. Das müssen wir aushalten, dass es zunächst einmal dunkel ist. Wir können nicht zu schnell das Licht am Ende des Tunnels vorwegnehmen. Diese Karwoche der Welt. „Kara“ - das heißt Klage, Wehklage, Sorge. So viele Kreuzwege! So viele unbeantwortete, ungestillte Fragen. Wir Menschen halten uns Ihm mit bohrenden Fragen hin: Hat sich Gott zurückgezogen, hat er sich leise entfernt von seiner Welt? Bei wem können wir Gehör finden?
Kreuzwege, durchkreuzte Wege. So viele Pläne und Hoffnungen wurden in diesen Wochen durchkreuzt. Aber auch: so viel Mitmenschliches trat hervor, so viel Segensreiches! So viel Mitleid und Einsatz bis zum Letzten. So viel freiwilliger Verzicht auf das eigene Wohlergehen.
Der Papst stellte auch die Kirche unter den Rettungsschirm des Segens, die den Virus nicht einfachhin ‚wegbeten‘ kann; arm und entblößt ist sie wie die Altäre am Karfreitag. Auch unsere Seelen sind entblößt. Selten erfuhren wir es deutlicher als in diesen Tagen: wie verletzlich diese Welt ist, wie verwundbar unser Leben ist, wie vernetzt dieses globalisierte Weltdorf ist. Alle Landstriche, alle Schicksale müssen unter den Segen Gottes. Alle Kontinente sind betroffen. Diese gebrechliche Welt steht vor dem Osterfest; wir alle, die wir vor wenigen Wochen nicht ahnten, was für ein Schmerz und Verzicht so vielen Zeitgenossen auferlegt wird. So viel namenloses Leid. So viele Schmerzensfrauen und Schmerzensmänner.
Mit „aufgescheuchten Seelen“ begehen wir Palmsonntag. ER zieht ein in diese kranke Zeit, so wie er damals ohnmächtig einzog in die Stadt, die ihm den Tod brachte und uns das Leben. Er zieht sich nicht zurück, er zieht nicht an uns vorbei, er zieht ein in die Leidensgeschichten unserer ernsten, strengen Tage; er zieht ein in unser Fragen: Warum und Wie lange noch? Er zieht ein auf einem Esel und wird das Lamm Gottes sein, das sich abschleppt an uns. So sieht kein Held aus, kein Zauberer. Er zieht ein nicht als unverwundbarer Halbgott.
Er kommt zu uns als der Gottesknecht, der unsere Krankheiten trägt.
Sein Weg nach Jerusalem ist nur äußerlich fast triumphal. Er kommt in eine Stadt, die ihm den Tod bringt. Er kommt als das Opferlamm, das die Sünde und Krankheiten der Welt trägt.
Sich opfern füreinander, das tun Menschen in diesen Tagen. Sie schenken Augenblicke der Liebe und lassen ahnen, dass der Himmel offen bleibt über uns. Unter Lebensgefahr setzen sich Helferinnen und Helfer der Krankheit aus. Sie tun es nicht, weil Jesus es ihnen vormacht oder vorschreibt. Sie tun es aus freien Stücken, aus Pflichtgefühl, aus Leidenschaft für ihren Beruf. Sie wahren Haltung, sie tun, was sie tun müssen und weit mehr. Die Gesellschaft erwartet quasi, dass einzelne Berufsgruppen in diesen Tagen über sich hinauswachsen und Opfer bringen. Ist das Berufsrisiko? Wir sind dankbar für Menschen, die füreinander leben, die ihr Wissen, ihre Kompetenz, ihre sicheren Handgriffe einbringen, damit andere Überlebenschance haben. Und auch für rücksichtsvolle Menschen, die sich aus Liebe und Fürsorge voneinander distanzieren und auf das Schöne verzichten: auf die Umarmung, den Kuss, den Händedruck.
Unsere Kirchentore sind gewissermaßen geschlossen für öffentliche Gottesdienste. Wir können nicht zusammenkommen, um vor unserem Herrn gemeinsam das Grün der Zweige auszulegen und das Kreuz zu schmücken.
Alles ist anders; doch Er kommt trotzdem. Er will in uns hineinziehen. Er tritt durch die Tore unserer Ohren und Herzen in uns ein, hinein in unsere Angst und Einsamkeit In uns, die wir so verunsichert sind. Er darf das, er darf einziehen in unser bewegtes Innenleben. Er darf uns nahekommen, Sein Geist darf uns anstecken. Für Ihn gelten keine Abstandsregeln. Jesus hat sich anstecken lassen vom schreienden Elend der Aussätzigen. Bereits in diesen lebensgefährlichen Gesten in Galiläa begann Jesu ‚Opferleben‘, sein totaler Lebenseinsatz, seine Passion. In solchen Berührungen setze er sein Leben für uns aufs Spiel und nimmt seinen Karfreitag vorweg.
Was für eine Ouvertüre in die Karwoche! Unter normalen Umständen würde diese Woche vielleicht laut und hektisch verlaufen. Der alltägliche Stress, den man gerne in Kauf genommen hätte. Wir wären viel wegen Besorgungen unterwegs gewesen, hätten uns Reisewünsche erfüllt. Ich erinnere mich an zurückliegende Karwochen: Sie verliefen gemeinhin nicht traurig oder besinnlich; denn wir hatten in vergangenen Jahren viel Schönes zu tun und zu proben und vorzubereiten… Und vielleicht hätten wir die Todesangst und Einsamkeit Jesu am Ölberg und auf seinem Kreuzweg nur im Evangelium gehört, aber nicht am eigenen Leib mitempfunden.
Musste ein solcher Virus kommen, damit wir auf den harten Kern der Karwoche gestoßen werden, auf die Lebensgefahr Jesu, seine Verlassenheit, seine Todesangst? Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, in diese schwere Karwoche hineinzufinden, damit wir ahnen, was das bedeutet: dass Jesus keine Berührungsangst hat vor den Füßen der Jünger, dass ein Zufallspassant Jesus beim Kreuztragen hilft. Wir spüren, wir sehr wir einander brauchen, auch um uns im Glauben zu stützen, um stellvertretend vor Ihm füreinander einzustehen. Vielleicht werden wir in dieser Karwoche 2020 ahnen, was uns trägt, was wir schmerzlich vermissen. Wir werden ein Fest ersehnen, dass dem einen die Auferstehung bringt – eine Rettung, die auf uns alle überspringen soll.
Hosianna, Gottesknecht, trage unsere Krankheiten mit, zieh ein in diese schwerkranke Welt und erbarme dich ihrer!
Fürbitten
Darum bringen wir die schwere Lage und das Leben so vieler bittend vor Gott:
Zieh ein in das Leben der Helfer und Helden dieser Tage. Sie sind in diesen Tagen ganz damit beschäftigt, für andere da zu sein. Bitten wir für die, die vielleicht nicht glauben und doch über sich hinauswachsen. Für alle, die andere nicht aufgeben, die immer weiterkämpfen und Kranke verarzten.
Zieh ein in das Leben dieser zerbrechlichen Welt. Bitten wir um Menschen, die ihnen in dieser Zeit des Abstands zu Nächsten werden; und die Fantasie entwickeln, dass wir einander nicht allein lassen. Bitten wir um Beter, die die Not dieser Welt in dein Ohr tragen. Bitten wir für die Geduldigen, die nicht aufgeben und gelassen und entschlossen das Menschenmögliche tun und sich verausgaben.
Zieh ein in das Leben der Menschen, um die wir uns sorgen, unsere Lieben, die Großeltern und schwer Erkrankten, die Überforderten und in ihrer Existenz Bedrohten. Zieh in das Leben der alten Menschen, an deren Ohr in diesem Jahr kein Lachen der Enkel dringt, die alleine essen beten müssen. Sterbenden Trost spenden, Toten ein Minimum an würdiger Bestattung ermöglichen.
Zieh ein in das Leben der Einsamen und Ängstlichen, der Gefährdeten und Hoffnungslosen; derer, die wie gelähmt auf die Nachrichten und Bilder dieser Tage starren und die an keine gute Zukunft mehr glauben können. Bitten wir für die Leidenden und Gequälten und die, die niemanden haben, an den sie sich wenden können. Für die Schwerkranken und Sterbenden, die ihre Angehörigen nicht sehen und spüren können. Für die, die wegen Corona in diesen Kar- und Osterwochen um ihr Leben kämpfen und sterben werden. Und für die, die mit dem unwiederbringlichen Verlust eines Menschen leben müssen.
So stehen wir mit unseren Bitten und Hoffnungen, Gott, vor dir. In den immergrünen Zweigen halten wir uns dir hin, unsere Klage und unseren Dank, unsere Bitte und unsere stumme Hoffnung. In dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Aus dir fallen wir nie heraus. Dir sei die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen
Kurt Josef Wecker
Texte zu Palmsonntag
Evangelium zu Palmsonntag 2020 (Mt 21,1-11) Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte |
Meditation:
Jesus Christus (Helene Renner) | Gebet:
Herr Jesus,
(Franz Wenigwieser) |
Texte aus: https://predigtforum.com/programmuebersicht
Fürbitten zu Palmsonntag: Gott, der du Jesus zu uns geschickt hast, |
Hl. Messe zum 5. Fastensonntag mit Pfarrer Kurt Josef Wecker
Entnommen aus: https://predigtforum.com/programmuebersicht
Die dazugehörige Predigt und Texte
Predigt am 5. Fastensonntag in der Corona-Krise 2020
Evangelium: Joh 11,1-45
Kurt Josef Wecker, Pfr. (Heimbach-Nideggen)
Liebe Mitchristen, uns alle gibt es nur, weil da einer ist, der uns alle beim Namen gerufen hat: Komm heraus, Lazarus-Mensch! Am Anfang, als wir das Licht der Welt erblicken durften, sagte er: Tritt aus der Geburtshöhle heraus. Und dieser Ruf dessen, der uns alle bei unserm Namen kennt, verstummt nie. Uns alle wird es nur in Zukunft geben, wenn dem großen Ostern Jesu ein kleines Ostern folgen wird; die Stunde, in der Christus uns aus der Grabhöhle, aus der Nacht des Todes, ins Licht rufen wird; ein Licht, das schöner ist als das Frühlingslicht des Samstags vor dem Passionssonntag. Tritt heraus aus deiner Angst, deiner Einsamkeit. Die Auferweckung des Lazarus ist eine Art Hoffnungsgeschichte. Sie erzählt gegen den Tod an. Sie macht Lust auf Ostern. Wir hören solche Geschichten vom Leben, weil sie uns gerade in diesen Tagen guttun, weil wir uns an sie klammern, weil sie uns geistlich über Wasser halten. Geschichten, wo sich eine kleine Gemeinde, ja „der engste Familienkreis“, um ein Grab schart. Menschen, die von der Situation eines Todesfalls überfordert sind. Jesus, der erschüttert ist und weint. Geschichten, wo Er in der Krise dabei ist, dazwischentritt und Trauernde nicht alleine lässt, wo Jesus auf dem Weg in seinen Tod einem anderen das Leben schenkt und uns einen kleinen Vorgeschmack von einem Leben, das keinen Tod kennt.
„Komm! ins Offene, Freund!“ so dichtete Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren am 20. März 1770 geboren wurde und der die letzten 36 Lebensjahre - geistig umnachtet und in Selbstgesprächen kreisend - in einem Turmzimmer in Tübingen zubringen musste. „Komm! in Offene, Freund!“, so wollen wir es auch hören von unserem Herrn. Komm. Lazarus, komm ans Licht!
In dieser frostigen Nacht ist Beginn der Sommerzeit, ein kurzer Sonntag. Was für ein Frühling und Sommer wird das werden? Wer ist im Frühling schon gerne ein Stubenhocker? Gottlob wurde uns keine Ausgangssperre, ‚nur‘ Kontaktverbot auferlegt. Doch so viele sind im Dunkel und sehen nur Nebel. Ungewohntes wird uns zugemutet, der gemeinsame Kirchgang ist unmöglich - weil es um Vieles geht, Rücksichtnahme aufeinander, um Risikominimierung, um Leben und Tod. Manche sind das Zu-Hause-Sitzen mehr gewohnt als andere; sie liebten schon vor der erzwungenen Einsamkeit die Stille und Zurückgezogenheit. In normalen hektischen Zeiten sehnen sich viele danach, zur Ruhe zu kommen, mehr Zeit zum Lesen zu haben, oder mit Muße Musik zu hören und die Welt von zu Hause aus zu entdecken. Doch uns wird eine Zwangspause auferlegt, in Russland eine Woche Zwangsurlaub verordnet. Nun überfällt uns diese Ruhe wie aus heiterem Himmel: die Introvertierten und die Extrovertierten gleichermaßen. Uns wird Verzicht auferlegt, ein Fasten ganz eigener Art. Wir sollen verzichten und auf Abstand gehen, um irgendwann uns wieder umarmen zu dürfen.
Für uns Christen ist diese Erfahrung einschneidend und sehr schmerzhaft. Tritt heraus! So hören wir Jesu Wort an Lazarus, der sprachlos bleibt. Doch wir können heute nicht gemeinsam vor Ihn treten. Wir leiden unter dieser Entzugserscheinung schon einen weiteren Sonntag seit der Kontaktsperre. Wir können uns nicht gemeinsam um den unsichtbaren Gott scharen. Ein Stück geistlicher Heimat in unseren Pfarrgemeinden, den vertrauten Sonntagsräumen, wird uns genommen. Wir können uns nicht als Gemeinde wiedersehen und zum gemeinsamen Gottesdienst physisch versammeln; viele feiern den Sonntag ‚am Küchentisch‘ oder auf der ‚Bettkante ‘und ‚in engstem Familienkreis‘ mit…. Die Infektionsschutzgesetze machen die Versammlung, die Zusammenkunft, das Gemeinschaftserlebnis unmöglich. Wir vermissen die ‚echte‘ Zusammenkunft, die Stimmen des Anderen, den Händedruck der Banknachbarin. Vieles wird abgesagt. In diesen Coronazeiten fällt Kirche nicht aus, weil auch Ostern nicht ausfällt. „Kirche fällt anders aus“, so bringt es der evangelische Kirchenkreis in Münster auf den Punkt. Eine digitale Gemeinde versammelt sich mancherorts am Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken. Dies ist nur ein Versuch, aus der Not geboren. Virtuelle Gottesdienste sind nur ein blasser Schimmer der Gemeinschaftsfeiern, in der wir leibhaftig Christus ‚schmecken‘. Und doch sind wir alle geistlich versammelt vor Ihm, der sich lautlos zu uns gesellt. ER hat uns „angesteckt“ mit der Flamme der Liebe, der Sehnsucht, der Hoffnung. Er ist immer da und mischt sich heilsam ein, wo zwei oder drei in Seinem heiligen Namen versammelt sind (Mt 18,20).
Das Unbeschwerte kann nicht gelingen in diesen Tagen. Nicht nur die Kinder fragen: Wie lange geht das noch so weiter? Wir wissen nicht wie lange. Wann wird wieder Normalität einkehren? Wie lange halten wir das aus? Wann werden wir unsere Großeltern, wann werden wir unsere Enkel wiedersehen? Wann kommt ein Mittel gegen Corona und ein erfolgreicher Impfstoff? Wann können wir wieder zu dritt und in Gruppen auf die Straße gehen und uns treffen? Und was wird das für eine Welt sein, in die wir irgendwann wieder zurückkehren sollen? Und: Ist das alles wirklich wahr, oder bilden wir uns diese surreale Welt bloß ein? Wie ein böser Traum, aus dem man irgendwann erwacht? Wie lange werden wir auf die Antwort auf diese Frage warten müssen? So beschwert stehen wir Lazarus-Menschen in diesen Wochen vor dem verborgenen Gott.
Unsicher stochern wir im Nebel herum. Es ist eine Zeit, in der wir auf hoffnungsvollere Nachrichten und Trendumkehr hoffen, uns klammern an den Strohhalm einer winzigen optimistischen Prognose. Die sozialen Netzwerke sind zwar schön und gut, aber sie alleine reichen nicht aus. Die, die zu Hause sind, dürfen sich gewissermaßen als Privilegierte fühlen. In unserem Lebensraum kann man sich sooft die Hände waschen wie man will. Aber kann das ein Inder oder Afrikaner oder ein Migrant auf Lesbos? Oder Menschen in unvorstellbar beengten Wohnverhältnissen? Oder die Obdachlosen? Und auch in unserem Nahbereich gibt es sehr unterschiedliche Gefahrenzonen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es so viele ‚systemrelevante‘, oft unterbezahlte und unterschätzte Berufsgruppen gibt, die in der Gefahrenzone draußen arbeiten müssen, die dem Risiko einer Ansteckung durch das „gruselige Virus“ und - als Kassiererin an der Kasse – dem Frust und der schlechten Laune der genervten Kunden ausgesetzt sind. Der Alltag derer, die bei allen Stimmungsschwankungen und dem drohenden ‚Lagerkoller‘ oder gar Gewaltübergriffen zu Hause sein müssen und dürfen, ist anders als der Alltag der vielen im Notstand draußen, der Ärzte und den Schwestern und Pflegern in den Krankenhäusern und Altenheimen, den Sicherheitskräften, den Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe, den Politikern in ihrem Entscheidungsstress, den Wissenschaftlern in ihren Forschungslabors…
Und was ist mit den Menschen, die allein wohnen und niemanden haben, mit dem sie Kontakt pflegen können? Sie führen innere Monologe, schauen stumm aus dem Fenster in den erwachenden Frühling, doch auf menschenleere Straßen und Plätze. Da sitzen wir nun alle mehr oder weniger still zu Hause und hoffen darauf, dass der Ausnahmezustand nicht zum Dauerzustand wird. Die Sorge eint uns - und die Hoffnung, dass bald gegen diese Gefahr ‚ein Kraut gewachsen ist‘. Die globale Krise eines winzigen „Ungeheuers“ schweißt uns zusammen - zu einer globalen Gemeinschaft von mehr oder weniger Isolierten, Heruntergebremsten. Stille und Stillstand statt Bewegung und Begegnung. Soviel Verzicht war nie! Verzicht auf liebgewordene Gewohnheiten, Freizeitbeschäftigungen, Freiheitsausübungen. Die Welt ist leiser geworden - und der eigene Alltag vielleicht konturloser. Dieser Alltag ist nicht von allen guten Geistern verlassen, nicht gott-leer. Da will Er dabei sein, in unserem Suchen und Fragen, unserem Tasten nach dem rettenden Ausweg, auch in meiner kleinen Welt und meinem „Kämmerlein“, in den eigenen vier Wänden, wo Familien spürbar zusammenrücken müssen.
„Wir brauchen dich Herr - wie die alten Seefahrer die Sterne!“ (Papst Franziskus). Wir brauchen den, der den Kampf gegen den Tod aufnimmt und uns aus dem Dunkel ruft: „Komm! ins Offene, Freund!“ (F. Hölderlin).
Kurt Josef Wecker
Gebete in Zeiten der Corona-Pandemie am 5. Fastensonntag 2020
Gott, in einer schwierigen Zeit rufen wir zu dir. Wir sind verunsichert. Alles ist so ungewohnt. Und du, Gott, bist so still. Wir suchen dich. Wir tragen unsere Not in deine Nähe.
Du darfst um unsere Ratlosigkeit wissen. Denn du bist dabei in der Krise. Vor dir fragen wir: Wie geht es weiter? Das Leben der Kranken, das gesellschaftliche Leben, die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, das kirchliche Leben…? Wir leben im Ausnahmezustand und sehnen uns nach Normalität. Angst beschleicht uns vor der unsichtbaren Bedrohung und vor dem, was noch werden kann. Wir können uns auf Ostern nicht so richtig freuen. Wie werden wir in dieser zerbrechlichen Situation unser größtes und schönstes Fest feiern? Viele verlieren den Überblick. Und, ja, wir haben Angst, weil wir uns als so verwundbar erfahren; Angst vor der Krankheit, oft mehr noch vor dem Alleinsein, der Einsamkeit. Wir sind gefährdet und können andere gefährden. Wir haben Angst, weil Menschen, die uns lieb und kostbar sind, krank werden können, weil sie schon krank sind, weil auch wir krank werden können. Alles, was eben noch verlässlich und selbstverständlich war, wird fraglich. Dieses Suchen und Fragen tragen wir vor dich, Gott. Was zählt vor deinen Augen? Was ist wesentlich, was haben wir in Tagen des Glücks und der Normalität vergessen? Sei du unsere Hoffnung, unser Beistand, unser Fels. Sei du unser Alleernächster. Amen.
„Wir brauchen dich Herr, wie die alten Seefahrer die Sterne!“ (Papst Franziskus) Wir brauchen dich, Christus, nötiger denn je. Lass uns erfahren, dass du uns gerade jetzt nahe bist, erschüttert wie beim Tod deines Freundes Lazarus, fassungslos angesichts der macht der Krankheit zum Tod. Schenke uns auch heute dein Wort, dein Ohr, dein Herz. Ruf uns heraus aus den Gräbern der Angst und Verzweiflung. Lass uns spüren, dass unsere Welt in deinen Händen ruht und auch heute deine Osterwunder geschehen. Sei bei uns, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir nicht ein noch aus wissen.
Erwecke neu unsere Osterhoffnung, segne diese Welt, unseren kleinen Glauben, unsere zerbrechliche Existenz. Und überlass uns nicht dem Dunkel. Lass uns in diesen schweren Tagen zusammenwachsen, geistlich beieinanderbleiben und dem Wunder des Ostermorgens entgegengehen. Amen
Fürbitten
Gott, wir vertrauen auf Christus, der diese Welt in Händen hält und der uns in der Gefahr nicht uns selbst überlässt.
Wir bitten für alle, die dich nun ganz besonders brauchen, die derzeit besonders gefährdet sind. Halte deine schützende Hand über die Erkrankten und die, die jetzt mit dem Tod kämpfen. Bewahre die Familien und Freunde der Infizierten vor der Ansteckung.
Wir beten für alle Mediziner und Biologen, die ihr Wissen, ihre Weisheit und Kompetenz einsetzen, um das Virus zu bekämpfen. Inspiriere sie mit deinem Geist, dass sie der Wege zur Bekämpfung der Krankheit finden und dass ihre Erkenntnis allen Menschen zugutekommen.
Wir bitten um Kraft für alle, die in diesen Wochen bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten beansprucht sind: Ärzte und Pflegende und Seelsorger in den medizinischen Einrichtungen, Arztpraxen, Pflegeheimen und Hospizen.
Wir beten für die Kinder und Jugendlichen und ihre Großeltern, die sich in diesen Zeiten einander nicht sehen und umarmen können. Für die Eheleuchte und Familien, die es in beengten Wohnverhältnissen schwer haben miteinander. Für die Lehrkräfte an den Schulen, die ganz neue Wege des Lehrens finden müssen.
Wir bitten für alle, die sich in diesen Tagen ehrenamtlich und kreativ für Hilfsbedürftige einsetzen und gerade den Alten und Vereinsamten in praktischen Hilfsdiensten nahe sind.
Wir bitten dich für diese Gesellschaft im Ausnahmezustand: um Respekt, Besonnenheit und Geduld, um Vorsicht und Rücksicht, um einen wachen Blick für die, die uns nun besonders brauchen.
Wir bitten für die, die an anderen lebensbedrohlichen Krankheiten leiden und für die Menschen in den Kriegsgebieten, Hungerzonen und Flüchtlingslagern, die noch schlimmer dran sind und die ums nackte Überleben kämpfen.
Wir beten für die politisch Verantwortlichen, die ringen um die angemessene Entscheidung. Schenke ihnen einen klaren Blick. Erleuchte die, die oft unter Zeitdruck Entscheidungen mit weitreichenden Folgen fällen müssen.
Für die, die angesichts der Corona-Krise wirtschaftlich bedroht sind, deren Arbeitsplätze und Einkommen in Gefahr sind, die großen materiellen Schafen befürchten.
Wir bitten für uns in dieser Krise. Ändere auch uns, bekehre uns. Gib uns Einsicht in das, was im Leben wirklich zählt. Wecke unsere Phantasie und die Kräfte zum Guten. Mache uns rücksichtsvoller, liebevoller, solidarischer.
Wir bitten dich für unsere Gemeinden, für alle, die sich dafür einsetzen, dass das kirchliche Leben weitergeht, für alle, die Nachbarschaftshilfe organisieren. Dass wir miteinander im Gebet verbunden bleiben und gemeinsam den schweren Weg gehen.
Für unsere Verstorbenen, auch die, die wir in der vergangenen Woche im engsten Familienkreis beigesetzt haben und die wir in den kommenden Wochen beisetzen werden.
Gott und Heiland, dir legen wir diese zerbrechliche Welt nahe. Ermutige und stärke uns. Wir vertrauen dir. Auf dein Erbarmen hoffen wir und deinen lebenspendenden Geist erbitten wir, durch Christus, unseren Herrn.
Kurt Josef Wecker
Maria, die Eine, muss zu Hause sein, wenn Er kommt?
Betrachtung zum Fest Verkündigung des Herrn (25. März 2020)
Kurt Josef Wecker, Pfarrer (Nideggen/Heimbach)
1. Maria allein zu Haus
Wir sind in diesen Tagen der Corona-Pandemie viel zu Hause - zu unserem Schutz und aus Respekt vor dem Nächsten. Viele von uns sind nun nur noch zu Hause, auf sich selbst zurückgeworfen. Und wäre das Wetter nicht frühlingshaft sonnig, so dass sich manche allein oder zu zweit nach draußen wagen - dann fiele uns bereits am Anfang dieses Ausnahmezustands die Decke auf den Kopf. Es ist gar nicht so einfach, es zu Hause mit sich auszuhalten oder auf engem Raum permanent mit Familienangehörigen zusammenzuleben. Doch viele von uns können in diesen Tagen nicht in sicherere Selbstisolation zu Hause sein. So viele unter uns sind nun außer haus, in den Krankenhäusern, Pflegeheimen, an den Discounterkassen. Wie viele verausgaben sich im Dienst an den Kranken und Alten, bei den Sicherheitsbehörden, an den Kassen der Supermärkte. Sie schweben in Gefahr, kommen an die Grenze ihrer Kraft und ahnen das Risiko, selbst angesteckt zu werden.
In dieser Zeit, in der viele von uns gemeinsam allein sind und unser vor kurzem noch normaler Alltag erschüttert wird, werden wir hineingenommen in die Stunde der Menschwerdung Gottes. Gott sei Dank war Maria damals zu Hause, als der Himmel sie besuchte! Mitfeiernd treten wir in die Kammer von Nazareth hinein, wo auf engstem Raum Weltbewegendes geschah. Der Himmel ist nicht abgesagt. Der liebe Himmel neigt sich herab auf die Eine. Wen trifft der liebe Himmel dort? Und was tat Maria, als sich der Himmel über ihr öffnete? Gottes Engel tritt zu Maria; er wird sie nicht berührt und mit Handschlag und Umarmung geherzt haben. Er wird sich vor ihr verneigt haben. Er bleibt auf Abstand. Er respektiert dieses Geschöpf und tritt ihr nicht zu nahe. Manche Maler zeigen, wie der Engel respektvoll dem Mädchen eine Lilie reicht. Doch zwischen Engel und Maria ist stets eine scheue Distanz. Gott lässt Raum!
In diesen Tagen lernte ich in einem Leserbrief der Tageszeitung: Im Indischen gibt es einen anmutigen Gruß, der Gruß „Namaste“. Das bedeutet im Sanskrit: „Ich grüße das Göttliche in dir“! Und dabei werden die Handinnenflächen zusammengeführt, in der Nähe des Herzens an die Brust gelegt und der Kopf leicht in Richtung des Begrüßten gebeugt. Ein sehr anmutiger, eleganter Gruß, der auf alles Handgreifliche verzichtet und der den Begrüßten groß macht.
Im scheuen Gruß „Ave Maria!“ geschieht das zentrale Geheimnis des Glaubens. Gott lässt sich ein auf diese zerbrechliche Menschenexistenz. Er wird verwundbar, am Ende tödlich verwundet. Kann man über das Dogma „Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est“ predigten oder soll man dieses Zeugnis lieber den großen Komponisten und Malern überlassen? Vielleicht nehmen wir uns Zeit (wir haben nun viel Hör-Zeit!), wie die großen Komponisten Bach und Mozart, Beethoven und Bruckner diesen Wendepunkt des Heils komponiert haben. Still und leise kommt Er zur Welt. Lassen wir es leise werden in uns, halten wir die Stille aus, die sich nun um uns breitet. Und wenn wir nun bei uns wohnen und uns zu Hause auf das Wesentliche konzentrieren, dann pressen wir im Gebet unser Ohr an die Wand der Kammer von Nazareth.
Viele sind nun vereinzelt. Gott begegnet einem einzelnen Menschen. Ein seltsamer Pilger begegnet Maria, dem vollkommenen Ebenbild Gottes. Gott selbst ist Pilger. Er kommt, bevor wir aufbrechen zu ihm. Er sucht sein Ziel, ohne es zu berühren. Er sucht das Gespräch, ein „Spitzengespräch“. Er kommt wirklich. Diese Zusammenkunft ist keine ‚virtuelle‘ Begegnung, keine Schaltkonferenz zwischen Himmel und Erde. Der Engel Gottes trifft einen zutiefst konzentrierten Menschen, Maria, die sich für diesen Ein-Fall Gottes öffnet und – begnadet – das Unmögliche möglich macht.
Wo Gott ankommt und anklopft, da ist Krisenzeit, Zeitenwende! Nun erfüllt sich die Zeit (Gal 4,4). Menschwerdung „ist angesagt“. Hier geschieht ganz Neues unter der Sonne, Gott kommt dieser Frau – einer von uns – unendlich nahe. Er sehnt sich nach dem Ziel, das er sich auserwählt hat: Maria. Indem er den Engel sendet, ist Gott der erste Marienverehrer!
Et ingressus angelus. Woher kommt dieser unerwartete Besucher? Ein eiliger Bote auf der Suche nach der Goldrichtigen, auf der unendlichen Reise zum Menschen. Bittend pilgert der Engel Gottes zum Gnadenort Nazareth. Er nähert sich lebendigen „Gnadenbild“ Mirjam. Ahnt sie, dass sie die Begnadete ist? Was kommt auf diese junge Frau zu? Der Bote überbringt ihr die unerhörte Neuigkeit! Und diese gute Nachricht wartet auf Annahme, auf Resonanz.
2. Womit war Maria beschäftigt?
Viele sind nun „Homeworker“, mit Heimarbeit beschäftigt. Womit war Maria beschäftigt? Wie hat diese junge Frau Ihn empfangen? Mit offenen Armen, sitzend, stehend, kniend? Hatte sie die Arme verschränkt, die Augen demütig niedergeschlagen? Hat sie gelesen, gebetet, gewebt, meditiert? Jedenfalls war sie in dem Augenblick, auf den es ankam, nicht abgehoben, sondern ‚voll präsent‘. Der Engel unterbricht Maria bei irgendeiner Beschäftigung. Gott fragt: Darf ich stören? Religion ist immer „Unterbrechung“, wie der vor kurzem verstorbene Münsteraner Theologe J.B. Metz betont). Der alte Lauf der Dinge, und sei es die fromme Privatandacht, wird unterbrochen. Es gibt auch ganz andere Unterbrechungen im Lauf der Welt, wie wir sie in diesen Tagen erfahren, wo das öffentliche Leben beinahe auf Null herabgefahren wird.
Wobei trifft Er mich an, wenn er augenblicklich zum mir kommt? Womit bin ich momentan am meisten beschäftigt? Mit dem atemlosen Verfolgen des Corona-Tickers? Mit Besorgungen für meine Lieben? Mit Telefonaten und Briefkontaktpflege? Mit Home-Office? Mit Schlichten von Streit da, wo ein ‚Lagerkoller‘ droht? Mit der Suche nach einem Freiraum bei so viel Nähe der Familienangehörigen und ganz neuen Begegnungen mit den Nahen? Mit dem Spielen mit Kindern? Mit dem Aufräumen von zu lange liegen Gebliebenem? Mit Zeitvertreib und Langeweile? Was hält mich in Beschlag? Hätte Gottes Engel die Chance, dazwischen zu kommen, in diesen Tagen, wo unsere Seelen so aufgeraut sind und wir uns fragen, wie es weitergeht, wie lange es so noch weitergeht, ob alles gut ausgeht?
Für den in Maria Wald hochverehrten hl. Bernhard von Clairvaux († 1153) war Maria die demütige Magd, die ganz in der Gegenwart Gottes lebt und sich vorbehaltlos auf Gottes Heilsplan einlässt. Gott wird Mensch dort, wo er in Maria eine Betende antrifft: eine Frau, die ganz Ohr ist, geistlich mit Gott verbunden, eine Sehnsüchtige, die sich zutiefst wünscht, dass sich endlich (in ihr) erfülle, was Er verkündigt hat. Sie wohnt nicht passiv einem Gottesdienst bei; sie lässt sich auf Gottes Gottesdienst in ihr ein und beteiligt sich durch ihr Jawort daran.
Im späten Mittelalter war das den Menschen nicht genug. Ein Mensch, der still und ‚einfältig‘ auf seinem Zimmer sitzt, erschien manchen zu passiv, zu wenig…Viele Verkündigungs-Darstellungen der Maler dieser Zeit zeigen Maria als eine eben noch Lesende, eine belesene Frau – keine selbstverständliche Vorstellung, wenn man bedenkt, wie selten Frauen in Antike und Mittelalter Zugang zur Bildung hatten! Maria ist „Buchbesitzerin“. Den Adligen und später dem gehobenen Bürgertum war es wichtig, dass die demütige Magd zugleich aus davidisch-königlichem Geschlecht und somit „eine von ihnen“ war.
Als der Engel eintritt, wendet Maria ihren Blick vom Buch, dem Gebetbuch. Diese Störung ist für sie nicht unangenehm. Sie ist betend schon bei Gott. Er ist für sie nicht der absolut Fremde. Dieser Besuch ist ersehnt und völlig unerwartet zugleich! Maria ist die von Gott wunderbar Überraschte. Der Engel unterbricht Marias Lesefluss. Ihre Augen müssen nichts mehr entziffern: Sie feiert die leibhaftige „Kommunion“ des Gotteswortes. Viele Theologen und Künstler des Mittelalters nehmen an, Maria habe das Psalterium gelesen, habe aus dem Buch Jesaja die Stelle „Siehe, die Jungfrau wird empfangen“ (Jes 7,14) betrachtet. Wäre es so gewesen, dann hätte ein Text in ihr leibhaftige Wirklichkeit angenommen: In diesem Mädchen, das sich zutiefst wünscht, dass in Erfüllung geht, was Gott verspricht, erfüllte sich die Verheißung: das Kommen des Messias.
Die heilige Schrift schweigt dazu. Doch gut möglich: Maria empfängt das ewige Wort, das ihr der Engel nahebringt, während sie das Psalterium oder ein Prophetenbuch meditiert. Im Lesen des Wortes Gottes erfüllt sich die Prophetie, geschieht Fleischwerdung des Wortes, Inkarnation. Der Engel trifft auf die, die mit Gottes Wort „umgeht“. Sie wird von Gottes Wort affiziert. Wer Marias Magnificat nachsingt, der ahnt mit Lukas, wie belesen diese Frau war, wie „gekonnt“ sie mit Gottes Wort schwanger ging. Maria – eine „Intellektuelle“? Eine uns eher fremde Vorstellung! Wir glauben, dass Maria eine einfache junge Frau in einem winzigen Örtchen Galiläas war. Aber im Mittelalter war die Vorstellung verbreitet: In Maria, der Gebildeten, nimmt Gott Format an. Sie - eine „Lehrerin des Glaubens“. Später wird sie als „Lehrerin der Apostel“ (Rupert von Deutz) verehrt, wird Patronin von Schulen und Universitäten. Die Wissenswelt sucht ihr Protektorat. Im Mittelalter wird sie zur Leitfigur für Frauenbildung.
Der Glaube – das wird uns in diesen Tagen der „Hauskirche“, der Wortgottesfeiern im Wohnzimmer deutlich – wächst aus dem ‚Wiederkäuen‘ der Heiligen Schrift, der Vertiefung in Gottes Verheißung.
3. Verkündigung in der seltsamen Passionszeit 2020
Wir feiern das Fest Verkündigung des Herrn in der Fasten- und Passionszeit 2020, einer einzigartigen Zeit, in der uns viel Verzicht abverlangt wird. Soviel Stillstand. Soviel Aushalten von Unbeweglichkeit, der unfreiwillige Rückzug, das Seinlassen von so vielem Liebgewordenen. Für viele wird es ein schwerer Leidensweg und für manche eine Zeit des Abschieds von ihren Lieben. Der Zusammenfall eines so fast weihnachtlichen Festes wie Verkündigung und der österlichen Bußzeit am 25. März war für die Tradition vollkommen stimmig: „Man glaubt, dass Jesus an dem Tag empfangen wurde, an dem er litt“, sagte Augustinus (in: De trinitate IV,4). So wird zusammengehalten, was zusammengehört: die Verkündigung des Herrn und das Aushalten des Gekreuzigten. Diese Frau ist beide Male – heute und unter dem Kreuz – offenes Gefäß, reine Empfänglichkeit. Sie wird sich nicht verweigern und nicht die Flucht vor Gott antreten.
Heute feiern wir Gottes leisen Besuch. Doch dieser Besuch bleibt bei uns und lässt diese verstörte Welt nicht mit sich allein. Maria ist zu Hause und für Ihn antreffbar. Sie ist die Türöffnerin für Gottes Kommen und die Pforte, durch die er eintritt, Maria schenkt dem Glauben, der verborgen anwesend ist, der sich ihr zumutet. Wir feiern ihre hellwache Reaktion. Ihr Ja in Nazareth und unter dem Kreuz und Jesu Ja zum Kreuzweg sind Ja-Worte, die sie ein für alle Mal für uns alle aussprechen.
Maria wird ‚voll von Gott‘. Seit diesem Moment der Menschwerdung schlummert Gott in ihr. Wir feiern Maria, die wache Frau, die hörbar Ja sagte zum Engel und ein Leben lang das Wort buchstabierte, das sie empfing.
Entdecken oder gestalten auch wir zu Hause unseren „Herrgottswinkel“. Auch wir sind von Gott Gegrüßte. Für diese schwer geprüfte Welt kommt Er zur Welt. Unser zerbrechliches Leben, in das Er heute einkehrt, halten wir ihm hin. In der uns nun zugemuteten Stille, vielleicht Einsamkeit, wollen wir auf Ihn stoßen und einkehren in sein leises Geheimnis.
Kurt Josef Wecker
Geistliche Impulse zum 4. Fastensonntag
Predigt am 4. Fastensonntag angesichts der Coronakrise
Kurt Josef Wecker, Pfr. (Nideggen/Heimbach)
Evangelium Joh 9,1-41
Liebe Mitchristen,
solch einen Ausnahmezustand haben wir alle noch nicht erlebt. Solch einen Sonntag hat es vielleicht in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gegeben. Der Sonntag Laetare, der Herrentag auf dem Weg zum Osterfest, soll eine heilsame Unterbrechung sein. Doch er kollidiert mit einer anderen erzwungenen, verhängten, aber notwendigen Unterbrechung. Etwa zwei Millionen Deutsche, die sich an normalen Sonntagen in Gotteshäusern versammeln würden, stehen vor verschlossenen Türen oder erleben sich ein wenig verloren und vereinzelt in leeren Kirchenschiffen oder können nur medial als Zuschauer-innen eine Gottesdienstübertragung erleben. Heute können wir nicht zusammenkommen, um uns gemeinsam zu stärken. Das ist eine erzwungene Rückkehr in die Situation der Urgemeinde: als sich die kleine Gemeinde im Obergemach zusammenscharte, einmütig im Gebet (vgl. Apg 1,13f). Heute nehmen wir Jesu Wort wörtlich: „Wenn du betets, dann geh in deine Hinterkammer und verriegle dein Tor; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene blickt, wird dir vergelten“ (Mt 6,6).
Denn ein für uns unsichtbare Gegner, das Corona-Virus zwingt uns dazu. Die Corona-Pandemie ist dabei, unser komplettes Leben umzustellen und hat auch das kirchliche Leben lahmgelegt. Unfassbares geschieht, was wir allein nicht in der Hand haben. Etwas, was wir vor Wochen noch weit weg glaubten, im Fernen Osten, hat uns erreicht und bringt die gewohnte Ordnung durcheinander. Mit diesem Unabsehbaren und total Unvertrauten müssen wir leben – und mit der Selbstbeschränkung, die von uns verlangt wird. Haben wir uns eine solche Fastenzeit vorstellen können, einen Verzicht auf das Vertraute und Haltgebende, auf den leiblichen Empfang der Eucharistie, auf das gemeinsame Hören auf Gottes Wort? Was nun von uns verlangt wird, das ist Vorsicht und Rücksichtnahme, Besonnenheit, Maß und Solidarität. Es gibt ein lateinisches Sprichwort: „Wenn Rom brennt, ist es unrecht, Geige zu spielen“. Und darum ist es richtig, dass wir heute physisch auf Abstand bleiben. Das fällt so schwer! Zudem ist Frühlingsanfang; die Natur zeigt allmählich ihre verheißungsvolle Seite. Es sind die Tage, an denen wir ansonsten „aus uns herausgehen“, uns gesellig und feiernd zusammenfinden. An diesem Sonntag ist Tag- und Nachtgleiche; der Tag, von dem an das Tageslicht auf der Nordhalbkugel wieder überhandnimmt.
Doch wir spüren: Seit diesen Märztagen 2020 ist alles anders. Wir fahren gewissermaßen im Nebel. Niemand beneidet die Verantwortungsträger, die in diesen Tagen schwere und folgenreiche Entscheidungen treffen müssen, mit hohem Wissenstand und hoher Verantwortung, aber doch ins Dunkle und Ungewisse hinein. Die Wissenschaftler und Politiker, die ahnen, dass wir mit einer noch so unbekannten Herausforderung konfrontiert sind, die man nicht allein technisch und methodisch souverän in den Griff bekommt. Menschen müssen Entscheidungen fällen, von denen man wohl erst später weiß, ob sie richtig und rechtzeitig waren. Das gesamte öffentliche Leben ist heruntergefahren. Und so seltsam anders wird es auch in absehbarer Zeit bleiben. Die Natur hat ihre eigene Wirklichkeit. Das Coronavirus zwingt uns, auf Abstand zusammenzukommen und eine Art „eucharistische Fastenzeit“ zu leben.
Alles, was gerade in diesen Wochen das kirchliche Leben auch in unseren Pfarren bestimmt, ist lahmgelegt. Fast nichts geht mehr. Pilgerwege in und nach Heimbach werden gestoppt, der katechetische Weg der Eltern in die Taufe ihrer Kinder, der Kommunionkinder in das Fest der Erstkommunion werden unterbrochen. Das tut weh.
Die Messfeiern, die wir Priester in diesen Wochen ohne Gemeinde (und doch stellvertretend für die Gemeinden) feiern, sind nur ein Notbehelf. Wir Priester können zwar die hl. Messe feiern, stellvertretend und im Wissen darum, wie viele Gemeindeglieder sich dem innerlich anschließen; doch diese Feier ist arm. Ich blicke in leere Bankreihen und vermisse Sie und Euch als Mitfeiernde! Ich vermisse bereits an diesem ersten Sonntag des Ausnahmezustands schmerzlich das, was uns so selbstverständlich geworden ist: das Zusammenkommen der Betenden zur Feier des Herrentags. So vieles musste abgesagt werden; so viel liebevoll Vorbereitetes wird stillgelegt und vertagt. Wir bleiben zu Hause und kommen doch am Herrentag in unseren Häusern zum Gebet zusammen und sind gemeinsam dem nahe, der unser Allernächster ist. Wir versuchen, im Gebet geistlich zusammenzurücken und dem nahe zu kommen, der bei seiner Welt in dunklen Stunden bleibt und nie von uns lässt.
Was für eine Paradoxie, auf die auch unsere Kanzlerin hinwies: Wir müssen Abstand halten von unseren Mitmenschen, gerade auch von denen, die uns lieb und teuer sind. Fürsorge durch Distanz. Das Herz sucht vielleicht Nähe und Berührung, der Verstand gebietet Abstand. Distanz um Gottes und des Nächsten willen! Wir müssen unseren Lebensstil ändern, werden auf uns selbst zurückgeworfen. Diese Konzentrationsübung haben wir uns nicht ausgesucht, sie wird mir zugemutet, sie steht uns bevor. Wir werden uns in den kommenden Wochen drinnen und innen neu entdecken. Andere werden draußen bis an ihre Grenzen gefordert. Was uns Aschermittwich gesagt wurde, spüren wir nun existenziell: wir sind verwundbar. Und wir sind potentielle Gefahrenherde; wir sind gefährdete Gefährder, mögliche Überträger. Wir müssen Leib und Leben des anderen schützen, uns selbst schützen.
Doch wir müssen in diesen Wochen auch unsere Seele schützen. Darum rücken wir im Gebet geistlich zusammen. Das Gebet wird nun unsere Kraftquelle, und Lichtsignale wie die brennenden Kerzen im Fenster vernetzen uns. Jetzt ist die Zeit für die Fürbitte und das Bittgebet, aber wir brauchen nun auch den Raum für die Klage, auch die Sprachlosigkeit, das Schweigen und das vielleicht leise Gotteslob. Wir brauchen nun die Geistesgegenwart Gottes, der uns einfallsreich mache für kleine Gesten und liebe Aufmerksamkeiten in den vor uns liegenden Tagen und Wochen. Viele leiden unter der vorübergehenden Vereinzelung. Wir bitten in diesen Tagen um ein waches Leben: um Geduld, Rücksichtnahme, Vorsicht, Besonnenheit, um Zärtlichkeit, die sich eben nicht nur in Berührung und körperlicher Nähe erweist. Wir bitten um Einsicht in das, was im Leben wirklich zählt; eine kleine Hilfestellung, einen Anruf, eine Nachbarschaftshilfe… Hoffentlich macht uns diese Not erfinderisch! Was bleibt uns in diesen einzigartigen Tagen des Fastens und der „Umkehr“ zu tun? Viel Kreativität im Kleinen ist gefragt. Gute Einfälle müssen wir uns schenken lassen, wie wir einander trotz allen Abstands nahe bleiben.
Und dabei ist es zu kurz gegriffen, wenn wir uns fragen: Was können wir in dieser Krise, aus dieser Krise lernen? Als sei Gott einer, der uns wie ein Psychologe und Pädagoge mittels dieser Krise umerziehen will…. Doch bleibt die Frage: Was will uns Gott mit der Zumutung dieser elementaren Lebenskrise sagen? Wie wird diese Grenzerfahrung mich ändern, meinen Glauben, meine bisherigen Prioritätensetzungen? Wir werden – mit einem Wort Bonhoeffers „auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen“. Vieles Laute und Schnelle, Äußerliche und Abwechslungsreiche wird nun nebensächlich. Es wäre viel, wenn der unsichtbare Gott wieder tiefer in mein Blickfeld gerät, wenn wir dankbarer leben mit dem Geschenk unseres endlichen Lebens und die schützen, die nun am Gefährdetsten sind, die alten und kranken Menschen und die, die inmitten der Coronakrise an den Grenzen Europas oder in Syrien um ihr Überleben kämpfen.
Im heutigen Evangelium geht es um eine Blindenheilung Jesu. Um Augen, die sehen, um das rechte Augenmaß, das er schenkt. Um drastische körperliche Maßnahmen, mit denen Jesu der Blindheit eines Namenlosen zu Leibe rückt (Joh 9,6). Suchend und fragend und klagend und auch anklagend stehen Menschen in diesen Tagen vor dem Schöpfer. Wie sehen meine Augen? Wie nehme ich augenblicklich den anderen wahr? Haben wir Angst voreinander? Nehmen wir uns vorrangig als potentielle Bedrohung wahr oder als Geschöpfe, die in derselben Lage sind wie ich: verwundbar, vorsichtig, ängstlich? Jesus heilt die blinden Augen. Verdränge ich wie mit Scheuklappen die Realität? Menschen zeigen in diesen Krisentagen, was an Menschlichem in ihnen steckt. Das Beste und das Schlechteste im Menschen kommen in solchen Zeitenwenden zum Vorschein. Viel Augenmaß wird von den Entscheidungsträgern verlangt. Wir hören von vielen Helferinnen und Helfer, die bis über die Grenze des Menschenmöglichen gehen und mit ihrem Lebenseinsatz zeigen, was das ist: Hingabe, Opfer, Einsatz bis zum Letzten. Die schlichte Fürbitte des Krankenhauspersonals an die ‚Privilegierten‘, die dort nicht wirken müssen, lautet: „Wir bleiben für Euch im Krankenhaus. Bleibt Ihr für uns zuhause.“
So wie Jesus damals dem Blinden den Augensinn gibt, so muss auch er uns heute berühren. Er darf es! Er darf unendlich nahe an uns heran, in unsere Augen, die vielleicht nicht sehen wollen und können: die Realität der Bedrohung, die Sterbenden und Schwerstkranken in den Hospitälern anderer Länder und auch bei uns. Nicht zu begreifen ist die Blindheit von Menschen, die so tun, als seien sie vital und immun und als gäbe es die Gefahr für sie nicht. Menschen, die in dieser Zeit der Lebensgefahr immer noch als Sorglose leben und sich innerlich wegdrehen und wegschauen und nicht sehen wollen, was die Stunde geschlagen hat. Wir können nicht einfach so unbekümmert weitermachen. Der Tanz auf dem Corona-Vulkan muss ein Ende haben. Ein junger Unverbesserlicher sagte: „Das Leben ist zu kurz für eine lange Auszeit“. Aber genau diese Auszeit wird von uns verlangt.
Und darum bitten wir um das Augenwunder Jesu heute. Herr, ziehe nicht an deiner Welt vorbei. Weite unseren Blick für die, die uns nun gerade brauchen, für die, deren Leben sich nun gerade drastisch ändert; für die Erkrankten, die um ihr Leben kämpfen; für die Verängstigten und Isolierten; für die Familien, denen die ständige Nähe womöglich zur Belastung wird; für die, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen; für die Politiker, die entscheiden müssen und die Wissenschaftler, dass ihre Erkenntnisse allen zugutekommt.
Göttlicher Augenarzt und Heiland! Wecke in uns und in dieser Gesellschaft die Kräfte zum Guten. Und segne uns Herr. Bleibe bei uns. Lass uns glauben, dass diese Schöpfung in deinen Händen ruht.
So segne und behüte uns an Leib und Seele unser Gott, der allmächtig und barmherzig ist - der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Kurt Josef Wecker
Evangelium zum 4. Fastensonntag (Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
In jener Zei sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
Jesus spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig,
strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm:
Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der Gesandte.
Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.
Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten,
sagten:
Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte?
Einige sagten: Er ist es.
Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich.
Er selbst aber sagte: Ich bin es.
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern.
Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.
Er antwortete ihnen:
Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich.
Einige der Pharisäer sagten:
Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält.
Andere aber sagten:
Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun?
So entstand eine Spaltung unter ihnen.
Da fragten sie den Blinden noch einmal:
Was sagst du selbst über ihn?
Er hat doch deine Augen geöffnet.
Der Mann sagte:
Er ist ein Prophet.
Sie entgegneten ihm:
Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren?
Und sie stießen ihn hinaus.
Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten,
und als er ihn traf, sagte er zu ihm:
Glaubst du an den Menschensohn?
Da antwortete jener und sagte:
Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube?
Jesus sagte zu ihm:
Du hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, ist es.
Er aber sagte:
Ich glaube, Herr!
Und er warf sich vor ihm nieder.
Meditation:
Die Augen öffnen und sehen:
(Helene Renner) |
| Gebet: Herr Jesus Christus, |
Fürbitten zum 4. Fastensonntag:
1. Wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden: Für die an Covid19 Erkrankten, die im Krankenhaus sind und für alle in Quarantäne.
2. Für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht. Für Arbeitgeber und Selbständige, deren Existenz in Gefahr gerät. Für alle, die voller Angst sind und sich bedroht fühlen.
3. Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind: Für alle, die sich in
Arztpraxen und Krankenhäusernum das Wohl der Patienten und Patientinnen kümmern.
4. Für alle, die sich jetzt im Alltag und in der Freizeit anders verhalten als sonst. Und für alle Verantwortlichen, die für das Land und für Europa wichtige Entscheidung treffen müssen.
5. Für die Frauen und Männer, die im Lebensmittelhandel und in Apotheken arbeiten,um die Grund-versorgung aller gewährleisten zu können. Für alle in den Laboren, die unter Hochdruck Tests auswerten und nach Medikamenten und Impfstoffen forschen.
6. Wir beten für alle Christen und Christinnen, die in dieser besonderen Zeit herausgefordert sind;
und für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die neue Formen entwickeln, wie Menschen ihren Glauben miteinander teilen.
7. Für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt. Für alle, die einander beistehen und sich ermutigen.
8. Wir bitten für uns selbst: Für die Sorgen und Nöte, die jeder und jede von uns mitbringt.
– In Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen
Du bist nicht laut
doch bist du da
still und schweigend
neigt sich der Tag
still und dankbar
dem der ihn gab
still und klein
nur staunen kann
still und suchend
erkennen dann
still und geborgen
von Liebe gerührt
still in Stille
Gott verspürt
(Kevin Küpper)
Das Bild zum Text steht uns nicht zur Veröffentlichung zur Verfügung. Wir verweisen daher auf den Pfarrbrief in der Kirche.
Paul Hey, Die drei Könige aus dem Morgenland
Bildbetrachtung von Pfarrer Kurt Josef Wecker (Nideggen/Heimbach)
Paul Hey schuf kurz vor dem ersten Weltkrieg (1910) das stimmungsvolle Aquarell „Die drei Könige
aus dem Morgenland“, das uns in diesem Jahr auf die Weihnacht einstimmt. Wer war Paul Hey
(1867-1952)? Hey war ein Künstler mit hohem Verbreitungsgrad, ein inzwischen unbekannter Kinder-
und Märchenbuch-Illustrator, ein Designer für Zigarettenwerbung und Zigarettenbilder, Gestalter
von Schul-Wandbildern und von ehedem beliebten Bildpostkartenserien, ein Zeichner und
Idyllenmaler von ‚Heimatkunst‘, auch von christlichen Motiven zu den Festen des Kirchenjahres.
Kaum ein Künstler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – zwischen Wilhelminischem Kaiserreich
und der Weimarer Republik – erreichte eine solche Breitenwirkung und Popularisierung wie dieser
Münchener ‚Kleinkünstler‘, auch wenn sein Name dem Betrachter oft unbekannt blieb. Er stand
anfänglich mit Käthe Kollwitz in Kontakt, wirkte in Gauting bei München. Dieser volkstümliche „Maler
der heilen Welten“ verstand sich darauf – vergleichbar mit Ludwig Richter oder Moritz von Schwind -
eine suggestive Atmosphäre zu schaffen, ohne dass es kitschig, idyllisch oder allzu gemütvoll wirkt.
Die Wallfahrt der Weisen durch die Schneewüste
Weihnachten ist es zwar drinnen behaglich, aber an diesem Fest sind wir eingeladen, nach draußen
zu treten, nach oben zu blicken. Draußen kann man den Himmel besser sehen. Vielleicht werden wir
Weihnachten auch zu ‚Himmelsguckern‘, ärgern uns über graue Wolken und Schmuddelwetter,
staunen über die Unermesslichkeit des Alls oder erschrecken angesichts eines leeren, zeichenlosen
Himmels. Heys Bild „Die drei Könige aus dem Morgenland“ hinterlässt einen seltsamen Eindruck: Eine
Karawane stapft in einer klaren, kalten Winternacht durch eine Schnee-Wüste. Diese Landschaft
wirkt sehr nordisch; man könnte sagen: eine ‚typisch deutsche‘ Vergegenwärtigung des
Heilsgeschehens. Solche Schneefelder gibt es wohl kaum vor Jerusalem. Wir nehmen Menschen war,
die unterwegs sind unterm Firmament. Schemenhaft bewegt sich eine ‚verschworene Gemeinschaft‘
andächtig und schweigend durch die stille Landschaft einem ganz bestimmten Ziel entgegen. Wer
geht an der Spitze, wer kennt die Richtung und wer ahnt das Ziel? Die Karawane, die an uns
vorüberläuft, hinterlässt Spuren im Schnee. Männer kommen mit Kamelen und Eseln; es sind
Orientalen mit einem Turban auf dem Kopf; darunter sind die drei Weisen, die „Magoi“ -
tiefblickende, darum ‚königliche‘ Menschen. Sie kommen mit ihrem Gefolge, wohl ihren Dienstboten.
Die Lichtführung auf dem Bild ist sehr gelungen: Einer der Begleiter trägt offenbar eine Laterne,
deren Schein einen der Magier in ein geheimnisvolles Licht taucht. Diese Männer bewegt keine
romantische Sehnsucht nach der unerreichbaren Ferne; dargestellt ist auch nicht das auserwählte
Wüstenvolk Israel auf dem Weg in das Gelobte Land. Das sind keine orientierungslos
umherstreifenden Nomaden, auch keine Händler auf der Weihrauchstraße, die ihren eigenen
Geschäften nachgehen. Ein auffallender Stern (Mt 2,2) hat Wissensdurstige neugierig gemacht. Ein
Komet mit einem gewaltigen Lichtschweif gab ihnen Orientierung. und sie begaben sich auf eine
Abenteuerreise. Auch dieses fremde „Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“ (Jes
9,10). Erst im Nachhinein wird sich zeigen, dass Gott sie zum Aufbruch drängte, dass dieser
Wüstenzug die erste Christus-Wallfahrt, die erste „Heiliglandreise“ war, dass diese Sternenkundige -
vielleicht aus dem Zweistromland - Pilger waren und ihnen am Ziel in einem Kind der „strahlende
Morgenstern“ (Offb 22,16) aufgehen wird. „Durst und Schweiß der langen Reise, wer denkt daran
zurück…“ (GL 829,3). Sterne geben Grund zum Staunen; die Gestirne sind die am ‚höchsten‘
liegenden und entferntesten Objekte, die wir Menschen wahrnehmen können; längst verglühte
Sterne, die Vergangenheit geworden sind; also Licht von ‚gestern‘, das uns heute erreicht. Wenn wir
den gestirnten Himmel über uns bestaunen, dann blicken wir in die Vergangenheit. Manches Licht war tausende Jahre lang unterwegs zu uns. Nachts kommen diese Leuchten zum Vorschein, sofern
uns nicht die immer mehr um sich greifende ‚Lichtverschmutzung‘ den Ausblick auf das gestirnte
Universum verunmöglicht. Doch es sind ‚nur‘ Geschöpfe, vom Schöpfer ins Werk gesetzte und
angeknipste ‚Lampen‘ (Gen 1,14f) am Himmelszelt. An das Universum können wir keine Wünsche
richten. Wir sind keine Sonnenanbeter oder Menschen, die sich vom Horoskop abhängig machen.
Davor wird schon in Dtn 4,19 gewarnt: „Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze
Sternenzelt siehst, die Sonne, den Mond und die Sterne, dann lass dich nicht verführen! Du sollst dich
nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen dienen. Der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern
überall unter den Himmel zugewiesen.“ Die Karawane nimmt den Kometen als Wegzeichen wahr.
Mehr nicht! War der Komet in Wahrheit die auffällige Konjunktion, das enge Nebeneinander der
Planeten Saturn und Jupiter im Sternzeichen des Fisches im Jahre 7 vor Christus? So vermuten
Historiker. Der Stern wurde zum ‚Navi‘. Irgendwann hat der Himmelskörper, der so auffällig zum
Vorschein kam, seine Schuldigkeit getan. Er wird stehen bleiben (Mt 2,9), denn er war nur ‚Vorläufer‘
und wird überflüssig. Weihnachten ist ein Geschehen voll kosmischer Anmutung - und ein ‚Suchspiel‘.
Selbst die Sterne spielen mit beim Krippenspiel, doch nur eine Nebenrolle. Denn der Stern von
Bethlehem ist bloß stummes Zeichen eines weltbewegenden Wunders, dass der wahre
‚Morgenstern‘ auf die Erde gefallen ist, dass wir den Retter ‚ganz unten‘ suchen dürfen im Futtertrog,
in einem armseligen Kind. Da kommen zur Weihnacht zusammen, was man sonst säuberlich
scheidet: Ein kosmischer Ausnahmezustand, königliche Weise, stinkende Tiere und ein
Armeleutekind, das in Wahrheit das Königskind ist. In diesem ‚kleinen Gesicht‘ kommt Gott am Rand
des Imperiums in einem Erdloch ‚zum Vorschein‘. Dieses Kind, einmal zum Mann geworden, wird zum
„Stern der Gotteshuld“ (GL 220,4) werden, der mit uns wandert und unsere Lebenswege beglänzt.
Meine Lebensreise, sie läuft in Christus auf Gott zu, ob ich es glaube oder nicht.
Die Karawane zieht weiter
„Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst“ („dä Sultan hät Doosch“ – so heißt es bei den
‚Höhnern‘). Ein arabisches Sprichwort lautet: „Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter“. Die (im
Orient als unrein geltenden) Hunde kläffen, doch die Kamele und Esel schreiten unbeirrt voran. Diese
Reisenden gehen neugierig und mit langem Atem. Die Sternkundigen sind keine Sterngucker, die in
ihrem Elfenbeinturm blieben; sie waren bereit zur Entdeckungsreise nach dem Neuen und
Unerwarteten. Das ist ‚Schöpfungsfrömmigkeit‘. „Blicke auf zu den Sternen, hab‘ acht auf die
Gassen“, rät der Dichter Wilhelm Raabe. Der adventliche Hinweg dieser Reisenden ist lang, sie
werden Umwege machen und irgendwann wieder auf der langen Heimreise sein. Unser Weg zur
Christmette ist trotz größerer Pfarrverbände gut erreichbar. Wir haben die Wahl. Doch der
Weihnachtsgottesdienst dieser Winterreisenden findet nicht im ‚Nahbereich‘ statt. Nein,
Weihnachten ist nicht einzuordnen in das Gewohnte und Altbekannte, ist nicht ‚das Abenteuer direkt
um die Ecke‘. Gott kommt von weither zu uns und lädt uns ein, ‚Fernpilger‘ zu werden. Die anonymen
Gottsucher aus dem Osten sind – in ihrem Suchen und Forschen - von Gott Besuchte. Das ist die
Weihnacht der Ferngereisten, der Fernstehenden, der unerwarteten und späten Gäste. Was haben
sie dabei? Welcher Ruf machte ihnen Beine? Spürt diesen diese Nachtwanderer, dass ihnen die
Weihnacht bevorsteht. Im Gang ist eine Suchbewegung von Gottbewegten - unterwegs zum
Geburtsort des Messias. Begabt mit der Weisheit des Ostens, reisen sie auf ihren Kamelen und haben
Platz für Gepäck und Geschenke, für Gold, Weihrauch und Myrrhe. Der Startschuss zum Aufbruch
kam für diese Klugen von außen. Es musste ein äußeres Zeichen sein, so wie auch das
Weihnachtsevangelium aus offenem Himmel und aus Engelsmund den Hirten Beine machte (Lk
2,9ff). Von sich her kämen wir nicht drauf, dass uns in der Heiligen Nacht das Heil widerfährt.
Weihnachten reden wir uns nicht ein. „Extra nos“ (Luther), ‚ außerhalb von uns‘ und gerade deshalb
‚für uns‘ geschieht Weltbewegendes. Ohne den Stern hätten die späten Weihnachtsgäste keinen
Grund gehabt aufzubrechen, wären sie auch nie durch die weglose Wüste am Ziel angekommen. Trotz ihrer Neugier und ihres Wissensdurstes haben diese anonymen Pilger kein selbstgestecktes Ziel.
Wer sucht, der findet – doch nicht immer das Richtige. Wer sucht, der wird gefunden vom Stern und
von einem Ziel, das wir uns nicht ausdenken können und das uns doch gleichsam magnetisch anzieht.
Am Ziel der Reise geht diesen Reisenden auf, dass sie gekommen sind, um auf die Knie zu fallen und
anzubeten – und dann beschenkt heimzukehren in ihr Land (Mt 2,12). „Siehe, die Weisen haben sich
aufgemacht. Ihre Füße liefen nach Bethlehem, ihr Herz aber pilgerte zu Gott“ (Karl Rahner).
„Eine wahrhaft ungeheure Reise“ (Franz Kafka)
Wir Betrachter haben das Nachsehen. Wir sehen Rückenfiguren. Sie laufen an uns vorbei. Uns bleibt
nur die Rückenansicht. Doch diese Perspektive ist eine Einladung zur Entscheidung: Bleibe ich
sesshaft und verpasse die Gunst der Stunde? Oder will ich mich dieser Gruppe anschließen, die nicht
seelenruhig zu Hause sitzen bleiben konnte? Wollen wir uns mitnehmen lassen oder verträumt einer
Karawane ‚aus tausendundeiner Nacht‘ nachschauen? Leide ich an geistlichem Bewegungsmangel?
Hey versetzt den Zug der Weisen in eine ‚deutsche Landschaft‘. Hier geschieht ‚Liveschaltung‘
zwischen damals und heute! Halten wir – hier und heute - unerwartete Orte und Zeiten für möglich,
an denen sich die Begegnung mit dem Unendlichen ereignen kann? Und falls ich mich diesen
Vorläufern anschließen sollte - werde ich Schritt halten? Werde ich den langen Atem behalten, dabei
zu bleiben? Werde ich am Ziel enttäuscht sein, weil ich mir mehr versprochen habe als ein Kind und
dessen Mutter (Mt 2,11)? Wird mich der Lockruf Gottes zum Suchen und Fragen bewegen? Oder
bleibe ich ungerührt im Gewohnten, bleibe ich der/die Alte? Das diesjährige Bild zum Fest zeigt also
die Weihnacht der Spätkommenden. Der Evangelist Matthäus sagt uns: Auch ihr fernen und späten
Gäste, auch ihr Anderen gehört dazu, mitsamt den neuen Erfahrungen, die ihr mitbringt, die uns
bereichern und vielleicht irritieren. Die Spuren dieser Karawane im Sand und Schnee sind längst
verweht. Die frommen Sterndeuter sind längst von der Bildfläche abgetreten. Das waren keine
Kirchenmänner, keine Funktionäre und Amtsträger. Fremde Gäste waren beim Kind zu Besuch, doch
sie wurden darum keine Apostel oder Missionare. Am Reiseziel stand ihnen eine irritierende und
beglückende Begegnung bevor: das irdische Gegenüber zu dem gewaltigen Stern hoch oben ist der
Gott ‚in Knechtsgestalt‘ ganz unten. Zu sehen gab‘s nicht mehr als eine Mutter-Kind-Gruppe. Lohnt
sich der Aufwand für dieses armselige Ziel? Hast du, Gott, nicht mehr zu bieten?
„Entdecke mich!“ - so das Motto der Heiligtumsfahrt 2021 in Aachen. Entdeckt das Neue, das vor uns
liegt und uns entgegenkommt! Entdeckt das Wunder, das Gott längst für Euch bereitet hat! Lasst uns
aufmerksam schauen und gehen und staunen und anbeten; lassen wir Verwandlung an uns
geschehen! Weihnachten macht uns staunen. Der neue Mensch geht uns auf, er taucht still und
ohnmächtig auf. Der, der den Namen ‚Jesus‘ trägt, ist der Morgenstern, der in den Schoß Marias, auf
die Erde, in den Erdtrog von Bethlehem, in unser Fleisch und Blut gefallen ist. Er ist der neue Star, der
nie untergeht und verblasst. „Unterwegs“ (Hebr 13,14; 1 Petr 2,11) waren die jüdischen Hirten, um in
einem nächtlichen Suchspiel nach einem Kind ‚in Windeln gewickelt‘ Ausschau zu halten und darin
nach dem verheißenen Messias. „Unterwegs“ waren diese heiligen Heiden. Nur wer den Weg nicht
scheut, erfährt das Ziel. Nur wer den Standortwechsel vornimmt, erfährt Verwandlung und sein
Weihnachtswunder. Werde ich mich auf den Weg machen zu dem, der ‚Weg‘ und Wahrheit ist? Gott
hat eine unendliche Reise hinter sich, um bei mir und dir anzukommen; er taucht nicht als blasse Idee
in den Köpfen der Gelehrten auf, er ist keine Sternengottheit. ER tritt zu uns als Mensch. Er – einer
von uns. In dem winzigen Jesus setzt er sich zu uns in Bewegung, um bei dir und bei mir
anzukommen, um uns anzusehen. Keine Nacht ist zu dunkel, und kein Weg ist zu weit für ihn.
Ihnen und Euch gesegnete Krippenwege, eine frohe Weihnacht und ein heiles Ankommen unter
Seinen Augen! Möge Christus, der neue ‚Stern‘, auch in unserer Nähe zum Vorschein kommen!
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Leider steht uns dieses Bild zur Veröffentlichung nicht zur Verfügung , daher verweisen wir an dieser Stelle auf den Pfarrbrief in unserer Kirche.
Ostern – Faszination und Erschrecken
Bildbetrachtung von Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Was ist da wohl passiert in aller Herrgottsfrühe an diesem Ur-Sonntag? So fragen wir uns zu Ostern und stellen
uns zuweilen die Auferstehung Christi so vor, aber können wir sie konkret im Bild festhalten.
Vincenzo Campi (geb. 1530 /1536, gest. 1591), ein unbekannter Maler aus dem norditalienischen Cremona,
malte um 1580 ein Ereignis, das alle Maße sprengt. Das Bild befindet sich mit 14 anderen ‚Tondi‘ (Rundbildern)
heute in der Kollegiatskirche S. Bartolomeo Apostolo in Giuseppe Verdis Geburtstort Bussetto bei Parma
in der Emilia-Romagna. Es stellt uns eines der „glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes“ vor Augen:
Christi Auferstehung. Und dabei legt Campi sich keine Zurückhaltung auf. Anschaulich und dramatisch geht es zu.
Aber wünschen wir uns eine solche Christuserscheinung? Wünsche ich mir eher Frühlingserwachen
als Christi Erwachen? Kann man Ostern so anschaulich ins Bild bringen? Campi will das Geheimnis der Auferstehung
– den im Evangelium nicht beschriebenen Augenblick des Verlassens des Grabes - nicht scheu wahren.
Nein, er füllt die ‚Leerstelle‘ und stellt uns den Auferstandenen drastisch, voller Pathos, ja bombastisch und
durchaus ‚fragwürdig‘ vor Augen. Ostern ist ein ‚öffentliches Geheimnis‘ und eine sehr fremde
Geschichte, ein uraltes und immer neues Wunder. Campi betont die ‚körperliche Auferstehung‘ Jesu.
Befremdlich auf uns Betrachter wirkt der Versuch des Künstlers, uns das unvorstellbare Mysterium
von Ostern, das von der Bibel nicht Erzählte, trotzdem nahezubringen. Verwegen überschreitet er die
Grenze, die das Evangelium setzt; die Osterbotschaft hingegen mutet uns Glaubenden zu
auszuhalten, dass der Vorgang der Auferstehung unseren Blicken entzogen bleibt. Doch die
Vorstellungskraft des ‚Augenmenschen‘ Campi bedient meine Neugier, mein Schauverlangen. Der
Maler aus Cremona missachtet gewissermaßen das Bilderverbot - als sähen wir, wie die Grabwächter
und aus sicherer Distanz, dem unfassbaren Geschehen der österlichen ‚Lichtsekunde‘ zu.
Campi setzt mit einem ausdrücklichen Körperinteresse den österlichen Herrn vertikal und frontal in
Szene: Christus erscheint als Ganzfigur, der in der Mittelachse des Bildes schreitet. Mit ‚himmelndem
Blick‘ ist er unterwegs nach ‚oben‘; er hält sich dem göttlichen Vater entgegen. Jesus trägt den
Kreuzstab und das im Osterwind flatternde Auferstehungsbanner. Der barfüßige Osterheld ist kaum
bekleidet; ein Manteltuch in leuchtendem Blau umhüllt diesen überlegenen, machtvollen Sieger, der
wie ein heidnischer Gott, wie ein athletischer Apoll wirkt: Christi Aufstieg zum Licht, sein Übergang
vom Tod zum Leben. Kann diese Heldengestalt der Gekreuzigte sein? Die Wundmale Jesu muss man
mit der Lupe suchen, die Seitenwunde ist nur zu ahnen. Hat sich Jesus durch die österliche Tat des
Vaters so gewandelt? Dieser Christus ist offensichtlich das Sinnbild des erlösten, verklärten
Menschen, der „schönste Herr Jesus“ (GL 364), Triumphator über den alten Feind, den Tod. Jesu
Lichtleib leuchtet auf im übernatürlichen Glanz. Leichtfüßig, beinahe schwebend, entmaterialisiert,
mit hochgestelltem gewinkeltem Bein – so tritt er auf den Sargdeckel des „Heiligen Grabes“. Diese
energiereiche Gestalt wirkt so souverän, als habe sie längst das Leiden des Karfreitags hinter sich
gelassen, als sei der Gekreuzigte von seinen tödlichen Verletzungen erlöst und seien die Wunden des
Karfreitags wundersam auf seinem makellosen Körper geheilt. Liegt hier eine Verwechslung vor? Wie
kann der gemarterte Leib des gekreuzigten Herrn auf einmal so schön sein? Man muss wohl ein
Mensch der Renaissance und ein Maler des Manierismus sein, um diesen kraftvollen Auftritt Jesu zu
verstehen. Ja, Ostern ist das Fest der Verwandlung. Auferstehung ist für Vincenzo Campi nicht das
mühevolle Erwachen eines geschundenen Leichnams. Hier arbeitet sich kein ausgebluteter,
versehrter Gekreuzigter mühsam aus der Grabeshöhle nach oben. Nein, voller übernatürlicher
Leichtigkeit und aus eigener Kraft tritt Er hervor. Dieser Christus braucht keine Engel, die das
Ostergeheimnis verkünden. Auferstehung scheint mühelos zu geschehen, ist evident. Christus
befindet sich im Aufwind - auf dem Weg zur Himmelfahrt und zur endgültigen Verklärung. Wo bleibt
im Pinselstrich des Künstlers die Scheu vor dem Unvorstellbaren, wo die Wahrheit des Engelworts „Er ist nicht hier!“? Der
Lichtschein wirkt wie ein gewaltiger Nimbus. Christus ist der, der als „unbesiegte
Sonne“ quasi auf Löwen und Drachen tritt (Ps 91,13) und sich als unwiderstehlicher Sieger durchsetzt
(vgl. 1 Kor 15.55 und Eph 6,14f).
Repräsentanten der überwundenen Gegenwelt auf unserem Bild sind die Grabwächter, diese
seltsamen Nebendarsteller des Heilsdramas, von denen in den kanonischen Evangelien allein
Matthäus (Mt 27, 62-66 und 28, 1-6) erzählt. Sie sind Diensthabende des Imperiums und wurden auf
Geheiß des Pontius Pilatus an der Begräbnisstätte Jesu postiert. Die Feinde Jesu - die Hohenpriester,
die Ältesten und Pharisäer (vgl. Mt 27,62) - baten den Vertreter Roms um Sicherheitskräfte für das
Grab; denn Jesus habe zu Lebzeiten verkündigt, er werde nach drei Tagen auferstehen. Und so
wurden die kriegerischen Wächter auf den Plan gerufen; sie nahmen vor dem Grab Aufstellung, um
den Leichnam sicherzustellen und sicherzugehen, dass nicht etwa die Jünger dieses Nazareners den
Leichnam mit krimineller Energie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wegnehmen und dann behaupten,
der Tote würde doch noch leben. Sicherungsmaßnahmen sollen garantieren, dass kein Ostergerücht
in Umlauf kommt. Diese Wachgesellschaft wird aufgeboten als Garant dafür, dass nichts
Unvorhersehbares geschieht, dass alles in bester Ordnung bleibt. Nichts ist gewisser und endgültiger
als der Tod. Die Fesseln des Todes sind unlösbar, und der Tote bleibt bewegungslos und gehört auf ewig weggeschlossen.
Die Folgen und Wirkungen des Auferstehungsereignisses sind für die Wächter umwerfend. Die
räumliche Enge des Bildes unterstreicht deren Aussichtslosigkeit. Die Konfrontation der muskulösen
und doch überwundenen Wächter mit dem Auferstandenen gibt dem Bild Dramatik. Gott handelt
auch an ihnen: „Als der Engel erschien, erschraken die Wachen aus Furcht und wurden, als wären sie
tot.“ (Mt 28,3f). Jeder der vier Wächter reagiert auf seine Weise. Die vier Wächter befinden sich im
dunklen unteren Bildvordergrund, eine erdenschwere Gruppierung, buchstäblich dem Irdischen
verhaftet. Der wie schlafend Niedergestreckte erinnert an das Matthäuswort, dass die Wächter „wie
Tote“ dalagen. Gegenüber der steilen Vertikale des schwerelosen Christus-Corpus bilden die
Wachposten eine Horizontale. Am Boden haftend, sind sie das Gegengewicht zur Leichtigkeit und
Erhabenheit Jesu Christi. Der Maler kann sie nur als Besiegte ins Bild bringen, als Gefallene,
Gestürzte. Geblendet, abwehrend, zurückweichend, erschrocken, fixiert, wie bei einem Höllensturz
zu Boden gehend, niedergeworfen, in Schlaf gefallen - gebannt von der Wucht der Präsenz des
Auferweckten. Ihr Wachdienst war vergeblich. So wirken sie fast komisch. Wenn Gott handelt, sind
alle menschlichen Vorkehrungen und Absicherungen vergeblich. Keiner von ihnen wird gegen
Christus Hand anlegen. Mir fällt auf, dass drei von ihnen auf das reagieren, was sich ‚über‘ ihnen
ereignet. Das, was sie erblicken, sprengt die alte Ordnung, für die sie einstehen. Christus kämpft und
siegt durch die Waffe seiner unentrinnbaren Gegenwart, durch die Herrlichkeit seiner Erscheinung.
Die vier Männer symbolisieren gewissermaßen den Herrschaftsraum des Todes und der Sünde. Einer
von ihnen trägt eine metallische Kopfpanzerung, auf der sich das übernatürliche Licht widerspiegelt.
Die Wachen sind gerüstet, der Heilige ist nackt - und frei. Das erinnert mich an den Schlusschor der
Priester in Mozarts wunderbarer „Zauberflöte“: „Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht,
zernichten der Heuchler erschlichene Macht!“
Es ist paradox: Nach der Deutung des Malers erblicken ausgerechnet drei der Wächter, also die
amtlich bestellten „Verhinderer“ des Wunders, die Auferstehung. Doch dieses Sehen, das
augenscheinliche Dabeisein bei einer zuvor nie gesehenen Lichtvision, macht sie nicht zu Zeugen.
Dabeisein ist nicht alles. Die Wächter, die vom Osterereignis so überrascht wurden, werden nicht zu
Verstehenden. Sie erblicken ein furchterregendes Spektakel, mehr nicht. Das bloße Sehen bewirkt in
ihnen nichts als Schrecken. Sie nehmen keinen Anteil an dem, was sie sehen. ER erscheint, doch er
gesellt sich nicht zu ihnen. Einer der Wächter schläft. Was für eine Ironie: ein schlafender Wächter!
Ohnmächtige und schlafende ‚Zeugen‘ sind lächerlich (vgl. Mt 28, 4.11.13). Die Klarheit der Gestalt Christi bleibt den
Männern dunkel und unheimlich. Obwohl diese Gestalten dem Geheimnis räumlich
so nahe sind, machen sie keine Ostererfahrung. Ihnen widerfährt auch keine echte
Christusbegegnung. Sie werden ungerührt und unverwandelt zurückbleiben. Oder halten wir die
Bekehrung der Männer für möglich? Einer der Wächter ist Lanzenträger. Ist dieser Mann Longinus,
der blinde Soldat, der das Herz des Gekreuzigten durchstoßen hat und im Blut Christi sehend wurde?
Aus Osterschrecken könnte Osterstaunen werden.
Die Grabwächter erinnern uns daran, wie strittig die Osterbotschaft war und ist. Es ist so schön
schwer, an das Ostergeheimnis zu glauben! Mit vielen intellektuellen Verrenkungen lehnt man sich
dagegen auf, dass der Gekreuzigte lebt. Auch mein „verknäultes“ Innenleben besetzen Mächte, auch
mein Herz umzingeln ‚Wächter‘, Garanten des alten Systems, die wollen, dass alles beim Alten bleibt,
dass Jesus ohnmächtig festgenagelt und begraben wurde, ein Mann der Vergangenheit ist und sich
nicht einmischt in meine inneren Angelegenheiten. Wen kann ich heute unter diese Wächter stellen,
die ihn im Auftrag der ‚Mächte und Gewalten dieser Welt‘ wegschließen wollen? Nein, es ist nicht
menschenmöglich, dass der Herr sich frei macht ‚von des Todes Banden‘ und sich mit der sanften
Gewalt seiner Liebe durchsetzt. Will ich Zeuge der Osterbotschaft sein wie die Frauen am Grab? Oder
gehöre ich zu denen, die Gottes lebensrettendes Handeln am toten Jesu und Christi Erscheinen nicht
für möglich halten? Gehöre ich zu denen, die am liebsten Jesus unter Verschluss halten möchten,
damit alles so bleibt, wie es ist; dass es mit Jesus ‚aus und vorbei‘ ist, dass er für immer und ewig ein
Mann von gestern ist, bloß ein totes Vorbild? Könnte ich also in einem österlichen Mysterienspiel die
Rolle eines der Wächter übernehmen? Die Osterbotschaft – ist sie eine unbewiesene Behauptung
oder ein illusionärer Trost? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod, an ein Leben, das der
Auferstandene mit dir und mit mir teilen wird? Glaubst du daran, dass Jesu Auferweckung die
Reihenfolge von Leben und Tod umkehrt? „Mitten im Tode sind wir vom Leben umfangen“ - so kehrt
Martin Luther die Weisheit dieser Welt um, dass wir mitten im Leben vom Tod umgeben sind. Lassen
wir uns also durch die ‚natürliche Reaktion‘ der Wächter zumindest heilsam irritieren von der
unfassbaren Botschaft, dass ER lebt! In ihrer ‚Heidenangst‘ machen die Wachhabenden deutlich,
dass es auch einen Osterschrecken gibt. Das unfassbare Geschehen am Morgen - als dunkler Nebel
aufquoll, noch ehe die Sonne aufging - ist zum Fürchten. Auch den Frauen am Grab wird dieser
Schrecken nicht erspart bleiben. Vielleicht müsste auch ich mich von Zeit zu Zeit unter diese
Wachleute mischen, müsste durcheinandergewirbelt und überwältigt werden von dem Neuen, das
Ostern bringt… Wie schwer fällt die unbeschwerte Osterfreude. Ostern macht eher verlegen, und
manchen Christen ist der Osterglaube sogar peinlich.
Man wünscht sich zuweilen, dass der Herr die Wächter des Todes wegfegt. Es ist eine große
Anfechtung für uns Glaubende, dass sich mit Christi Auferweckung so wenig in der Geschichte
geändert hat, dass Jesu Sieg so tief verborgen ist und die dunkle Seite der Geschichte
überhandnimmt – auch inmitten der Kirche. Dieser Christus wahrt Distanz, auch zu uns Betrachtern.
Er ist der Überlegene und Freie, der sich den Zugriffen der Wächter, aber auch den frommen
Zugriffen der Kirche entzieht. Uns steht „Christus Victor“ in seiner gleißend hellen Lichtglorie über
dem Grab gegenüber. Das Bild zeigt uns die ‚starke Seite‘ Jesu. Es ist eine Versuchung, sich den
wundlosen Jesus auszumalen. Campi setzt alles daran, uns Ostern und Erlösung als Sieg, als
Erhöhung, als ‚glorreiches Geheimnis‘ zu präsentieren. So wie hier erscheint Er uns nicht. Jesu Blick
verdeutlicht: Er ist auf dem Weg zum Vater. Er ist der uns Entzogene. Er gehört auch nicht seiner
Kirche. Doch tief verborgen bleibt er da und bittet: Glaubt an meinen Sieg der Liebe, an dem ich euch
Anteil gebe. Diese krisengeschüttelte Kirche darf von Seinem Sieg erzählen. Allein dafür ist sie da.
Frohe Ostern!
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Das Bad am Heiligen Abend – Gottes Herrlichkeit über dem Waschwasser
Bildbetrachtung zu Lorenzo Lotto, Natività (1521, Pinatoteca Nazionale, Siena)
von Kurt Josef Wecker
Man muss schon in die nichtoffiziellen, nichtkanonischen Evangelien der frühen Kirche eintauchen, um anderes und ‚mehr‘ zu erfahren vom Geschehen der Heiligen Nacht: Details, Anekdotisches, Legenden aus diesen „Apokryphen“ über wunderbare Begleiterscheinungen der Christgeburt… Von Weihnachten ist nie genug erzählt. Ungewohnte Blickwinkel können hilfreich sein, unbekannte und volkstümliche Legenden, die sich um das Weihnachtsgeheimnis ranken und ihren Niederschlag gerade in den Liturgien und Geburtsdarstellungen der byzantinischen Kirche des Ostens gefunden haben. Sie zeigen, wie phantasievoll sich die frühe Kirche, die Ikonenkunst des Ostens (Sinai, Byzanz, Armenien, Russland) und manche Weihnachtsgemälde des Westens das unfassbare Ereignis der Fleischwerdung des Wortes Gottes ausmalten. Da gibt es nichtkanonische Kindheitsevangelien - aus dem 2. Jh.: Protoevangelium des Jakobus 19; aus dem 8./9.Jh.: Pseudo-Matthäus 13,5; auch die ‚Legenda aurea‘. In diesen Überlieferungen tauchen zwei Frauen auf, von denen Lukas und Matthäus schweigen: zwei Hebammen, Geburtshelferinnen, Badefrauen: Zelomi (Zebel) und Salomo. Dazu kommt das für uns fremde Motiv des ersten Bades des Messias. Josef habe die Geburtshöhle gefunden und sei dann hinausgegangen, um eine ‚hebräische‘ Hebamme (vgl. Ex 1,19) in der Gegend von Bethlehem zu suchen; er fand eine (Zelomi) und nahm sie mit; sie musste nicht tätig werden, sondern nahm gläubig staunend das übernatürliche Geschehen in der von einer Lichtwolke erfüllten Geburtshöhle wahr, wurde Augenzeugin und erzählte dann einer anderen Hebamme vom Wunder der Jungfrauengeburt. Diese (Salome) jedoch zweifelte und sagte: „So wahr der Herr, mein Gott, lebt, wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren (Marias) Zustand untersuche, so werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat“. Dann habe sie sich zur Untersuchung Marias bereitgemacht. Sie will Maria ‚examinieren‘. Doch: „Weh über meinen Frevel und meinen Unglauben; denn ich habe den lebendigen Gott versucht; und siehe, meine Hand verdorrt, wie vom Feuer verzehrt“. Für ihren Zweifel wird sie von Gott bestraft; dann habe sie gebetet; ein Engel stand auf einmal vor ihr, der sagte: „Salome, Gott, der Herr, hat dein Gebet erhört. Tritt herzu, leg deine Hand auf das Kind, so wird dir Heilung geschehen“. An die Stelle des zweifelnden Josef – diesen Zweifel an seiner Verlobten kann die Kirche nicht allzu stark machen - tritt die zweifelnde Hebamme mit ihrer Reue, der gläubigen Berührung des Gotteskindes, dem ‚Weihnachtsgeschenk‘ der Heiligung ihrer verkrüppelten Hand. Auf dem Aachener Marienschrein sehen wir das Motiv übrigens auch: Dort hat Salomo ihre verdorrte Hand verbunden. Zur Menschlichkeit des Erlösers – dafür steht das in den außerkanonischen Evangelien nicht erwähnte Bad - tritt von Anfang an das Wunderbare seiner göttlichen Ausstrahlungskraft. Salomo tat das, was später viele Kranken taten: Salome suchte Hautkontakt zum Salvator, feierte geistliche Kommunion mit ihm und wurde geheilt. In Bethlehem wird erzählt von einer Wasserquelle in der Geburtsgrotte, in Rom (heute S. Maria in Trastevere) erinnert man an eine Ölquelle, die zeitgleich entsprang, als Er zur Welt kam.
Ein unbekannter, von vielen Zeitgenossen unverstandener, unterschätzter, zugleich tiefreligiöser Maler bringt uns dieses ungewöhnliche Sujet in seiner Deutung der „Nächtlichen Geburt“ nahe. Es muss nicht immer Tizian, Raffael oder Leonardo da Vinci sein. Lorenzo Lotto (1480-1557) war ein venezianischer Künstler, der allerdings von Jugend an ein ruheloses Wanderleben geführt hat. Der Venezianer wirkte in Treviso und Bergamo, Rom und Venedig; zuletzt hat er in den Marken gearbeitet, und ab 1552 war er Laienbruder im Marienheiligtum Loreto. Lorenzo Lotto steht eher in der zweiten Reihe der Renaissancemaler Italiens. Das Gemälde ‚Natività‘ (Geburt) entstand wohl 1521 in seiner Zeit in Bergamo. In Loreto legte er das Armutsgelübde ab. Als Maler hat er weitergewirkt; es heißt, er habe in Loreto die Ziffern auf den Betten des Hospitals gemalt. In Loreto hat er in stiller Abgeschiedenheit sein Leben beschlossen. Das Motiv der ‚ungläubigen Salome‘ und ihrer ‚verkrüppelten Hand‘ war eigentlich nur in der vormittelalterlichen Kunst geläufig. Im Westen wurde diese Wundergeschichte als ‚Beweis‘ der Jungfräulichkeit Marias abgelehnt. Der tiefgläubige Renaissancemaler Lorenzo Lotto jedoch rehabilitiert diese Tradition und hilft uns, mit seiner gemalten Weihnachtspredigt einzukehren in das Geheimnis der „stillen, heiligen Nacht“. Er lädt uns ein, quasi in der ersten Reihe zu sitzen und das Fest des Bades Christi, die Feier der Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes, auszukosten. Gottes Herrlichkeit über dem Waschwasser! Unser diesjähriges Weihnachtsbild, das Kind im Badewasser, ist zwar unbiblisch, aber vielen koptischen, armenischen und orthodoxen Christen und Ikonenmalern ist die Legende wichtig: das erste Bad und das erste Wunder Jesu an der verdorrten Hand einer zweifelnden Frau. Sie ist Zeugin - wie die Frauen am leeren Grab; sie wird beschenkt - wie der ‚ungläubige‘ Thomas am Osterabend, dem sich der Herr auch zur Berührung anbietet. Die Verbindung von Badeszene und dem Motiv der zweifelnden Salome macht den eigentümlichen Reiz dieses Gemäldes aus. Zelomi, die andere, Gott preisende Hebamme, ist nicht zu sehen, ebenso wenig der Engel, der in den apokryphen Erzählungen Salome zur Berührung Christi ermutigt hatte. Jesus, der eintaucht in seine Welt, wird wie jedes auf die Welt gekommene Menschenkind hineingetaucht in das Wasser, wird ‚erniedrigt‘ in das Becken; er nicht nur aus hygienischen Gründen in Badewasser gereinigt. Die junge Maria übernimmt diese Handlung; Salome, die deutlich Ältere, kauert neben ihr. Maria ist so mütterlich ganz ohne Heiligenschein dargestellt: sie leuchtet in ‚fremdem‘ Licht, im Glanz des Neugeborenen. Josef fehlt auf dem hier vorgestellten Bildausschnitt; Lotto malt ihn abseits hinter den beiden Frauen; staunend nimmt er den Moment der wundersamen Heilung der steif gewordenen Hände wahr. Auch das kleine Feuerchen im Hintergrund, das der schweigsame Mann entfacht hatte, fehlt auf dem Bildausschnitt. So wie Jesus in Windeln gewickelt wird wie jedes Baby (Lk 2,7. 11), so ist auch das Bad des armen, nackten Christus ein ‚normaler Vorgang‘ – doch zugleich ein heiliges Geschehen; es dient zur Bekräftigung der Fleischwerdung Gottes, wird zu einem Vorspiel der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes, der er sich freiwillig unterziehen wird. Maria ruht sich nicht - ermattet durch die Geburt - als erhabene Gottesgebärerin auf dem Wochenlager aus; sie schaut auch nicht - wie auf den Ikonen - dem Bad des Kindes durch die Hebamme zu. Sie lässt es sich nicht nehmen, ihr Kind selbst zu baden. Das macht Lottos Bild so ungewöhnlich! Knieend wird Maria aktiv, als liebevolle und einfühlsame Mutter. Zärtlich und vorsichtlich birgt sie ihn in ihren Händen, während sich die verkrüppelten Hände der ebenso knieenden Salome ehrfurchtsvoll scheu dem Corpus Christi entgegenstrecken: das Kind wird ihr Heiland. Salome assistiert Maria nicht, sie ist selbst auf Hilfe angewiesen. Wir sehen mehr als eine harmlose Genreszene, die einfach nur eine Begebenheit des alltäglichen Lebens darstellt; überdeutlich und mit tiefer Symbolkraft hebt das Bad die menschliche Natur der Person Christi hervor. An die Stelle der Krippe tritt hier keine Badewanne oder ein einfacher Zuber, sondern ein metallisches Becken. Wir erkennen ein weiteres kleines Becken und einen Krug wohl für kaltes oder warmes Wasser, also Zubehör aus dem alltäglichen Leben einer Wochenstube. Die Badeszene ist Ausdruck der Selbstentäußerung Christi. In aller Menschlichkeit geht uns die Göttlichkeit des Menschgewordenen auf. Kraftvoll sind die Farben der Kleider, azurn, weiß, rot, weinrot, grün - im Kontrast zum nackten Jesus. Das Haar der Frauen ist verhüllt. Christi „Eigen-Licht“ liegt auf allen, spiegelt sich wider auf dem reinen Inkarnat Marias und den beiden steif gewordenen Händen der Salome. Dieses Detail bei Lotto ist bemerkenswert, weil in der Tradition nur von einer verkrümmten Hand die Rede ist. Das bereits den Kreuznimbus ausstrahlende Kind taucht ein in das Urelement Wasser; und wir tauchen ein in das Leuchten, das ausgeht vom Antlitz Christi (2 Kor 4,6). ER ist Lichtquelle - ein Schein, der sich mitteilt. Das Gemälde hält den Moment fest, bevor das Gottesbaby behutsam in das Wasser gesenkt wird. Dieser Augenblick wird wie ein Standbild, wie ein feierliches Ritual zelebriert. Auch von Großen der Weltgeschichte oder den Heldenmythen wird ein „erstes Bad“ erzählt - so von Dionysios, Ganymed, Achill, Alexander dem Großen, ‚Weltheilande‘, die darin mit den Schöpfungsquellen in Berührung kommen. Das Bad weist über den Alltag weit hinaus. Hat sich das Kind dieses Geschehen einfach so passiv gefallen lassen? Salomes Blick ist ganz auf Maria gerichtet, als würde sie stammeln: Wer bist du, wer seid Ihr, wer ist Er? Und Maria wird sie gleich ermutigen: Berühre das Kind behutsam mit deinen noch seltsam geballten Fäusten. Nimm diesen zerbrechlichen Schatz für einen Augenblick – und werde heil!
Auf die zweifelnde Salome verdichtet sich also der biblische Zweifel an der unversehrten Jungfräulichkeit Mariens „vor, während und nach der Geburt Jesu“. Sie vertritt quasi auch unser Suchen und Fragen. Mit ihr bekommt meine Skepsis Stimmrecht in der Heiligen Nacht. Ich darf mich damit vor Ihm blicken lassen und Ihm meine diffusen Gefühle und meine Unsicherheit wie ein seltsames Weihnachtsgeschenk hinhalten. Wie viele halb-glaubenden oder halb-zweifelnden ‚Weihnachtschristen‘ sind unter uns, die hineintauchen wollen in das Geheimnis der Nacht wie in ‚heiliges Badewasser‘…? Manche sind Heiligabendchristen, die doch das „Stille Nacht, heilige Nacht“ anstimmen oder mitsummen - das Lied, das zur Weihnacht 2018 seinen 200. Geburtstag feiert. Und wieviel Zweifel und Anfechtung stecken in dir und in mir? Was ist geworden aus dieser Frau, die Ihn berühren und sein erstes Wunder am eigenen Leib erfahren durfte? Wird sie die Salome sein, die als Mutter zweier Apostel, der Zebedäus-Söhne, in Erscheinung tritt? Oder ist sie eine Verwandte Marias, die in den engeren Nachfolgekreis Jesu treten und Zeugin des leeren Grabes werden wird (Mk 15,40; Mk 16,1; Mt 27,25)? Das Bild hebt die Bedeutung der Frau als Zeugin der wunderbaren Geburt Jesu – analog zum Zeugendienst am leeren Grab – hervor. „Eine Jungfrau hat geboren. Glaube es und werde heil!“. So betet die Ostkirche. Lorenzo Lotto lädt uns mit seinem zutiefst menschlichen und gefühlswarmen Bild ein: Bleibt nicht Zuschauer, werdet Mitwirkende. Sucht auf euren Krippenwegen Heil und Heilung! Weihnachtschrist, tritt ganz nahe heran an die Quelle des Lebens– auf den zu, der dir näher ist als du dir selbst jemals nahe sein kannst! Lass dich ergreifen von dem „Vere homo“, von dem „Wahrhaft-Mensch-Sein“ des Gottessohnes! Lass dich von ihm anstrahlen und ausleuchten! Halte Ihn für einen kurzen Moment! Nimm ihn dir zu Herzen, aber auch in deine Hände! Trage den, der dich trägt! Empfange ihn und schenke ihn weiter, so wie Maria der Salome dieses Kind für einen heilbringenden Augenblick gönnen wird! Nimm Ihn und lass ihn nicht fallen! Ergreife ihn - und damit das wahre Leben! Tritt heraus aus den allzu grell ausgeleuchteten Räumen dieser Welt, wo alles oberflächlich klar ist und tauche ein in das mystische Halbdunkel dieser Heiligen Nacht! Tauche ein, tauche auf – und lebe wie neugeboren als getaufter Mensch! Das Wunder der Heiligen Nacht ist ‚krass‘. Gott nimmt keinen Scheinleib an. Im gebadeten Jesus wird uns eine radikale Inkarnationschristologie zugemutet. Was hier anhebt, setzt sich fort in der Taufe Jesu, in seiner Verwundbarkeit und Nacktheit, seiner Erniedrigung am Kreuz - und in der Weise, wie ER sich in das eucharistische Brot hineinknien wird. Wir dürfen ihn berühren und lassen uns zuvor seine Berührung gefallen, seine Wunder, die manches Deformierte und Verkrümmte in uns erlöst, die meine müden Hände füllt und die meine Zweifel in Freude verwandelt. Diese nächtliche Botschaft vermittelt leise das Bild, das uns Abendländern noch einmal ein fremdes ostkirchliches Motiv ergreifend ausdeutet. Es wird Gründe geben, dass mich die Weihnacht viel zu wenig berührt: Blockaden, Zweifel, Gleichgültigkeit, Routine, verbrauchte Hoffnungen… Gerade darum dürfen wir ‚alle Jahre wieder‘ dankbar sein, weil uns Gott Gelegenheit gibt, das Krippenkind innerlich in die Arme zu nehmen - damit wir uns von der Stille, der Schönheit und der Einfachheit des Krippengeschehens ergreifen und erschüttern lassen. Wenn wir Weihnachten wahrhaft feiern, dann bleibt nichts, wie es ist. Die Hände der Zweiflerin werden durch den Leib Christi verwandelt. Ich wünsche Euch und Ihnen, dass auch wir wie Salome ergriffen werden - allein von der heilsamen Gnade, die mich erfassen möchte, von dem Kind, das uns von Maria gereicht wird und das mit mir und mit dir Geschichte machen möchte.
Gesegnete Weihnachten
Kurt Josef Wecker, Pfarrer
Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten?
Ostergedanken zum Fresko des Beato Angelico aus Zelle 8 des Dominikanerkonvents S. Marco in Florenz (1440/41)
von Pfarrer Kurt Josef Wecker
1. Ostern als Geheimnis malen: Das Unfassbare festhalten
„...und hinaus gingen sie, flohen vom Grab. Noch zitterten sie und waren außer sich. Und mit niemand sprachen sie etwas – voll Furcht wie sie waren. “ (Mk 16,8, übers. von Fridolin Stier).
Diesen Schlusssatz aus dem Markus-Evangelium muss ich jedes dritte Jahr in der Osternacht anfügen; denn die kirchliche Leseordnung will uns diesen harten Schluss ersparen. Doch ohne den letzten, vielsagenden Satz seines Evangeliums bliebe die Osterbotschaft des ältesten Evangelisten (Mk 16,1-8) unvollständig. Das Evangelium würde uns beruhigen statt verstören. Das Schwere muss jedoch ausgesprochen werden, und zwar als Teil der Frohen (!) Botschaft: Der Osterschrecken, der den Frauen angesichts des leeren Grabes in die Glieder fährt, das Taumeln und der Schwindel, die Furcht vor dem Unfassbaren, das Vermissen Jesu. Mit einem „voll Furcht waren sie“, mit einem offenen Ende, mit einer Flucht klingt ein Evangelium aus; damit ist für Markus alles gesagt. Auf dieses „Ende mit Schrecken“ läuft die frohe Botschaft dieses Evangelisten hinaus. Ein eher dissonanter Schlussakkord, als hätte sich ein Organist vergriffen, als hätten die Kirchenglocken einen Sprung. Diesen Satz, der sich so schlecht zu einer 'Osterantiphon‘ eignet, die man mit Halleluja einrahmt, will uns die Kirche heute nicht zumuten. Nirgendwo las ich eine plausible Erklärung, warum das Osterevangelium in unseren Lesungsbüchern einen Vers zu früh abbricht und uns dieser Satz in der Osternacht vorenthalten werden soll: dieses kargste, ehrlichste Osterevangelium, die ungeschminkte Wahrheit, die einzig angemessene Reaktion des Menschen auf das, was Gott uns heute zu feiern zumutet. Das ist ein Paradox: Das Zugleich von Furcht und Osterfreude. Die Freude schält sich nur langsam heraus - wie das Licht des neuen Tages allmählich die Nacht vertreibt.
Was gibt es Ostern zu sehen? Giovanni da Fiesole, eigentlich Guido di Pietro (1387-1455) malt uns in diesem Jahr das Osterevangelium, hält einen Moment fest, der jenseits allen Sichtbaren ist. Bekannt ist der Dominikanermönch unter dem Namen Fra Angelico, denn er ist berühmt für seine anmutigen Angeli, seine Engeldarstellungen. 1982 wurde der „Engelgleiche“ von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Bruder Angelico und seine Malergehilfen, die den Zellentrakt des Dominikanerkonvents S. Marco in Florenz um 1440/41 ausmalten, halten den Besuch der Frauen und ihre Begegnung mit dem Osterengel fest. Andachtskunst! Der Mönch, der in der Schlafzelle 8 (eine der drei „Priesterzellen“) seinen engen Lebensraum fand, wird mit dieser Situation in der Felsenkammer konfrontiert. Der hl. Ordensgründer Dominikus, den der Maler knieend links neben die Szene im Profil darstellt, wird zum Vorbild, zur „Identifikationsfigur“ für den in diesem Raum schlafenden, studierenden und betenden Dominikaner. Dieser kann sich kontemplativ versenken in das Wesentliche. Darum verzichtet Beato Angelico auf ‚Landschaft‘ und auf womöglich ablenkende Details und ‚Requisiten‘. Auch wir versenken uns in ein Andachts-, ein Meditationsbild. Wer ist die herausgehobene Frau am Grab? Diese Person tritt heraus, wird als Individuum erkannt. Manche denken an Maria Magdalena, die der Maler aus der Gruppe der drei Frauen (Mk 15,40) herausgelöst hat. Vermutlich jedoch lässt der dominikanische Maler die ‚andere‘ Maria dabei sein: die im Dominikanerorden hochverehrte Mutter Jesu. Sie ist die vierte Grabbesucherin, trägt noch das Rot der Passion und einen weißen Schleier. Vielsagend ist ihre Geste: verwirrt und wie von Schwindel gepackt, fasst sie sich an den Kopf; denn das Grab ist leer, der Leichnam ihres Sohnes verschwunden. Die Muttergottes in der Felsenkammer am Grab? Das wäre ein Detail, von dem die Evangelien seltsamerweise schweigen. Ja, wo war Maria zu Ostern? War die Mutter Jesu, die unter dem Kreuz stand, auch in der Grabhöhle? Oder wurde ihr keine Begegnung mit dem Auferstandenen zuteil? Auf diesem Fresko steht sie im Zentrum, und ihre mehrdeutige Geste drückt Fassungslosigkeit und Erschrecken aus, als befände sie sich unter dem Kreuz. Ihre Gebärdensprache sagt: Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich bin erschüttert, ich bin geblendet! Wohin ist Er verschwunden? Wurde mir auch der Leichnam des geliebten Jesus genommen? Marias innerer Blick ist rückwärtsgewandt. Wird sie sich umwenden und Ihn entdecken? In der Morgendämmerung des österlichen Ur-Sonntags, an dem das Unwahrscheinliche triumphiert, fiel es schwer, das Halleluja anzustimmen. Ostern, die unglaublichste Begebenheit von der Welt, ist für die Frauen zunächst nur zum Davonlaufen. Das Fest überfordert! Den drei eng zusammengerückten Frauen und der Gottesmutter ist ihr Suchen und Fragen, das nur leise Osterstaunen anzusehen. Nicht zu fassen! Christus und sein Tag – das ist zu hoch für uns! Zuviel auf einmal! Zuviel des Guten! Getroffen vom Unmöglichen! Wir müssten uns heute an Augenblicke im Leben erinnern, wo wir das sagen konnten: Das hat mich total überwältigt, das konnte ich nicht begreifen, das kann ich erst nach und nach auskosten und verstehen. Das war zu schön (schrecklich schön!), um wahr zu sein. Ereignisse, die uns aus der Bahn warfen, im Guten wie im Schrecklichen. Osterfreude paart sich mit einer Grenzerfahrung, mit Furcht und Zittern. Seit diesem von Gott gemachten ‚unmöglichen‘ Tag bleibt nichts mehr beim Alten!
2. Christus - kein Mann von gestern
Das 'schwache Geschlecht' ist das stärkste am Ostermorgen. Die Frauen sind Frühaufsteherinnen; sie sind bereits vor Sonnenaufgang auf den Beinen, wollen Ihn noch einmal sehen, eine Salbung nachholen, die am Vortag auf die Schnelle nicht möglich war. In aller Herrgottsfrühe wollen sie den Toten parfümieren und ein wenig konservieren; in aller Totenstille salben, ein leises Gebet sprechen und danach ihren toten Herrn in Ruhe lassen und sich auf den Alltag ‚ohne Jesus‘, die Zeit ‚nach Christus‘ einstellen. Das Leben ohne ihn muss weitergehen. Sie, die den Schrecken des Karfreitages gerade hinter sich haben, können nicht ahnen, dass ihnen nichts erspart bleibt, dass sie ins Passiv geraten. Ihnen steht in der Grabhöhle eine weitere Erschütterung bevor. Die Frauen hatten sich damit abgefunden, dass Jesus nun zu ihrer Vergangenheit gehört; sie wollten zu guter Letzt das tun, was pietätvoll war, damit alles seine Ordnung hat. Sie erwarteten, dass die Totenruhe galt und die Friedhofsordnung in Kraft war. Sie waren 'schon' so früh unterwegs, aber sie waren nicht die Ersten. Da war 'schon' längst vorher etwas passiert. Da hatte sich jemand an diesem heiligen (und für Juden auch 'unreinen' Ort) zu schaffen gemacht. Das war eine völlige Irritation, der erste Schrecken: „Rolling Stones“. Eine Grabplatte, die verschwunden war und den Blick – ins Leere freigab. So oft feiern wir Ostern. Erschüttert mich dieses Fest? Bleibt es eine verstörende Neuigkeit? Habe ich nach dieser Botschaft verlangt? Ist Christus für die Kirche mehr als ein Religionsstifter und Impulsgeber, mehr als ein guter Mann von gestern? Was würde mir fehlen ohne diese atemberaubende Aussicht, dass ich nie mehr ‚ohne Ihn‘ existiere?
Die Frauen waren mutig, in die dunkle Grabhöhle zu treten. Sie wirkt wie ein Tunnel, ein Schlund. Warum war der Körper Jesu aus dem Grab verschwunden? Was saß dieser fremde Andere da auf dem Rand des weißen, rotgeäderten Sarkophags und jagte mit 'Breaking news’ den Frauen eine Heidenangst ein? Ein Wortgottesdienst an seltsamem Ort! Aus der Perspektive der Frauen saß der Engel (Mk 16,5) auf der guten, der ‘rechten Seite', der 'Evangeliums-Seite'. Es konnte nur ein Überirdischer sein, der die Todesstille unterbrach. Nur ein Engel, der das weiße Gewand der göttlichen Welt trägt, konnte die Osterbotschaft überbringen – oder Jesus selbst. Im Osterevangelium des Markus bleibt der Auferweckte, anders als bei Fra Angelico, verborgen. „Ein jeder Engel ist schrecklich“, dichtete Rilke. Das gilt für unseren dominikanischen Marien- und Engelmaler nicht: die Gestalt des Osterengels im gleißenden Weiß - hell wie der Marmor des Sarkophags – ist anmutig; wohl aber sind dessen Worte eine Zumutung. Das Oster-Widerfahrnis ist eine Wucht! Aus dem deutenden Engelsmund und mit den ein wenig lehrhaften Zeigegesten seiner Hände wurde den Frauen eine unerwartete und ungefragte Botschaft nahegebracht. Der Engel gestikulierte wie ein Prediger aus dem Predigerorden des hl. Dominikus. Osterpredigt in Gebärdensprache, Ostern im Fingerzeig des Boten! Ein Finger weist in das offene leere Grab und sagt damit: „Er ist nicht hier!“ Durch den nach oben weisenden überlangen Zeigefinger des Engels wird Christus, der ‚über‘ und ‚hinter‘ den Frauen im halbrunden Abschluss des Bildfeldes in einer Lichtgloriole erscheint, in das Geschehen einbezogen. Stimme und Gestus des Engels werden zur Wegweisung. Christus drängt sich nicht auf. Er wird den „Salbfrauen“ (Peter Handke) und seiner Mutter Zeit lassen, dass sie Ihn wahrnehmen. Der Bote des Himmels bricht das fromme Unternehmen dieses Morgens, den geplanten Salbungsgottesdienst der Grabbesucherinnen ab. Die Suche nach Jesus ist zu Ende. Hier habt ihr nichts zu suchen, hier habt ihr nichts verloren, hier geht’s nicht weiter. Hier greift ihr ins Leere. Brecht die Wallfahrt zum leeren Grab ab! Hier seid ihr völlig deplatziert! Diese verstörende Aufklärung ist die Osterpredigt des Engels.
3. Aufgang der neuen Sonne - der himmelfahrende Christus
Am Ostermorgen sind alle sprachlos. Denn wir alle wissen nicht, was das wohl ist – 'Auferstehung'? Kein noch so frommer Maler kann es sich ausmalen, was in der Felsengrotte passiert ist, noch bevor die Sonne aufging. Meist begnügen sich ältere Osterbilder mit den drei Frauen am Grab und dem Verkündigungsengel. Durch solche eher diskreten Bilder lassen die Künstler den Auferstandenen als Abwesenden anwesend sein. Fra Angelico hingegen nimmt sich durchaus innovativ die Freiheit, den Auferstandenen ins Bild zu setzen. Wir erblicken ‚mehr‘ als die Frauen. Christus geht – quasi hinter ihrem Rücken – auf, wie die ‚neue Sonne‘, eine unfassbar neue Lichtquelle. Der Erhöhte erscheint frontal und schwebt in einer Lichtmandorla. Er trägt die Auferstehungsfahne mit großem roten Kreuz auf weißem Grund. In der rechten Hand hält er den Palmzweig als Zeichen seines Martyriums und Sieges. Das blutverschmierte Leichentuch hat er hinter sich gelassen; Jesus ist gehüllt in ein gleißend helles Verklärungsgewand, in das Kleid der Glorie. In der dunklen Höhle strahlt das ‚andere‘ Licht von Christi Auferstehungsleib auf. Die Lichterscheinung ist voller Leichtigkeit, ohne Erdenschwere, nicht zu fassen. In seiner unwiderstehlichen Aufwärtsbewegung und mit erhabener Siegesgebärde überschreitet Christus die dunkle Grabhöhle und schaut – uns an. Er steht mir gegenüber. Das ist nicht mehr der tödlich versehrte Schmerzensmann am Kreuz; nur unauffällig sieht man die Seitenwunde und eine Nagelwunde. Er – so ganz anders! Österliche Epiphanie! Christus und Maria bilden die Mittelachse. Wolkenschleier schieben sich zwischen beide. Ostern und Himmelfahrt fallen in eins. Himmelslicht ohne Schatten! Was für eine Überbelichtung! Jesus zeigt sich nicht auf Kommando. Er mutet uns wie den Frauen damals das bloße Wort des Engels zu, keine Berührung, keine tollen Gefühle. Er zwingt uns nicht zum Halleluja. Ein Leben lang lässt er uns Zeit, seine Feste zu verstehen. Er weiß, dass Menschen unter uns sind, denen danach nicht zumute ist und die sich vielleicht nur anlehnen wollen an die uralten Gesänge und Symbole. Vielleicht blicken wir in die falsche Richtung, hören unglaublich seltsame Predigtworte, starren wie Maria ins Leere. Wir brauchen Aufklärung wie aus Engelsmund. Keine Macht der Welt kann den Herrn herbeizaubern. Die erste Osterpredigt kommt aus dem Mund einer fremden Gestalt, die einen kurzen Frauengottesdienst auf dem Friedhof unterbricht und die kleine Gruppe 'aufgescheuchter Seelen' vom ‚Tatort‘ wegschicken wird. Ostern ist zunächst ein Suchen und Fragen - ein Blick- und Ortswechsel. Blickt nicht wie gebannt ins leere Grab, erhebt eure Häupter, entdeckt den, der verborgen ‚realpräsent‘ ist! Lassen wir es zu, dass wir dem Auferstandenen ins Auge fallen - ihm, der uns verborgen gegenübersteht und der uns(!) nachfolgt!
4. Eine überraschungsbereite Kirche
„Außer sich“ geraten – das wäre das Wandlungswunder von Ostern.Wendet euch um, denn er ist so nahe! In der Enge seiner Zelle wird der Mönch in seinem weißen dominikanischen Ordenskleid betend ‚Christus anziehen‘ (Gal, 3.7) und die Sprengkraft und Weite des Osterereignisses meditiert haben. Das Fresko in der Wand einer Schlafkammer wird zum offenen Fenster in Gottes größere Möglichkeiten hinein. Im Blick auf Ihn wird mein vielleicht müde und alt gewordener Glaube wacher und erwartungsvoller. Die Konzentration auf mein Ich wird durch den Blick auf den erhöhten Christus abgelenkt. Vielleicht sehen wir, die wir heute Ostern feiern, etwas fassungslos und mitgenommen aus - wie die Frauen, die die Nachricht von einem unfassbaren Wunder zu verkraften hatten. Vielleicht müssen wir uns von Gott mehr Herzklopfen und Unruhe erbitten, damit uns diese Neuigkeit wirklich packt und der Lebendige uns einleuchtet. Was für ein Augenblick! Er, der Fern-Nahe, steht uns allen gegenüber, sucht unseren Blick. Was für ein unverhofftes Wiedersehen! Werden wir seinem Blick standhalten und Ihm antworten?
Ihnen und Euch wünsche ich ein gesegnetes Osterfest!
KurtJosefWecker, Pfr.
Das Wunder draußen vor der Tür
Anbetung der heiligen drei Könige - Meister des Jakobsaltars, 1430
Hat Bethlehem einen Stern verdient?
Die Geburtsstadt Jesu strahlt wenig Weihnachtsromantik und Krippenzauber aus. Idyllis Geburtskirche – man muss sie mühsam suchen. Die Weihnachtsstadt in Palästina liegt im Schatten einer brutal die Landschaft zerschneidenden, hohen Mauer, die Jerusalem von der palästinensischen Westbank trennt. Viele Pilger nehmen die bittere und zugleich tröstende Erfahrung mit aus der ‚Stadt Davids‘: Weihnachten kann man sich zu Hause und in unseren Krippenwelten viel idyllischer vorstellen als am Ort des Geschehens.
Bethlehem ist bis heute kein romantischer und auch kein sensationeller Ort, keine Stadt, die im Baedeker-Reiseführer einen Stern verdient hätte. Gäbe es da nicht einen Ehrenbürger…! Warum nur hat sich Gott hierhin ‚verlaufen‘?
Die Weihnacht der heidnischen Sterndeuter
Bethlehem hat einen Stern verdient, auch wenn dieser Stern ausgedient hat und wie ein goldgelber Strohstern am Stallgiebel angeheftet wirkt. Unterm Stalldach entdecken wir ihn auf einem gotischen Tafelgemälde des anonymen „Meisters des Jakobsaltars“; das Bild entstand vor fast 600 Jahren. Der stillgestellte Stern signalisiert und markiert: Hier Halt! Das ist heiliger Boden! Da werden euch die Augen aufgehen!
Tauchen wir ein in das Bild! Geraten wir hinein in eine dicht gedrängte Szene unter freiem Himmel! Viel Gold glänzt und bezeugt, dass der Himmel offen steht und sich in der Weihnacht auf die Erde herabgeneigt hat. Drei Reisende sind angekommen. Das Bild malt uns die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Matthäus aus (Mt 2,11), die Ankunft der Sterndeuter an der Schwelle zum Geheimnis. Ihnen geht Gottes Herrlichkeit auf, sie werden ‚einsichtig‘. Wir erblickenkluge Menschen, Sternkundige, Mächtige. Königlich sind sie, weil sie Aufgeklärte, Wissende sind.
Ausgestattet mit Durchblick und ‚königlicher‘ Weisheit, haben die drei – vielleicht ganz unabhängigvoneinander und an verschiedenen Orten – einen ungewöhnlichen Stern im Buch der Schöpfung wahrgenommen. Sie hätten sagen können: Schön und gut! Aber was geht mich dieses seltsame Phänomen am Himmel an? Man kann das Neue im Elfenbeinturm ungerührt oder interessiert betrachten und doch achselzuckend zu Hause bleiben. Diese Wissensdurstige aber sind aus der Ruhe zu bringen. Zu plötzlich war der Stern da, zu seltsam blitzte er auf, zu verlockend war der Ruf. Dem Stern hinterher, das Suchspiel beginnt! Die Drei werden Weggenossen. Sie folgten dabei nicht 'ihrem Stern’, wie es manchmal etwas esoterisch heißt. Es war nicht ihr eigener Antrieb, der sie in Bewegung setzte. Ihr Drang aufzubrechen war mehr als Neu-Gier. Ohne den auffallenden Lockruf des merkwürdigen Stern-Zeichens wären diese Magier nicht so weit vor die Tür ihrer Heimat und in keinem Fall nach Bethlehem gelangt! Gott selbst war es, der Suchende von weither in das Allerheiligste führte und lockte und denen, die suchten, zum roten Faden wurde.
„Auf, lasst uns gehen!“ - so sagten sie wie die Hirten. Können wir das leidenschaftliche Interesse, das Herzklopfen der Weisen aus dem Morgenland nachempfinden? Diese Würdenträger sind Heiden, denen die Heilige Schrift fremd ist, in welcher dem Volk Israel der Messias angekündigt wurde.
Und doch finden sie Ihn - und der Messias sie. Ihre Studienreise wurde zur Pilgerfahrt, die Begegnung mit einem Kind zum ‚Gipfeltreffen‘. Bevor später die Apostel zu ‚allen Völkern‘ aufbrechen (Mt 28,19), waren die Völker in Gestalt dieser heidnischen Fremden längst schon bei diesem messianischen König angekommen! Das Kind zieht sie an sich. Die drei griffen nach den Sternen – und fanden - keinen Außerirdischen, der auf der Erde gelandet ist. Sie entdeckten
‚Normales‘ und stießen auf ein Baby. Ja, diese Könige wurden gewissermaßen die ersten Heilig-Land-Wallfahrer, keine Kreuzfahrer, sondern friedliche Christus-Pilger der ersten Stunde. Auch wenn sie „religiös musikalisch“ waren - aus sich heraus hatten sie keinen blassen Schimmer, wen sie entdeckten. Gott war heimlich dabei in ihrem Suchen, auf ihren Wegen, ER war ihr Navi. Nun liegen sie dem seltsamen Gottesgeheimnis zu Füßen, ihnen ‚passiert‘ die Stunde ihres Lebens. Sie begehen ein Fest der Annäherung. Große machen sich klein, Ferne gelangen in die Nähe, leidenschaftliche Sucher werden glückliche Finder und erleben einen Augenblick höchster Erfüllung. Ihnen stand die ‘Entdeckung des Himmels' auf Erden bevor. Ihr Weg hatte ein Ziel.
„Durst und Staub der langen Reise, wer denkt daran zurück?“ (GL 829,3). Der Stall mit den auffallenden, filigranen ‚Kirchenfenstern‘ ist nicht zerfallen. Ausgerechnet das offene Gebäude soll an die offene Paradiestür erinnern? Diese offene ‚Stallkapelle‘ haben Ochs und Esel belegt. In der Herberge und auch im Stall ist kein Platz für Ihn. Die Tiere besitzen ein feines Sensorium für das staunenswerte Kind. Wache Tieraugen blicken auf den, der draußen vor der Tür für alle Welt zur Welt gekommen ist:
Er - außen vor! Er - nicht daheim! Er - eine Randexistenz! Da liegt Er - für Mensch und Tier, für Reine und Unreine, für Juden, Christen und Heiden, für Sünder und Gerechte, Ja, das fremde Kind zieht die Aufmerksamkeit von Mensch und Tier auf sich. Die Sterndeuter gruppieren sich im Profil, ihrem Alter entsprechend, hintereinander gestaffelt, stufenförmig, Exotisch bunte Gewänder geben ihnen eine individuelle Prägung. Der Glaube ist bunt. Ab dem 14. Jahrhundert stellte man sich zwar in der Kunst den dritten König als einen Schwarzen vor; doch hier ist Melchior noch junger blonder bartloser Mann. Die späten Gäste kommen nicht mit leeren Händen, sie bringen Goldiges mit. Wir sehen kein Gefolge, keinen Engel. Selbst Josef fehlt (vgl. Mt 2,11). Eng ist die Szene gemalt ist - niemand steht uns im Weg. Wir schauen uns das seltsame Schauspiel womöglich skeptisch und distanziert an. Will ich mehr als nur Zaungast sein? Will ich mich mit gläubigem oder „ungläubigem Staunen‘ annähern?
Lassen wir uns hineinbitten in dieses dicht komponierte Bild! Weihnachten rücken wir näher zusammen. Die drei Besucher stehen nicht im Blickfeld. Diese Ankommenden sind ‚Vorübergehende‘, die hier Station machen. Sie werden hier nicht ewig verweilen, auch wenn der Augenblick so schön ist. Bald werden sie uns bald Platz machen. Und dann sind wir gefragt: Ist es menschenmöglich, dass Gott so und ausgerechnet hier zu uns kommt? Ist das schon alles, was uns das Evangelium zur Weihnacht zu sehen gibt? Bloß eine Mutter-Kind-Gruppe? Stallgeruch statt Weihrauch? Hast Du, Gott, nicht mehr zu bieten? Das soll der 'Weihnachtsgott' sein? Der Höchste, der uns nicht blendet und überrumpelt, sondern sich ‚einfleischt‘ in die nackte Existenz des Christuskindes? Kommt der Himmel so menschlich, so nahbar, so ebenerdig, so splitternackt zu uns herunter? Die drei Sterndeuter sind königlich, weil sie dieses Neue ahnen und in die Aura des Einen geraten, weil sie sich irritieren lassen und sich vor der Überraschung verbeugen. Diese Heiden werden die ersten sein, die den wunderbaren Anfang Gottes mit seiner Welt wahrnehmen. Sie sind (nach Matthäus) die Allerersten, die Weihnachten feiern, die auf unausdenkbar Neues, Unerwartetes, Menschenunmögliches stoßen, dem gegenüber alle News dieser Welt alt und verbraucht aussehen. Dieser Neugeborene macht ja auch unruhig, verlangt ein Umdenken, ein Neulernen. Manche Zeitgenossen lassen die Finger weg von solchen Abenteuern und lassen das Neue auf sich beruhen. Wenn ich dem Geheimnis der göttlichen Novität wirklich auf den Grund gehe, dann strahlt es aus und erbittet einen neuen ‚Lebenswandel‘. Diese Männer konnten nicht ahnen, dass der auffallende Stern sie zum 'neuen Adam' führt, zu einem absolut anderen und umwerfend Neuen, der mitten in der Antike die 'Neuzeit' beginnen lässt, die ‚Schwellenzeit‘, die Zeitenwende zum Guten. Den Weisen widerfuhr eine Erscheinung, die gerade in ihrer unspektakulären 'Normalität' so überwältigend und liebenswürdig war. Die wunderbare ‚Wucht‘ eines Kindes beeindruckte diese Gäste schwer, sie zwang aufrechte Männer in die Knie. Angesichts dieses auf die Erde gefallenen ‚Messias-Sterns“ kann der Stern von Bethlehem zum gelben Strohstern am Dach werden. Er hat seine Schuldigkeit als Wegweiser getan. Die drei Fremden haben einen langen Weg zu diesem kleinen fremden Gast auf Erden hinter sich. Doch sie sind ‚in Form‘, nicht reisemüde oder enttäuscht, sondern hellwach und geistesgegenwärtig. Sie können trotz müder Beine knien und ihre ‚Position‘ verlieren. Diese Geste vollziehen Männer, die anderenorts bewundert werden. Jetzt sind sie da vor dem, der ganz ‚da‘ ist für sie. Sie werden schwach vor dem Schwachen; in den Geschenken bieten sie sich an, ihr Ja, ihre Präsenz, ihre Selbstvergessenheit. Ja, damit kann ich Gott beschenken! Die Fremden erleben dieses Kind als heilig. Mutter und Kind wirken nicht aufgeregt angesichts des königlichen Besuchs, sondern bleiben ganz aufeinander bezogen. Der weltbewegende kleine Retter - ihn sehen wir als Schoßkind. Maria wird im traditionell blauen mantelförmigen Überhang gemalt. Sie sitzt wie auf einem mit Brokat bedeckten Thron und hält die ‚nackte Wahrheit‘. In seiner beinahe provozierenden Blöße liegt das Gottesbaby so bedürftig im Schoß der gut bekleideten Frau. Ein auffallend weißes Tuch hängt wie ein zufällig über eine Latte geworfenes Altartuch hinter der Personengruppe. Das Gottesbaby ist dem knieenden Mann zugewandt und greift lässig und unbefangen in eines der beiden geöffneten Goldkästchen. Darin erkennt man Goldmünzen, die Macht dieser Welt. Gott und Gold begegnen sich. Woran hängt mein Herz? Martin Luther formulierte es in der 62. der 95 Ablassthesen prägnant: „Das Evangelium Jesu Christi ist der wahre Kirchenschatz“.
Die Entdeckung des Himmels unter uns
Gott ist auffindbar, er lässt sich entdecken. Und schöner noch: er lenkt meine Schritte, wir werdenvon Ihm erwartet! Fernweh sollten wir alle mitbringen in das Fest der Weihnacht. Jeder Gottesdienst ist eine Begegnung auf der Schwelle, eine Grenzüberschreitung, ein Abenteuer. Wir tauchen ein in den Jungbrunnen des Christusfestes, denn wir haben diese Feier bitter nötig. Uns drängt der unwiderstehliche Charme Gottes, alle Jahre neu die Weihnacht zu feiern. Die Gebärde der klugen Männer - sie ist zur Nachahmung empfohlen. Das kosmische Sternenlicht am Himmel ist vergessen, weil allein der umwerfende Lichtblick aus den Kinderaugen zählt. Was ‚macht‘ das Fest mit mir? Wird mir Bethlehem zum Ort der Verwandlung und der schönen Bescherung? Der Stall von Bethlehem ist keine Privatkapelle, sondern ein Haus der offenen Tür für alle Welt, gerade für ‚heidnische Fremde‘, denen Gott zum „Herz-Schritt-Macher“ wird. Das Geschehen der Geburt Jesu, auch wenn es sich in einem Provinznest zutrug, hat nichts Provinzielles. Die Entdeckung eines Sterns am Himmel führte die Männer zur Entdeckung des Himmels buchstäblich unter uns. Es liegt in den Armen der Frau, die Ihn berührt, aber nicht festkrallt. Er ist der Unverfügbare. Und Maria ist die Monstranz, die das Kind einfach diesen weitgereisten Männern - und uns zeigt. Er ist hier und heute unter dem Zeichen des Brotes der zerbrechliche Gott, der sich unter uns verteilt und niemanden leer ausgehen lässt. In der goldenen Hostienschale ‚nur‘ Brot - und darin alles!
Vielleicht geht mir nur eine Lichtsekunde lang auf, dass du und ich, dass wir alle von langer Hand erwartet werden. Das Kind überwältigt durch seine bloße Präsenz die, die wohl schon viel Verblüffendes in dieser Welt gesehen haben. Das „Christkind“ lenkt die Schritte der Gottsucher und übernimmt die Initiative. Die Anbetung, die scheue Annäherung, die selbstvergessene Überwältigung, das Staunen - das sind wahrhaft königliche Geschenke. Den materiellen 'Mitbringseln' - den luxuriösen Geschenken - hat das Kind nur eines entgegenzusetzen: seine merkwürdige 'königliche Audienz', sein Lächeln. Dieser dichte Augen-Blick wird sich unauslöschlich eingeprägt haben ins Gedächtnis der anonymen Wahrheitssucher. Nicht oben am Sternenzelt, sondern ganz unten leuchtet ihnen Gottes Licht ein. Und mit diesem Lichtblick, mit leeren Taschen und übervollen Herzen werden sie abtreten und zurückkehren in ihren Lebensraum.
Nur kurz waren sie beim Kind, doch nicht als zufällige Passanten. Sie hinterließen mehr als nur ein flüchtiges „Schön war’s! Danke! Und Tschüss“. Die drei Besucher werden als ‚heilig‘ verehrt, auch wenn sie keine Apostel, keine Christen wurden. Diese fremden Männer aus der Ferne geben uns durch ihr Suchen und Finden, ihr Kommen und Gehen zu denken. Sie haben den entdeckt, der alles erneuert. Diese Menschen aus der Ferne könnten Martin Luthers Weihnachtslied anstimmen:
„Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein‘ neuen Schein“ (GL 252,4).
So tritt Gott in Erscheinung! Ich wünsche uns Augen und Herzen, damit Er uns einleuchtet. Daswären ‚frohe Weihnachten‘, wenn unsere Suchbewegung bei Ihm zur Ruhe kommt, wenn wir entdeckten: der fern-nahe, arm-reiche göttliche Gast sucht und besucht dich und mich. Mit ihm erscheint die reine Gnade in Person, die Luther und viele Heilige so überwältigte. Er ist das unverhoffte, unverdiente Geschenk. Und er ist gerade dann da bei uns, wenn wir nicht mit Ihm sind.
Was für eine Überraschung! Euch und Ihnen eine gesegnete Weihnacht!
Kurt Josef Wecker, Pfr.
Bildbetrachtung zu Ostern 2017 von Pfarrer Kurt Josef Wecker
Unberührbar berührend
Die drei Marien am Grabe und: Christus erscheint Maria Magdalena (um 1330)
„Morgenglanz der Ewigkeit“
Die Flagge auf dem Kreuzstab flattert im Wind, bewegt von Osterluft, von der „ Morgenluft der Morgenlüfte“ (Peter Handke), dem göttlichen Lebensatem. So viel österlicher Goldglanz! „Dieser Tag ist Christus eigen“ (GL 103). Ja, dieser Tag ist 'grenzwertig'. Wer hat sich nur diesen „Plot“- wie man im Drehbuch eines Filmes sagen würde -, diesen Wendepunkt ausgedacht? Wer lässt diesen Toten nicht in Ruhe tot sein? Hoheitsvolles strahlt uns aus diesem alten Osterbild entgegen, das unfassbare Staunen über den Augenblick nach der Auferstehung und über den, der diesen Tag gemacht hat.
Kreative Bibel-Untreue
An keinem Tag im Kirchenjahr predige ich lieber als zu Ostern. Und doch - wie lässt sich überhaupt von Ostern erzählen? Können wir so berührend und überwältigt das Ostergeschehen bezeugen, dass der Funke überspringt? Wie kann man sich das Unvorstellbare ausmalen?
Geht doch! Maler wagen dies. Sie arrangieren neu, können Ereignisse gleichzeitig zeigen, wo Worte nur nacheinander zu erzählen vermögen. Der unbekannte österreichische Maler aus dem 14. Jahrhundert hat recht: Ostern kann man nicht in ein Bild fassen. Es ist unmöglich, den Auferstehungsvorgang zu sehen. Immer haben wir das Nachsehen, können nur die Folgen des Wunders wahrnehmen. Das Gemälde, heute im Stift Klosterneuburg aufbewahrt, zeigt also mehr, als uns eine einzelne Perikope der biblischen Ostergeschichte sagt. Der mittelalterliche Künstler verbindet eigenständig Evangelien-Berichte; er hat die Freiheit zu ein wenig 'Bibel-Untreue'.
Ende der Wallfahrt zum Grab – Ihr sucht Ihn am falschen Ort!
Der Bildraum auf diesem Osterbild ist eng gefüllt. Unseren Augen werden zwei Szenen synchron dargeboten: das Gespräch des Engels mit den drei heiligen Salbfrauen, von denen Mk 16,1 berichtet; und die Begegnung Jesu mit der einen Frau, Maria von Magdala, wie sie Joh 20, 11-18 bezeugt. Wir sehen oben die Suche der Frauen nach einem Toten, das Vermissen eines Leichnams – und im Bildvordergrund die sehnsüchtige Suche einer Frau nach dem Lebendigen. Matthäus 28,9b erzählt das Detail vom Kniefall der Frauen vor Jesus - und vom Umfassen der Füße Jesu, eine Berührung, zu der es auf diesem Bild gerade nicht kommt. Ostern geschieht im Freien. Ein Engel überrascht die drei Frauen. Sie sind von uns durch den - gewaltig ins Bild geschobenen - Sarkophag getrennt; wir sehen sie nur als Halbfiguren. Die Frauen sind zu dieser Stätte gekommen, weil sie einen Verlust zu beklagen haben. Sie haben Ihn verloren. In Gedanken gingen sie einem Toten nach. Der Tod macht so stumm. Es bleiben gut gemeinte, hilflose Gesten. In ihren Gedanken sind die Drei mit einem Leichnam beschäftigt. Das ist der erste „Osterschrecken“: dass der Leichnam verschwunden ist. Ostern beginnt mit diesem Schock, mit dieser 'Verlustanzeige'! Diese Trauernden haben ihren Christus verloren. Das Grab ist leer; zu erkennen ist auch ein Teil der am Sarkophag angelehnten Deckplatte. Das ist kein Grabbau, kein Felsengrab, kein „Endlager“. Erinnert dieser Block mit dekorativer Fassade an die Stadtmauern des himmlischen Jerusalems, in das der Auferweckte heimkehren wird? Jetzt ist er nur noch leerer 'Behälter', nur 'Requisite'. Der Engel sitzt fast lässig auf der Seitenkante (Mt 28,2) und spricht mit einer der drei Salbfrauen. Er hält das Leichentuch; dieses Textil bildet beinahe das Zentrum des Bildes und signalisiert das eine: Lasst euch die 'ungefragte' Oster-Antwort sagen: ER ist nicht hier! Er ist auferstanden. Hier sucht ihr Ihn am falschen Ort! Macht kehrt, brecht eure seltsame Wallfahrt zu einem Toten ab, sucht Ihn anderswo! - Wo ist der Engel, der uns das sagt? - Der Engel wirkt beinahe ärgerlich, dass die Frauen nicht begreifen wollen, dass sie hier fehl am Platze sind. Verstand und Gefühl dieser Frauen kommen so schnell nicht mit. „Es ist nicht die Stunde des Gesangs, sondern des Stammelns“, sagte Octavio Paz. Die Frauen fragen sich: Wer steckt dahinter, wer hat dieses unfassbare Geschehen zu verantworten? Diese Osterpredigt ist zu hoch für sie - und für uns! Ja, jede Osterpredigt ist zu hoch für den reinen Menschenverstand.
Gestik und Mimik der Frauen sprechen Bände. Zwei von ihnen sind händeringend im Gespräch, weil da etwas Unerklärliches passiert ist und der Engel eine verstörende Botschaft ausrichtet. Die andere, Maria Magdalena – es ist dieselbe Person, die in der zweiten Szene Christus zu Füßen liegt – hebt demonstrativ das Salbgefäß hoch, obwohl es hier keinen Toten mehr zu salben gibt. Dafür kommt sie zu spät. Das leere Grab und die Engelsworte geben zu denken, aber sie allein lassen uns noch nicht an das Osterwunder glauben. Da muss mehr geschehen: Er selbst müsste erscheinen, sich uns kundtun!
Ostern – das Christusfest
Bedeutsamer als die Begegnung des Engels mit den „Leichensalbfrauen“ (Peter Handke) am offenen, leeren Grab ist die vom Evangelisten Johannes (Joh 20,14-18) inspirierte, exklusive Begegnung des erhöhten Christus mit Maria Magdalena im Bildvordergrund. Die vom Künstler heraus gehobene Szene springt ins Auge. Die beiden Gestalten sind vom Grab abgekehrt, das nur ein 'Transitort' war. Ein Ortswechsel ist angesagt. Die Begegnung des Engels mit den Frauen wird zur Nebenszene. Denn hier am rechten Bildrand ist die Hauptperson anwesend, die die Übersicht und das 'letzte Wort' hat. Die Landschaft bleibt unbestimmt, fast ohne Vegetation. Auffallend ist nur der Hügel, auf dem Er steht. Wir sehen einen einzelnen Baum 'zwischen' Maria und Jesus. Mich erinnert der Baum an den Paradiesgarten, in dessen Mitte ein Baum stand, von dessen Früchten zu essen dem 'alten Adam' verboten war - und an den fatalen Zugriff Adams, um sich eigenmächtig Erkenntnis über 'Gut und Böse' zu verschaffen. Jetzt steht der 'neue Adam' vor uns, Christus, der das Kreuzzeichen in seinem Nimbus trägt und die Siegesfahne mit dem Kreuz, dem Lebensbaum, hält. Der Auferweckte ist nicht greifbar nahe und auf Augenhöhe, sondern auf diesem Hügel, der eine 'Aura der Ferne' (W. Benjamin) anzeigt. Zwar fehlen Jesus die äußeren Zeichen seiner Verwundung, doch ist er als der Gekreuzigte am Kreuzesnimbus zu identifizieren. Wer hat Ihn neu eingekleidet in ein grünes Gewand, wer hat Ihm den roten Umhang umgelegt? So feiert Er Auferstehung! Ja: Er steht und setzt sich fast wie eine Statue in Szene.
Christus ist der Frau zugeneigt, die Ihn sucht. Marias Blick ist aufwärts gerichtet. Augenblicke kreuzen sich, Hände strecken sich entgegen. Was für ein spannungsgeladener Augenblick des Innehaltens, des 'unverhofften Wiedersehens', der gegenseitigen Zuwendung! Der nicht zu fassende Herr ist da, dem wir uns nur scheu annähern können - vielleicht auf Knien wie Maria Magdalena. Joh 20,14 erzählt nichts vom Kniefall. Die Frau und der, den sie für den Gärtner hält, stehen sich - im Zeugnis des Evangeliums - gegenüber, wenden sich einander zu. Doch der mittelalterliche Maler setzt die Ehrfurcht gebietende Osterfreude in Szene. Wir ahnen die Faszination des Suchens und Findens, die gemischten Gefühle einer umwerfenden Überraschung, die Maria erfüllten. - Wie würde ich reagieren, wenn Er mir so gegenüber träte? Wie werde ich mich verhalten, wenn ich Ihn einmal von Angesicht zu Angesicht erblicke?
Die Körperhaltung der Frau am Boden nennt man Proskynese, wörtlich das 'Anhündeln'. Auf solche Weise näherten sich die Bittsteller dem Kaiser in Byzanz. So zeigte auch die syrophönizische Frau ihr Anliegen, als sie bei Jesus 'wie eine Hündin' ein Wunder für ihre Tochter erkämpfte (Mt 15,21-28). Maria ist ganz 'außer sich'. Sie streckt ihre beiden Hände nach dem aus, den sie nie in den Griff bekommen wird. Diese Begegnung ist dicht, intensiv. Jesus 'berührt' das Herz dieser Frau, indem er ihren Namen „Maria“ ausspricht. Zu einer körperlichen Berührung wird es nicht kommen. Gewiss verlangte es sie nach 'mehr', nach Betasten des Christusleibes, nach „Leibesvisitation“ (Alex Stock) – ähnlich wie der Apostel Thomas am 'achten Tag', als er Ihn an seinen Wundmalen erkannte und in seine klaffende Seitenwunde hinein fassen will. Maria jedoch muss die schwere Zumutung des nachösterlichen Glaubens lernen: Wir 'haben' Christus nur in diesem wunderbaren Gegenüber, nicht als frommen Privatbesitz. Das Berührungsverbot, das „Halte mich nicht fest!“ das „Rühre mich nicht an!“ (griech. „Haptein!“) muss auch der Kirche immer wieder neu gesagt werden. Er, der freie Christus, bleibt der Höhere, der auch über der Kirche Stehende. Wenn er Begegnung schenkt, dann ist das Gnade. Immer ist es auch Begegnung mit dem neuen, fremden Jesus, dem jetzt so ganz anderen. Dieser österliche Moment ist berührend, gerade weil Maria Ihn nicht berührt, weil sie den Unberührbaren akzeptieren muss. Ostern ist das Wunder, dass wir von Ihm angeschaut werden, dass er uns nie mehr aus seinem Blick verliert, dass er unsere Namen nie vergisst. Er schenkt Maria und uns auf ewig Ansehen. Der auferweckte Christus wird den Standpunkt wechseln, um heute zu uns unterwegs zu sein. Er wird nicht seine eigenen Wege gehen, sondern unterwegs sein zum Vater und auf unseren Wegen. Das ist Ostern und Himmelfahrt zugleich. Christus wahrt den Vorsprung, entzieht sich auch der frommen Zudringlichkeit. Am Erhöhten scheitert unser Fassungsvermögen. Wir können Ihn nicht wegsperren in Kirchen und Tabernakeln oder festhalten in unserer 'andächtigen' Erinnerung und in unseren 'frommen' Gedanken.
Noch ist er im Bild anwesend, befindet er sich jedoch schon am Bildrand - in jedem Moment bereit, aus dem Bild hinauszutreten, aus Marias Blickfeld zu verschwinden. Sie wird lernen, dass Jesus nicht in das frühere Leben zurückgekehrt ist. Der österliche Herr ist auf dem Heimweg zum Vater und auf dem Weg zu dir und zu mir. Er ist kein Mann von gestern; er will mein Zeitgenosse sein.
Zuwendung und Entzug - beides zugleich kennzeichnet diese dichte österliche Begegnung. Jesus mutet Maria Magdalena Verzicht zu. Vielleicht wird sie wie eine Liebende sagen: „Es ist schön, dass ich dich nie begreifen werde.“ Es ist schön, dass du größer und geheimnisvoller bist, als ich es je ahne. Er ist der Vorüber-Gehende, das Passahgeheimnis.
Für uns alle ist er auferweckt worden!
Jesus zeigt sich dieser Zeugin. Und sie wird aufstehen und zur Botin der Osterbotschaft und zur Zeugin des lebendigen Christus werden.
Ihnen und Euch den Morgenglanz dieses Festes und – im Glauben – das „unverhoffte Wiedersehen“ mit dem Auferstandenen
Ihr/Euer Kurt Josef Wecker, Pfarrer